 Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk; Technische Regeln |  |
Hinweis zum Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden
Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV) lfd. Nr.: 173
Vom 10. April 2024
(Quelle: www.amev-online.de)
Stand:
April 2024
Aufgestellt und herausgegeben vom Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV)
Das Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden wurde zunächst vor allem aus wirtschaftlichen Gründen betrieben, d.h. der Begrenzung der Belastung öffentlicher Haushalte durch Betriebskosten. Die aus der Energieerzeugung resultierenden Schadstoffbelastungen, Treibhausgasemissionen und die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen sind zudem lange bekannt. Die eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel, der im Wesentlichen durch die CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Ressourcen verursacht wird, und die bereits massiv erkennbaren weltweiten Konsequenzen dieser Klimakrise zwingen spätestens jetzt zu einer forcierten Wende in der Energieanwendung. Die jüngsten Krisen - Corona-Pandemie mit gestörten Lieferketten, Krieg in der Ukraine mit der Unterbrechung bedeutender Energielieferungen - haben zudem die politischen und wirtschaftlichen Risiken der Abhängigkeit von Energieträgerimporten aus wenigen Ländern unmissverständlich klargemacht.
Deshalb stehen wir nun vor der Herausforderung, in einem im Vergleich zu früheren Veränderungen sehr kurzen Zeitraum die bisher die Energieversorgung dominierende Verbrennung fossiler Energieträger vollständig zu beenden. Dies wird nur möglich sein durch ein Zusammenwirken verschiedener Handlungsstränge: Gleichzeitig Begrenzung der energierelevanten Ansprüche (Suffizienz), Steigerung der Energieeffizienz und Umstieg auf erneuerbare Energieversorgung.
Die für diesen Wandel benötigten Technologien sind grundsätzlich bekannt und verfügbar., auch wenn einige Varianten noch näher untersucht und in Pilotprojekten geprüft werden sollten. Das notwendige Tempo der Veränderungen führt jedoch zu Engpässen in den Kapazitäten und Ressourcen von Planern, Produktherstellern, Bau- und TGA-Unternehmen, sowie Roh- und Baustoffen. Deshalb ist die Steuerung eines möglichst effektiven Weges bedeutend, insbesondere hinsichtlich Energieeinsparung einerseits und Umstellung auf erneuerbare Energieversorgung andererseits.
Der öffentlichen Hand kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu. Die gesetzlichen Anforderungen sorgen bereits für eine weitgehend zukunftsgerechte Ausführung von Neubauten. Gerade die staatlichen und kommunalen Verwaltungen verfügen aber über einen umfangreichen Gebäudebestand, der nur zu kleinen Anteilen durch Neubauten ersetzt wird. Die entscheidenden Einsparungen an Energie und Emissionen sind also in Nutzung, Betrieb, Optimierung und Sanierung der bestehenden Gebäude zu erzielen.
Diese Empfehlung bietet eine praxisnahe Hilfestellung für den Weg zu einem klimaneutralen Bestand öffentlicher Gebäude. Sie soll dazu beitragen, dass betriebliche Erfahrungen bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beachtet werden. Darüber hinaus gibt sie Anregungen zur Strukturierung der Aufgabenfelder.
Diese Empfehlung ersetzt die AMEV "Energie 2010"
1. Der Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand
Als nationalen Beitrag zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels gibt das Bundes-Klimaschutzgesetz vor, dass bis zum Jahr 2045 die Treibhausgasemissionen so weit gemindert werden, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Dies liegt im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit.
Der öffentlichen Hand kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu. Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen die Klimaschutzziele zu berücksichtigen. Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände haben dies innerhalb ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche auszugestalten. Eine Kernaufgabe ist dabei die Entwicklung der öffentlichen Gebäude hin zur Klimaneutralität. Viele Länder und Kommunen haben sich dafür Ziele gesetzt, die Klimaneutralität bereits deutlich vor 2045 zu erreichen.
Ende 2023 ist das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) in Kraft getreten. Das Gesetz beinhaltet u.a. für die Öffentliche Hand (Bund, Länder und Kommunen) Verpflichtungen zur Reduzierung des Primär- und Endenergieverbrauchs.
Zur Definition der Klimaneutralität sind unterschiedliche Ansätze in der Tiefe der berücksichtigten Aspekte und in der Emissions-Allokation möglich. Die Begriffe Klimaneutral/THG-neutral/ CO2-neutral/Dekarbonisierung sind in Anhang A erläutert.
Die Quellenbilanz berücksichtigt nur die direkten Emissionen, hier in den öffentlichen Liegenschaften; die Verursacherbilanz berücksichtigt auch die Emissionen in den zur Versorgung benötigten Vorketten ggf. bis hin zur Herstellung von Baustoffen. Besonders diskutabel sind die Zuordnung der Emissionen für die Erzeugung von Fernwärme und Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung und Abfallverbrennung, die Verwendung von Kompensations-Zertifikaten und der Einkauf von Ökostrom. Jede Verwaltung muss für Ihren Verantwortungsbereich ein insgesamt schlüssiges Verfahren festlegen. Mindestens für die Kommunen empfiehlt sich eine Orientierung an der im Auftrag des Umweltbundesamtes erarbeiteten Bilanzierungssystematik kommunal (BISKO).
Unabhängig von den Definitionen und Bilanzgrenzen ist der entscheidende Aspekt für den Klimaschutz im Gebäudebereich, die Verbrennung fossiler Energieträger zu beenden. Dabei ist auch die für die Baustoffherstellung erforderliche "graue Energie" zu berücksichtigen.
Für die öffentlichen Gebäude können folgende Prämissen angesetzt werden:
- Die Stromerzeugung wird zunehmend auf erneuerbare Energien umgestellt, Strom wird damit perspektivisch als CO2-freie Endenergie betrachtet.
- Wärmenetze müssen spätestens bis 2045 vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden; damit wird auch Fernwärme perspektivisch als CO2-freie Endenergie betrachtet.
- Ebenfalls als CO2-frei zu betrachtende Energieträger wie Biomasse, grüner Wasserstoff und Derivate davon werden in den hier zu betrachtenden Zeiträumen nur begrenzt verfügbar sein und sind prioritär dort einzusetzen, wo keine Alternativen absehbar sind, d.h. Hochtemperatur-Anwendungen in der Industrie und Anwendungen mit notwendiger hoher Speicherdichte (Schwerlastverkehr, Luftfahrt), nicht regelmäßig für die Raumheizung.
- Planung, Ausbau und Dekarbonisierung der Erzeugung für die Strom- und Wärmenetze zur allgemeinen Versorgung ist Aufgabe der für die Wärmeplanung zuständigen Stellen und der Energieversorgungsunternehmen (EVU).
- Die Betreiber öffentlicher Gebäude sind verantwortlich innerhalb der Bilanzgrenze ihrer Grundstücke. Sie können und sollen durch aktive Forderungen zur Dekarbonisierung und Anschlusszusagen den Ausbau und die Umstellung der Netze fördern.
- Da die Energienetze der Zukunft zunehmend heterogener und dezentraler aufgebaut sein werden, erwächst den öffentlichen Liegenschaften die Möglichkeit und Verantwortung, die Systeme auch als aktiver Teil, z.B. durch Speicher oder Bodenbereitstellung zu unterstützen. Gerade bei großen staatlichen Liegenschaften kann sich die Abgrenzung der Rollen Betreiber öffentlicher Gebäude / EVU noch anders darstellen.
Die für die öffentlichen Gebäude verantwortlichen Verwaltungen stehen damit vorrangig vor folgenden Aufgaben:
- Transformation zu einer treibhausgasneutralen, nachhaltigen und kosteneffizienten Wärmeversorgung spätestens bis zum Jahr 2045, d.h. Ersatz der fossilen Energieträger im Wesentlichen durch Fernwärme und elektrisch betriebene Wärmepumpen gemäß lokaler Wärmeplanung.
- Insbesondere für die Beheizung von Bestandsgebäuden mit Wärmepumpen, die nur begrenzte Vorlauftemperaturen erreichen können, ist in der Regel eine deutliche Reduzierung des Wärmebedarfs notwendig; ggf. sind übergangsweise (von Heizungserneuerung bis zur Sanierung der Gebäudehülle) bivalente Systeme einzusetzen.
- Bei Fernwärmeversorgung sind bislang höhere Vorlauftemperaturen und Heizleistungen möglich; allerdings ist in Verbindung mit der Dekarbonisierung der Erzeugung auch eine Absenkung der Vorlauftemperaturen möglich. Die Reduzierung des Wärmebedarfs der einzelnen Gebäude ist jedenfalls auch deshalb anzustreben, damit begrenzte Erzeugungskapazitäten für möglichst viele Gebäude ausreichen und Betriebskosten gesenkt werden.
- Die Dekarbonisierung der Stromerzeugung ist durch Ausbau eigener Erzeugung mittels PV-Anlagen zu unterstützen; geeignete Dächer sind möglichst vollständig zu belegen. Wegen bautechnischer Mängel und statischer Begrenzungen ist das in vielen Fällen nur in Verbindung mit Dachsanierungen möglich.
- Auf Grund des sehr heterogenen Gebäudebestands von Denkmalschutz bis Plattenbau, unterschiedlichen Ausgangszuständen und entsprechend unterschiedlichen Eingriffsmöglichkeiten bei den öffentlichen Gebäuden wird kein einheitlicher Zielzustand zu erreichen sein, sondern eine Balance verschiedener Einzelergebnisse. Für Neubauten und Sanierungen können Standards festgelegt werden, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Als Beispiel seien die Energieeffizienzfestlegungen für Bundesgebäude (EEFB) genannt.
- Die Umsetzung erfordert eine mittel- bis langfristige Strategie zur Zielerreichung im Sinne von Dekarbonisierungs- und Sanierungsfahrplänen für ganze Gebäudebestände von Verwaltungseinheiten mit Zwischen- und Gesamtzielterminen (bis spätestens 2045).
- Diese Planung ist mit Finanz- und Personalressourcen zu hinterlegen. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf erheblich über früher üblichen Ansätzen für Gebäudeunterhaltung und -sanierung liegt.
- Für einen effektiven Mitteleinsatz ist innerhalb einer Verwaltung die Vorgabe einheitlicher Parameter und Bewertungskriterien einschließlich Umweltfolgekosten sinnvoll.
- Die Umsetzung eines Sanierungsfahrplans erfordert ein transparentes Monitoring
Hintergrund: Entwicklungstrends in der Energieversorgung
Dieser Abschnitt hat nicht den Anspruch, alle denkbaren Zukunftsszenarien für eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung darzustellen. Vielmehr sollen die aus Sicht des Redaktionsteams gegenwärtig verfügbaren und vielversprechenden Technologien, Anwendungen und Trends, sowie auch noch bestehende Unsicherheiten kurz zusammengefasst werden.
Zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieser Hinweise unterlag der globale (fossile) Energiemarkt sehr starken Turbulenzen. Während im Rahmen der Covid-19 Pandemie 2020-2021 die Energiepreise zunächst stark fielen (teilw. bis hin zu negativen Ölpreisen), erfolgte durch den - Krieg in der Ukraine ein sehr schneller und massiver Preisanstieg mit bis dato unbekannten Preisspitzen, bis hin zu Verzehnfachungen am Spotmarkt. Diese Entwicklungen verdeutlichen unmissverständlich - trotz inzwischen eingetretener Beruhigung der Märkte - die Risiken der globalen Energieversorgungsketten und der Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten. Diese Risiken bleiben auch künftig bestehen, solange Energie nicht überwiegend national oder regional gewonnen oder von einer breiteren Auswahl an Lieferländern bezogen wird. Die Kombination aus nationaler Gewinnung von Nutzenergie und einem länderübergreifenden Energiehandel ermöglicht ein höheres Maß an (Energie-) Autonomie und regionaler Wertschöpfung, wie auch der Nutzung der in anderen Ländern z.T. höheren Potenziale an Erneuerbaren Energien, sei es Solarenergie, Wind- und Wasserkraft oder Geothermie. Auch Biomasse, sofern nachhaltig gewonnen, bleibt ein Baustein.
Die politischen Ziele sprechen klar für Erneuerbare Energien und Abkehr von den fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas und Kohle. Für Deutschland ist der Ausstieg aus der Kernenergie erfolgt. Die Nutzung der Kernfusion ist in dem zu betrachtenden Zeitraum (bis 2045) keinesfalls zu erwarten. Der Betrieb von erdgasbefeuerter Kraft-Wärme-Kopplung, in den letzten Jahren als effiziente Übergangstechnologie zu den Erneuerbaren Energien anerkannt und verbreitet, ist nun als Auslaufmodell zu bezeichnen. PV-Anlagen sind auf öffentlichen Neubauten inzwischen Standard, Fassaden-PV-Anlagen folgen. Diese Gebäude produzieren einen hohen Anteil Ihres jährlichen Strombedarfs selbst. Eine komplette Autarkie - Unabhängigkeit von einer Netzversorgung - ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu erzielen, ein jahresbilanzieller Ausgleich von Verbrauch und Erzeugung bei geeigneten Rahmenbedingungen durchaus.
Zum Ausgleich der fluktuierenden Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien und dem Energiebedarf werden zunehmend Energiespeicher benötigt, sowie eine weiträumige leistungsfähige Vernetzung.
Unter den Arbeitsbegriffen "Sektorenkopplung", "Powerto-Gasto-Power (P2G2P)", "Powerto-Liquid (PtL)" oder "Powerto-Heat" wird die zunehmende Nutzung von elektrischer Energie zur Wärmeversorgung und andere Anwendungen (Mobilität/Transport) beschrieben. Eine weit verbreitete Anwendung ist die Wärmepumpe. Ein wichtiger Fokus ist hierbei auf die Wärmequelle zu richten (siehe Abschnitt 6.5.2).
Als Alternative zu dezentralen Wärmepumpen wird der Anschluss an Nah- und Fernwärmenetze betrachtet. Hier können Technologien wie Geothermie, Solarthermie, Biomasseheiz(kraft)werke oder die Nutzung industrieller Abwärme deutlicher praktikabler zum Einsatz kommen als in einem Einzelgebäude, ebenso die gezielte Nutzung von temporär überschüssigem Strom zur Wärmeerzeugung über Großwärmepumpen/Heizstäbe im MWel-Bereich.
Die kommunale Wärmeplanung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, vor allem im Bestand. Manche Gebäude bzw. -Quartiere können nur bedingt energetisch saniert werden und benötigen auch künftig signifikante Wärmemengen, die aus nachhaltigen Quellen zu decken sind.
Mit Hinblick auf den Wirkungsgrad ist die direkte Nutzung von elektrischer Energie durch Wärmepumpen zu favorisieren. Erst bei Überangebot an Strom ist die Stromspeicherung das Ziel, aber auch zur Überbrückung von mehrtägigen Zeiträumen mit geringem Angebot von Wind- und Solarstrom (Dunkelflaute). Alle bekannten Speichertechnologien haben Umwandlungsverluste und erfordern Investitionen. Technisch vielversprechende Anwendungen sind Großbatterien und die Produktion von Wasserstoff (H2). Batterien haben zwar relativ geringe Verluste, aber (noch) hohe spez. Investitionskosten.
Die Verluste bei der H2-Produktion per Elektrolyse in der Form von Abwärme liegen im deutlich zweistelligen %-Bereich. Diese Wärme sollte ebenfalls genutzt werden. H2 könnte in sehr großem Stil produziert werden, grundsätzlich überall, aber vornehmlich in Ländern mit niedrigen Stromgestehungskosten aufgrund ihres hohen Potenzials an Solar- oder Windenergie und Zugang zu (Meer-)Wasser. Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern könnte sich ein echter globaler Wettbewerb um preisgünstiges H2 entwickeln. Bei der Rückverstromung von H2 zur Deckung von Spitzen- und Residuallasten im Stromnetz sollte Kraft-Wärme-Kopplung der Standard sein. Auch die Bereitstellung von Prozesswärme auf hohem Temperaturniveau kann mit H2 realisiert werden. Zur Verteilung von H2 ist sicherlich eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur erforderlich, die nur bedingt mit dem bestehenden Erdgasnetz vereinbar ist. Denkbar ist, dass H2 über ein eigenes Transportnetz nur an größere Abnehmer (Industrie, Heiz(kraft)werke) geliefert wird. Das Erdgas-Verteilnetz könnte zugunsten von (kalten) Wärmenetzen bzw. dezentralen Wärmepumpen sukzessive stillgelegt werden.
Für den Transport über längere Strecken kommt die Umwandlung des Wasserstoffs in Ammoniak (NH3) in Frage, das leichter verflüssigt werden kann. Das bedeutet zwar weitere verlustbehaftete Prozessschritte, aber einen effektiveren Transport per Schiff und in mobilen Anwendungen.
Die direkte Speicherung von Wärme ist zwar die günstigste Speichertechnologie, jedoch aufgrund des Platzbedarfes bislang am ehesten für kurzfristige Speicherung (wenige Tage) geeignet. Die Anwendung von sehr großen Wärmespeichern (z.B. saisonale Wärmespeicher mit mehreren Tausend m3 Wasserinhalt) oder Eisspeichern ist sicher noch nicht ausgereizt. Eine praktische Anwendung erscheint insbesondere in Verbindung mit solarthermischen Großanlagen, Großwärmepumpen und Wärmenetzen oder bei sehr großen Liegenschaften mit ganzjährigem Wärme- und Kältebedarf darstellbar.
Intelligente Messeinrichtungen ermöglichen es Versorgern, zeitabhängige Stromtarife auch für mittlere und kleine Abnahmestellen anzubieten. Es ist davon auszugehen, dass davon zunehmend Gebrauch gemacht wird. Es dient dazu, Angebot und Nachfrage besser anzugleichen und die Netzstabilität zu verbessern. Eine erste Verbreitung zeichnet sich beim Laden von Elektroautos ab, im zweiten Schritt werden Wärmepumpen gezielt(er) angesteuert. Ein rein wärmegeführter Betrieb ohne Pufferspeicher wird voraussichtlich nur noch mit spürbaren Preisaufschlägen möglich sein.
Welche Technologien sich an welcher Stelle durchsetzen werden, ist noch nicht immer klar, da eine Vielzahl an nationalen und internationalen Akteuren aktiv mitwirken und sich die Technologien ständig weiterentwickeln. Die praktische Umsetzung wird aber auf staatlicher/ kommunaler Ebene entschieden. Öffentliche Gebäude tragen als Großabnehmer und Vorbild zum Gelingen bei. Letztlich erfordern aber alle genannten Szenarien eine signifikante Reduktion des Energieverbrauchs und einen bewussten Umgang mit Energie in allen Sektoren, um die Klimaschutzziele im gesteckten Zeitraum zu erreichen. Mittel und Wege hierzu sind in dieser AMEV-Empfehlung dargestellt.
2 Das Energiemanagement im Lebenszyklus von Gebäuden
2.1 Ziele und Grundsätze
Das Energiemanagement (EM) verfolgt folgende wesentliche Ziele:
- Minimierung von Umwelteinwirkungen wie Treibhausgasemissionen, Schadstoff- und Schadgasemissionen, Rückstände usw. und des Verbrauchs an Ressourcen (Primärenergie).
- Minimierung der Gesamtkosten für den Prozess der Energiebereitstellung, -verteilung und -anwendung im Gebäude bei einer definierten Nutzungsqualität.
Die Festschreibung einer bestimmten Qualität (z.B. Vorgaben der Raumtemperaturen) ist unumgänglich, da ansonsten auf einfachem Wege eine Kostenreduzierung durch eine Absenkung der maßgeblichen Qualitätsparameter erreicht werden kann, bzw. Einsparpotentiale nicht erreicht werden, wenn die Qualitätsparameter überschritten werden.
Ein konsequentes Energiemanagement greift in allen Lebenszyklusphasen der Gebäude: Der Energieverbrauch wird durch die Planung eines Gebäudes ebenso beeinflusst wie durch den späteren Betrieb und das Nutzerverhalten. Zur Verbrauchs- und Kostenminimierung ist es deshalb unabdingbar, sowohl den Betrieb und die Nutzung des Gebäudebestandes zu optimieren, als auch die Erkenntnisse hieraus in die Neubauplanung und in die Sanierung zu übertragen.
Erfahrungen in verschiedenen Verwaltungen haben gezeigt, dass durch konsequentes Energiemanagement - d.h. die Kombination investiver und nichtinvestiver Maßnahmen - Energieeinsparungen in Höhe von 20 bis 30 % zu erreichen sind; durch stetige und kompetente Betriebsüberwachung sind bereits bis zu 15 % möglich. Die für den Klimaschutz notwendigen weitergehenden Reduzierungen erfordern umfangreichere Gebäudesanierungen
Neben den Betrachtungen, die sich auf die Verbrauchsreduzierung in den Gebäuden beziehen, ist die Umstellung auf erneuerbare Energieträger voranzutreiben.
Grafik 1: Lebenszyklusphasen
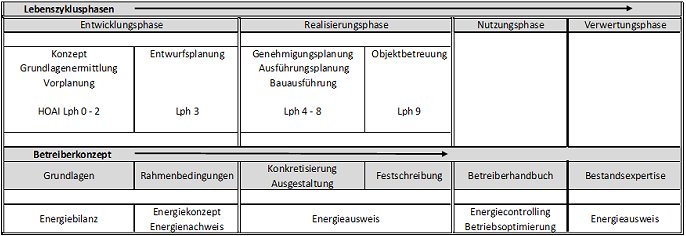
2.2 Anforderungen an die Organisation des Energiemanagements
Nachhaltige Energieeinsparungen sind nur erreichbar, wenn das Energiemanagement als strategische Aufgabe verstanden - d.h. von der Führungsebene wahrgenommen und gesteuert - und als eigener Aufgabenbereich dauerhaft durchgeführt wird. Ohne permanente Kontrolle und Korrektur in der Betriebsoptimierung gehen bereits erreichte Einsparungen wieder verloren. Zur Umsetzung sind zentrale Ansprechpartner mit spezifischen Fachkenntnissen erforderlich sowie Mitarbeiter in verschiedenen Ebenen bis zur Ansprechperson in jedem einzelnen Gebäude. Hierbei sind die Verantwortlichkeiten sowie die Organisation und die Stellenbeschreibungen eindeutig zu definieren. Energiemanagement ist als ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess der Immobilienverwaltung zu verstehen.
Um Energiemanagement wirkungsvoll in der Verwaltung zu implementieren sind wesentliche Steuerungsaufgaben auf der Leitungsebene wahrzunehmen:
- Umsetzung politischer Klimaschutzziele in konkrete Handlungsstrategie,
- Erstellung von Leitbildern im Energiemanagement, Strategie zum Erreichen der Klimaneutralität,
- Herausgabe von Zielvorgaben im Form von Kennzahlen (Energie- und Medienverbrauch, CO2-Einsparung), mit Fristen zur Zielerreichung,
- Prioritätensetzung der investiven Maßnahmen,
- Festlegung der Organisationsform,
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln,
- Bereitstellung von Personalressourcen,
- Implementierung eines Informations- und Berichtswesen mit zentralen Auswertungen und zentralen Berichten sowie Veröffentlichung auch im politischem Raum,
- Auswahl von qualifiziertem fachtechnischen Personal
- Aus- und Fortbildung des Personals im Energiemanagement.
Auf operativer Ebene sind folgende Aufgaben und Tätigkeiten im Energiemanagement wahrzunehmen:
- Erfassung und Auswertung von Energie- und Medienverbräuchen, Kennzahlenerstellung,
- Erstellung von Energieberichten, Koordination von Energieausweisen
- Einkauf von Energie und Vertragscontrolling, Prüfen von Abrechnungen,
- Betriebsüberwachung der technischen Anlagen,
- Aus- und Fortbildung des Betriebspersonals,
- Schwachstellenanalyse und Veranlassung von Optimierungsmaßnahmen,
- Durchführung von Energiekampagnen auf Liegenschafts- und Gebäudeebene, zur Motivation der Nutzenden
- Energetische Optimierung beim Planen und Bauen.
2.3 Aufgaben und Funktionen
Ein effektives Energiemanagement im Immobilienbereich erstreckt sich über die gesamten Lebenszyklusphasen (s. Grafik 1) eines Gebäudes/einer Liegenschaft. Daraus lassen sich folgende Aufgaben, Zuordnungen und Verantwortlichkeiten ableiten, nahezu unabhängig von der jeweiligen Organisationsstruktur der Bauverwaltungen. Die Rollenzuordnung zu verschiedenen Organisationseinheiten kann unterschiedlich organisiert sein, muss aber in jedem Fall verbindlich geregelt und dokumentiert werden.
Eigentümer
Der Eigentümer hat die Steuerungsaufgabe, im Rahmen seiner Eigentümer- und Betreiberfunktion sowohl Vorgaben für die Planung als auch für den Betrieb in Form von Kennzahlen zu erarbeiten. Der Eigentümer ist verantwortlich für einengesetzeskonformen Betrieb; hierzu zählt auch der ressourcenschonende Umgang mit Energien. Energiemanagement ist hierbei an zentraler Stelle in der Leitungsfunktion zu integrieren. Der Eigentümer kann Aufgaben und Verantwortung für den Betrieb weitgehend delegieren, z.B. an die Gebäudenutzer oder Dienstleister
Bauherr
Im Rahmen der Bauherrenaufgabe sind die Aufgaben des Energiemanagements in allen öffentlichen Verwaltungen zu implementieren. Hierbei muss sichergestellt sein, dass ausreichend fachlich qualifiziertes Personal mit Erfahrungen aus Betrieb und Nutzung diese Aufgabe wahrnimmt.
Planer
Um die übergeordneten Klimaschutzziele zu erreichen, sind die aus der Praxis vorliegenden energetischen Erkenntnisse sowohl im Hochbau als auch in der Technischen Gebäudeausrüstung bei Planungsleistungen zu berücksichtigen. Die Anforderungen sind in Kapitel 5 beschrieben.
Technischer Betrieb
Der ordnungsgemäße Betrieb (Bedienen, Warten, Inspektion ggf. Instandsetzung) von technischen Anlagen ist Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Energieeinsatz. Die Anforderungen sind in Abschnitt 4.3 beschrieben.
Je nach Organisationsform und Komplexität der Gebäude wird der Technische Betrieb von Ingenieuren, Gebäudetechnikern, Hausmeistern, Fachhandwerkern und Mess- und Regelungstechnikern wahrgenommen. Der Eigentümer kann die Betreiberfunktion an Dritte übertragen.
Nutzer
Die Nutzer haben - über den technischen Betrieb hinaus - großen Einfluss auf eine ökologische und ökonomische Nutzung von Wärme- und Kälteenergie sowie Strom.
Energiecontrolling
Grundbestandteile des Energiecontrollings sind das Erfassen und Auswerten von Energieverbrauchswerten und deren Kosten sowie ist ein permanenter Soll-/Ist Vergleich. Die Anforderungen sind in Kapitel 3 beschrieben.
Vertragsmanagement
Der Energie- und Medieneinkauf wurde in der Vergangenheit hauptsächlich von Personal mit Verwaltungskenntnissen wahrgenommen. Aufgrund der vielschichtigen Vertragsgestaltung, sind fachspezifische Kenntnisse des Energiemarktes unumgänglich. Die Anforderungen sind in Kapitel 4 beschrieben. Der Einkauf ist daher eine Teilaufgabe des Energiemanagements.
2.4 Organisationsformen
Für die Organisation des Energiemanagements sind unterschiedliche Formen möglich. Sie sollten sich nach dem jeweiligen Aufbau der Verwaltung ausrichten.
Grundsätzlich können dabei Teilbereiche der Aufgaben z.B. auf Energieeinspar-Contractoren oder anderen vertraglich gebundene Dienstleister ausgelagert werden.
Nachfolgend werden beispielhaft einige Strukturen dargestellt:
Bundes- und Landesverwaltungen, Betriebsüberwachung (BÜ)
In größeren öffentlichen Verwaltungen sind Betriebsüberwachungs- bzw. Energiecontrollingstellen nach entsprechenden bundes- oder länderspezifischen Richtlinien eingesetzt.
Für den operativen Betrieb sind hier in der Regel die nutzenden Verwaltungen verantwortlich. Während in großen Liegenschaften im Allgemeinen qualitativ geschultes Betriebspersonal vorgehalten wird, kann für kleinere Liegenschaften durch Digitalisierung und Bündelung die Betreiberkompetenz und damit die Energieeffizienz der Anlagen verbessert werden.
Die Aufgaben der BÜ sind die Überprüfung der Betriebsführung von technischen Anlagen (z.B. durch die baudurchführende Ebene vor Ort) und die Auswertung der objektbezogenen Energie- und Medienverbräuche (z.B. durch eine zentrale Leitstelle). Des Weiteren überprüft sie die Betriebskosten und berät die Betreiber bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. In der Praxis haben sich Überwachungsstellen bewährt, die auch befugt sind, Weisungen zu erteilen.
In einigen Bundesländern wurden Landesbetriebe eingerichtet, die die Gebäude errichten und anschließend auch betreiben, womit die Energieeffizienz und deren Betriebsoptimierung unmittelbar mit dem Bauen gekoppelt werden.
Kommunales Energiemanagement
Im kommunalen Bereich stellt das Energiemanagement eine Querschnittsaufgabe zwischen den einzelnen Gebieten dar: Gebäudemanagement, Hochbau, Umwelt, Finanzen und Gebäudenutzer. Es kann einzelnen zentralen Fachbereichen / Dienststellen z.B. dem Gebäudemanagement, dem Hochbauamt oder dem Amt für Umweltschutz zugeordnet werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass die zentrale Stelle auf alle Aufgaben - Gebäudegestaltung, Bauphysik, technische Gebäudeausrüstung, Betrieb, Gebäudenutzung und Energieeinkauf - Einfluss nehmen kann. Je nach Größe der Kommune sind eigene Organisationseinheiten in Form eines Dienstpostens, eines Sachgebietes oder einer Abteilung zu bilden.
In vielen Kommunen haben sich integrierte Immobilienwirtschaftsbetriebe (in unterschiedlicher Rechtsform) entwickelt. Hier empfiehlt sich auch die Anordnung des Energiemanagements. Dies kann komplett in einer Abteilung (Linienorganisation) geschehen, oder die strategischen Aufgaben werden in einer Stabsstelle konzentriert, das operative EM in den Fachabteilungen wahrgenommen. Vorteilhaft ist hierbei, dass die vom Tagesgeschäft gelöste Auftragserfüllung mit direktem Zugang zu allen Fachbereichen eine sorgfältige Auftragserfüllung geben kann, sofern entsprechendes Weisungsrecht gegeben ist.
Grafik 2: Beispiel Energiemanagement im Immobilienwirtschaftsbetrieb als Linienorganisation
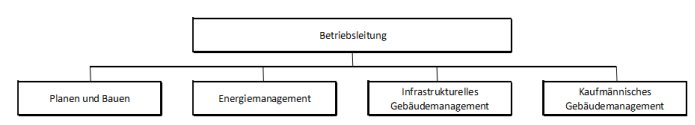
Grafik 3: Beispiel Energiemanagement im kommunalen Immobilienwirtschaftsbetrieb als Stabsstelle
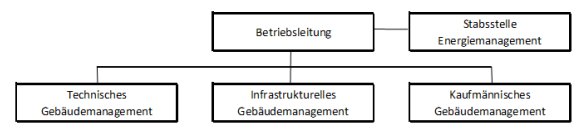
2.5 Qualifikation des Personals
Besonderer Wert ist auf den Einsatz qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen genannten Beteiligten zu legen, die eigenverantwortlich ihre Aufgaben wahrnehmen. Sie müssen über die dafür notwendigen fachlichen Fähigkeiten und Neigungen verfügen, eine stetige Fortbildung ist dabei zu gewährleisten.
Wird die Aufgabe als Stabstelle wahrgenommen, sind zusätzliche Qualifikationen wie Durchsetzungsfähigkeit, konzeptionelles Denken und Eigeninitiative zu fordern.
Je nach Verwaltungsaufbau und Hierarchieebene ist mindestens die Leitungs- und Steuerungsebene im Bereich Energiemanagement mit der Qualifikation Dipl.-Ingenieur oder Master / Bachelor (Versorgungstechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Facility Management, Hochbau) zu besetzen.
Eine bedeutende Herausforderung ist die Gewinnung qualifizierten Personals, selbst wenn Stellen freigegeben sind. Mögliche Gegenstrategien sind u.a.
- eigene Ausbildung: z.B. Referendariat, duales Studium
- Angebot zur systematischen Fort- und Weiterbildung innerhalb des bestehenden Personals
- durch Flexibilität in der Qualifikationsanforderung der Stellenausschreibung einen größeren Bewerberkreis zu generieren
- Anreize für eine dauerhafte Bindung durch attraktive Arbeitsbedingungen und unbefristete Arbeitsverhältnisse schaffen
3 Energiecontrolling
3.1 Grundlagen des Energiecontrollings
Das Energiecontrolling bildet die Grundlage für ein umfassendes Energiemanagement. Ziel ist das Aufdecken von vermeidbaren Energieverlusten, technischen und organisatorischen Schwachstellen im Gebäudebetrieb (z.B. fehlerhafte, ungeeignete oder nicht richtig eingestellte Anlagentechnik, Wärmedämmung, Leckagen etc.). Die ermittelten Daten erleichtern die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von energiesparenden Maßnahmen.
Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) Gesetz beinhaltet u.a. für die Öffentliche Hand (Bund, Länder und Kommunen) Verpflichtungen zur Reduzierung des Primär- und Endenergieverbrauchs und dazu Verpflichtungen zur Berichterstattung zur Zielerreichung. Insofern lässt sich aus dem EnEfG eine Verpflichtung zur Verbrauchserfassung ableiten. In diesem Gesetz gibt es auch für öffentliche Stellen, die einen bestimmten Energieverbrauch überschreiten, Vorgaben zur Einrichtung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG, § 71a) fordert die Ausstattung mit digitaler Energieüberwachungstechnik für Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung der Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage von mehr als 290 kW (siehe Abschnitt 6.4)
Energiecontrolling beinhaltet die aktive Erfassung und Analyse von energierelevanten Informationen. Verbrauchswerte sind auf Veränderungen hin zu untersuchen und die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Für den Aufbau eines Energiecontrollings ist geeignetes Fachpersonal erforderlich, das eine kontinuierliche Fortführung der Aufgaben gewährleisten kann. Ein wichtiger Bestandteil ist ein fortlaufendes Berichtswesen.
Energiecontrolling ist erfahrungsgemäß eine Daueraufgabe. Erzielte Einsparungen können nur aufrechterhalten werden, wenn das Controlling dauerhaft fortgeführt wird.
Die Erfassung von Gebäude- und Anlagenstammdaten kann für das Energiecontrolling auf ein notwendiges Maß beschränkt werden. Mindestens erforderlich sind folgende Basisdaten:
- Gebäudebezeichnung und Adresse
- Gebäude-Identifikationsnummer / -Schlüssel / Wirtschaftseinheit
- Bauwerkszuordnung / Nutzungsart (z.B. Polizeirevier im 24/7 Betrieb)
- Baujahr und letzte energierelevante Sanierung
- Flächen in einheitlicher Definition (NGF, ersatzweise BGF in m2)
- Bezogene Medienarten (z.B. Erdgas, Fernwärme, Pellets, ...)
- Anschlusswerte (kWel / kWth)
- Übersicht der technischen Anlagen mit bedeutsamem Anteil am Energie- bzw. Medienverbrauch (z.B. RLT-Anlagen, Kälte, PV-Anlage, BHKW, ...)
- Ansprechpartner für den Gebäudebetrieb vor Ort
Um energetische Bewertungen gezielt durchführen zu können sind zu analysieren:
- Energie- und Wasserverbrauch
- Energie- und Medienbezugskosten
- Betriebsaufzeichnungen der technischen Anlagen (Laufzeiten, Leistungen/ Leistungsspitzen..).
- Informationen zur Nutzung (z.B. 24/7-Betrieb bei der Polizei)
Die alleinige Auswertung von Jahresverbräuchen ist die Minimallösung und kommt nur für Gebäude von untergeordneter Bedeutung in Betracht. In der Regel hat sich die mindestens monatliche Erfassung der Verbrauchsdaten als zweckmäßig erwiesen. Kürzere Intervalle (wöchentlich, täglich bis stündlich) sind im zweiten Schritt geeignet, um Störungen und Fehlbetriebsweisen einzelner Anlagen zu identifizieren Je höher die Messauflösung, desto eher sollte hier auf eine automatisierte Erfassung geachtet werden.
Für eine weitergehende Betrachtung und insbesondere für eine vergleichende Bewertung des Gebäudebestands ist die Bildung von spez. Kennwerten erforderlich. Hierfür sind dann die o.g. Basisdaten erforderlich. Zu den Kennwerten lassen sich auch Vergleichswerte als Orientierung festlegen (siehe Abschnitt 3.3.3).
Für längerfristige Analysen und Betrachtungen sind die benötigten Daten in geeigneten Datenbanken (z.B. CAFM-System) zu erfassen und grafisch auszuwerten (siehe Abschnitt 3.3)
3.2 Verbrauchsdatenerfassung
3.2.1 Zähler und Informationsübertragung
Für die Verbrauchserfassung werden zunächst die Zähler der Energieversorgungsunternehmen (EVU) verwendet. Für nicht leitungsgebundenen Endenergieträger und Eigenerzeugung sind eigene Messeinrichtungen notwendig, z.B. Wärmemengenzähler für Wärmeerzeugung aus Pellets / Hackschnitzel, Stromzähler für PV und BHKW).
In größeren Liegenschaften sind darüber hinaus Unterzähler notwendig. Die Entscheidung, welche Gebäude und technischen Anlagen mit eigenen Unterzählern (Strom, Wärme, Kälte, Wasser) auszustatten sind, ist nicht pauschal zu beantworten. Eine gebäudeweise Erfassung ist nicht immer zielführend und verhältnismäßig. Leitwerte sind Kosten und zu erwartender Nutzen. Hierzu sind eigene Kriterien zu entwickeln um die Zählerinfrastruktur aufzubauen. Solch ein Zählerkonzept erfasst wesentliche Energie-/Medienströme um den Wirkungs-/Nutzungsgrad techn. Anlagen zu ermitteln, kann aber auch zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten (z.B. EEG, KWKG) oder Nebenkostenabrechnungen dienen. Bei Wärmepumpen und KWK-Anlagen sollten immer sowohl die Primär- als auch die Sekundärseite gemessen werden. Weitere Hinweise gibt die AMEV-Empfehlung Technisches Monitoring.
Für interne Auswertungen und Verrechnungen reichen nicht geeichte Zähler.
Auch moderne Heizungsumwälzpumpen können (nicht geeichte), aber relativ präzise Verbrauchswerte liefern.
Für Verrechnungen mit Dritten sind aus rechtlichen Gründen geeichte Zähler vorzusehen.
Eine wichtige Rolle im Hinblick auf den Aufwand der Datenerfassung spielt die Art der Ablesung.
Folgende Möglichkeiten bestehen:
|
Erfassungsmethode |
Vorteile |
Nachteile |
| Rechnungsauswertung Anstelle von Zählern werden die vom EVU erfassten Zählerstände/Verbräuche verwendet | Geringe Kosten, kein Aufwand manueller Ablesungen | Oft nur jährliche Daten mit geringer Kontrollmöglichkeit. Kosten oder Schäden durch unentdeckte Mehrverbräuche fallen spät auf. Zählerstände vom EVU sind teilw. rechnerisch ermittelt |
| Manuelle Ablesung (handschriftliche Listen) | Geringe investive Kosten | Zeitaufwand für die Übertragung in eine Datenbank, Anfällig für Ablese-/Übertragungsfehlern |
| Manuelle Ablesung (Weitergabe per Web-Portal) | Geringe Kosten, keine zusätzlichen Installationen/Kabelzüge erforderlich, Ablesungen können mit Inspektionsgang verbunden werden | Ablesefehler möglich, Zeitaufwand, Auslesung elektronischer Zähler nicht immer intuitiv möglich (Menüebenen) |
| Manuelle Ablesung (mit Unterstützung von Tablet/Smartphone) | Wie beim vorangegangenen Punkt, zusätzlich: Plausibilitätsprüfung und Fehlerkorrektur vor Ort möglich (Software), Einlesen der Daten in Auswertesystem reduziert Fehlerquellen | Ablesefehler trotzdem möglich, mittlerer Personalaufwand, höhere Personalqualifikation, Beschaffung geeigneter Hard- und Software |
| Gebäudeautomation (z.B. Impulsauswertung über S0-Schnittstelle) | Entfall händischer Ablesungen, Erfassung von Zählerständen in hoher Auflösung (z.B. 1/4-stündlich) | GA-Systemanbieter erforderlich, eingeschränkte Eichfähigkeit, Messungenauigkeiten |
| Digitale Zähler mit Schnittstelle (z.B. M-Bus) | Wie beim vorherigen Punkt, zusätzlich: Übertragung von Zählwerten über den Datenbus, Eichfähigkeit, kein Datenverlust bei Stromausfall, Schnittstellen zu GA- Systemen ermöglichen hohe Flexibilität, Auslesen weiterer Daten (z.B. Temperatur, Spannung) möglich | Nennenswerte Zählerkosten, i.d.R. Verkabelung (Datenkabel sowie Spannungsversorgung) erforderlich (Funk-Systeme nur begrenzt einsetzbar), ggf. regelmäßiger Batteriewechsel, erneute Parametrierung beim Zählerwechsel |
| Datenaustausch (mit Energielieferanten und Messdienstleistern) | Soweit die Daten dort in ausreichenden Messintervallen vorliegen (z.B. 1/4h-Werte für Strom und 1h-Werte für Erdgas bei Abnahmestellen mit Lastgangmessung/RLM) und Struktur sowie Inhalt zur Verfügung gestellt werden, lässt sich der Erfassungsauf- wand reduzieren | Nur bei EVU-Zähler möglich, nicht bei kundeneigenen Unterzählern. Bei Letzteren sind Fremdvergaben möglich (z.B. bei der Ermittlung des Wärmeverbrauchs im Wohnungswesen üblich). In allen Fällen müssen die Zählerstände/Lastgänge manuell abgerufen (z.B. Kundenportal) und weiterverarbeitet (z.B. Excel) werden |
| Mobile Datenlogger | Differenzierte, detaillierte Messung kritischer Größen möglich (z.B. Raumtemperaturen), geringer Installations- aufwand | Keine kontinuierliche Verbrauchserfassung, Aufwand zur Auslesung, regelmäßiger Batteriewechsel notwendig, nicht eichfähig. Nur zur ergänzenden Untersuchung im Rahmen umfangreicherer Analysen oder bei lokal begrenzten Störungen geeignet, keine Dauerlösung |
EVU-Zähler bieten oft Schnittstellen (Impuls oder MBUS) zum Anschluss an die Gebäudeautomation oder ein Bus-System. Neuere Modelle nutzen das TCP/IP Protokoll oder SMART Meter die CLS Schnittstelle. Die jeweiligen IT-technischen Sicherheitsanforderungen sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit und etwaige Zusatzgebühren werden von den EVU unterschiedlich gehandhabt. Künftig müssen zunehmend intelligente Messsysteme (Smart-Meter) für Strom-, Erdgas und Fernwärme verbaut werden, die dem Versorger und per Web-Portal auch dem Kunden hoch aufgelöste Zählerstände zur Verfügung stellen. An die Übertragungssysteme sind hohe Datensicherheitsanforderungen gestellt, sodass Stand 2023 noch eine geringe Verbreitung praktiziert ist. Derzeit ist nicht absehbar, inwiefern Kunden/ Verwaltungen direkt und standardisiert auf die Messdaten zugreifen können.
Unabhängig von der Art der Verbrauchserfassung werden für jeden Verbrauchsdatensatz folgende Basis-Informationen als Mindestanforderung benötigt:
- Zuordnung zum Gebäude
- Ggf. Zuordnung Nutzungseinheit
- Medium (Gas, Wärme, Strom, Wasser, ...)
- Zähler-ID
- Zählerstände mit Ablesezeitpunkt (Uhrzeit/Datum)
- Bei Messwandlerzählern (Strom): Wandlerfaktor
In allen Fällen ist empfehlenswert, die erfassten Daten mit den Abrechnungen der Energielieferanten abzugleichen und bei Unstimmigkeiten aktiv zu werden. Lieferanten verwenden oft noch manuelle Methoden (Ablesekarten) und/oder ermitteln die Zählerstände zum Jahreswechsel rechnerisch.
3.2.2 Datenverarbeitung
Die Auswertung von Verbrauchs- und Kostendaten kann im einfachsten Fall mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. MS Excel) erfolgen. Allerdings ist der Aufwand für die Verwaltung größerer Datenmengen hoch. Leistungsfähiger sind datenbankbasierte Systeme. Die Verwendung von Excel für Auswertungen (z.B. für die Erstellung von Diagrammen) ist dabei weiterhin möglich.
Für das Energiecontrolling ist zunehmend Software erhältlich, die auf Datenbanksystemen basieren und vorgegebene Eingabe- und Auswertungsfunktionen bieten. Diese bieten unterschiedliche Möglichkeiten der Erfassung von Verbrauchsdaten (z.B. manuelle Zählerstandseingabe, Einlesen von Erfassungsbögen, Eingabe über ein Webportal, Import von Versorgerdaten/Lastgängen etc.). Bei der Auswahl der Software ist also darauf zu achten, dass die beabsichtigten Wege der Verbrauchserfassung unterstützt wird.
Daten und Informationen über den Energie- und Medienbereich einer Immobilie / Liegenschaft werden für eine Reihe vielschichtiger Aufgaben (z.B. Planen, Bauen, Kontrolle, Öffentlichkeitsarbeit, Politik) sowohl an örtlicher als auch an zentraler Stelle benötigt. Für einen Kennzahlenvergleich (Bund, Land oder Kommune) von Medien- und Energieverbräuchen ist eine gebäudetypische Auswertung vorzunehmen. Deshalb sind folgende Schnittstellen zu beachten:
- Flächenmanagement: Die für die Bildung von Energiekennzahlen zwingend erforderlichen zuverlässigen Flächendaten werden in diversen anderen Bereichen des Gebäudemanagements verarbeitet.
- Technisches Gebäudemanagement: Technische Informationen - z.B. Baujahr und Bauart des Gebäudes, Daten von Wärmerzeugungsanlagen - sind für die Bewertung der Verbrauchsdaten ebenso hilfreich wie für die Bauunterhaltung.
- Kaufmännisches Gebäudemanagement: Energierechnungsdaten sind für das Energiecontrolling hilfreich, die Verbrauchsdaten können auch zur Haushaltsplanung und Nebenkostenabrechnung verwendet werden.
- Baumanagement: Benchmarks aus den Verbrauchsdaten sind bei der Prioritätensetzung von Sanierungsprogrammen zu beachten (s. Abschnitt 3.3.3).
Eine Reihe von Software-Programmen für das Facility Management beinhaltet ebenfalls Funktionalitäten des Energiemanagements. Hier ist allerdings vor dem Einsatz zu prüfen, ob die gebotenen Funktionalitäten den eigenen Ansprüchen genügen. Etwaige Schnittstellen von Gebäudeautomationssystemen zu Energiemanagement- und CAFM-Systemen sind genau zu definieren, zu planen und auf herstellerübergreifende Standards zu achten.
3.3 Auswertung der Verbrauchsdaten, Benchmarking
3.3.1 Datengrundlage
Zur Auswertung sind zunächst die Systemgrenzen festzulegen. Liegenschaften bestehen oft aus mehreren Gebäuden unterschiedlicher Bauweise oder Nutzung mit gemeinsam genutzten Versorgungsanlagen (Heizung, Strom, Wasser). Sofern die Gebäude einzeln bewertet werden sollen, sind Unterzähler erforderlich. In der Praxis ist das aber nicht immer flächendeckend möglich oder wirtschaftlich vertretbar. Sofern die Nutzungsweise und die Basisdaten (Baujahr, Anlagen, Gebäudezustand etc.) einheitlich sind, kann die Betrachtung einer ganzen Liegenschaft ausreichen. Im Übrigen ist eine Verbrauchsaufteilung z.B. nach den Gebäudeflächen oder Nutzeranzahl möglich. Bei Gebäuden unterschiedlicher Nutzungsart und Bauweise ist die rechnerische Verbrauchszuordnung fehleranfällig und nur eine grobe Näherung. In jedem Fall ist die vorhandene Zähler- und Verbrauchstopologie zu dokumentieren und fortzuschreiben.
Grafik 5: Beispiel Bilanzierungsgrenzen Liegenschaft

Bei Stromzählern mit Wandlermessung muss der Zählerstand mit dem Wandlerfaktor multipliziert werden, um den Verbrauch (kWh) zu erhalten.
Wasserzähler in großen Liegenschaften sind häufig Kombizähler. Diese bestehen aus zwei Zählwerken, einem für große Volumenströme und einem für kleine. Der Verbrauch ergibt sich aus der Aufsummierung.
Die Endenergieströme für Wärme sollten in die Einheit kWh oder MWh umgerechnet werden. Der Tabelle in Anhang B1 können die Heizwerte entnommen werden. In der Regel ist der Heizwert Hi zu verwenden. Bei manchen Brennstoffen kann auch der Brennwert Hs genutzt werden, sofern Brennwert-Wärmetauscher in Betrieb sind. In der Abrechnung des Erdgases durch die EVU wird der Brennwert angesetzt.
Der Heizenergieverbrauch unterliegt Witterungseinflüssen. Um mehrere Jahre zu vergleichen muss der ermittelte Jahresverbrauch zuerst witterungsbereinigt werden. Diese Bereinigung erfolgt über den Quotienten aus den Gradtagen des langjährigen Mittels und den aufsummierten Gradtagen des Erfassungszeitraumes (siehe VDI- Richtlinie 3807/Blatt 1). Die Gradtagzahl eignet sich auch, um eine Vergleichbarkeit der Werte von Gebäuden mit weiter entfernten Standorten zu ermöglichen. Als Referenzwert für Deutschland wird der langjährige Mittelwert von Potsdam verwendet (derzeit ist GTZm (20/15) = 3.731 K*d).
Die Gradtagzahlen für den jeweiligen Ort und Betrachtungszeitraum lassen sich u.a. unter der Website des Deutschen Wetterdienstes abrufen (jeweils mit zwei bis drei Monaten Verzögerung) oder beim Institut für Wohnen und Umwelt 1 . Eine jahresbezogene Bereinigung ist auch über die Tabellen zum GEG möglich.
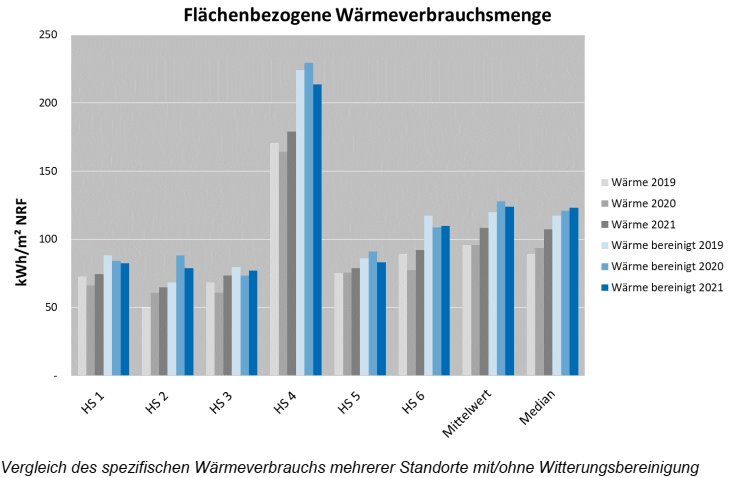
Als Bezugszeitraum der Energie- und Wasserverbräuche wird ein volles Kalenderjahr empfohlen. Für genauere Analysen sind Monatswerte oder Lastprofile (h oder 1/4-h Werte) zu empfehlen.
3.3.2 Bezugsgrößen für Kennwerte
Für viele Auswertungen ist die Bildung von Energieverbrauchskennwerten notwendig. In den meisten Fällen werden dafür die Flächendefinitionen nach DIN 277 verwendet:
- Nutzungsfläche 1 bis 6 (früher Hauptnutzfläche - HNF)
- Nutzungsfläche 1 bis 7 (Nutzfläche - NF)
- Netto-Raumfläche- NRF (früher Nettogrundfläche - NGF)
- Bruttogrundfläche (BGF)
- Bruttorauminhalt (BRI).
Bei der Auswahl der Basisdaten spielt die Art der geplanten Auswertung eine Rolle. Die konditionierte NRF ist als Basisgröße für Kennwerte bei der Erstellung von Energieausweisen festgelegt worden. Sie sollte daher bevorzugt berücksichtigt werden. Für die HNF liegen insbesondere aus der Vergangenheit Daten vor. Sie ist als Planungsgröße von Bedeutung und berücksichtigt ausschließlich die für die eigentliche Nutzung erforderliche Fläche. Sind nur interne Auswertungen einzelner Gebäude einer Liegenschaft bzw. eines Verantwortungsbereichs auszuwerten, so kann auch die beheizte Fläche oder die Zahl der Beschäftigten sinnvoll sein.
Die Ermittlung von zu erwartenden Wasserverbräuchen ist sinnvoll nur über Personenzahlen möglich. Aber auch hier kann ein flächenspezifischer Wert hilfreich sein, wenn Gebäude gleicher Nutzungsart - d.h. mit ähnlicher flächenspezifischen Belegung - miteinander zu vergleichen sind.
Für besondere Verbraucher - bei denen die Raumbeheizung weniger im Vordergrund steht - sind andere Bezugsgrößen sinnvoll, so beispielsweise bei Krankenhäuser die Bettenzahl/ Anzahl Patienten, bei Bädern die Beckenwasserfläche oder bei Museen die Ausstellungsfläche.
3.3.3 Vergleichskennwerte
Um die Energieverbrauchskennwerte beurteilen und mögliche Einsparungen abschätzen zu können, werden Vergleichswerte (Benchmarks) benötigt. Die Ermittlung von Benchmarks mit allgemeingültigen Aussagen ist nicht einfach, da die Verbräuche von vielen Einflussgrößen abhängig sind wie:
- Bauweise (U-Werte, Gebäudedichtigkeit, ...)
- TGA (Lüftungs-/Klimaanlagen, Wärmeerzeugung, Beleuchtung, ...)
- Klima/Witterung (Temperatur, Wind, Sonneneinstrahlung, ...),
- Nutzungsart (Nutzungszeiten, Personenzahl, Innere Lasten, ...)
Trotz Diskrepanzen sind Orientierungsdaten zur Bewertung des Verbrauchs erforderlich.
Diese sollten innerhalb jeder Verwaltung für einen Anwendungsbereich bewusst gewählt werden und möglichst einfach zu handhaben sein.
Nachfolgend eine Auswahl unterschiedlicher Methoden:
|
Benchmark-Methode |
Vorteile |
Nachteile |
| Vorjahreswerte aus den vorangegangen Jahren des Gebäudes (zur kontinuierlichen Überprüfung eines Gebäudes). | Einfach zu ermitteln (da grundsätzlich bekannt), berücksichtigt gebäudespezifische Besonderheiten, lässt betriebstechnische Störungen erkennen. | Grundsätzliche Gebäudetechnische Schwachstellen werden nicht erkennt. |
| Spezifische Kennwerte für Gebäudearten wie z.B. Grundschulen (zum direkten Vergleich mit gleichwertigen Gebäuden). | Mäßiger Berechnungsaufwand, nutzungsspezifische Besonderheiten können berücksichtigt werden, gebäudetechnische Schwachstellen oder dauerhaft ungünstig hohe Verbräuche sind erkennbar. | Einheitliche Bezugsgrößen erforderlich; besondere Rahmenbedingungen einzelner Gebäude werden nicht erfasst. |
| Literaturwerte z.B. aus den von der Bundesregierung bekanntgemachten Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte (zur energietechnischen Untersuchung von Liegenschaften, Entscheidungsgrundlage von hochinvestiven Maßnahmen, Abgleich von Bedarfs- und Verbrauchswerten). | Wenig Aufwand, sofern Datenbasis vergleichbar (Rest wie vorstehend). | Einheitlicher Flächenbezug erforderlich, andernfalls Umrechnungen notwendig. |
| Theoretische Berechnung wie Energiebedarfswerte nach DIN V 18599 bis hin zur dynamischen Gebäudesimulation (zur energietechnischen Untersuchung im Rahmen von Energiekonzepten, Entscheidungsgrundlage für hochinvestive Optimierungsmaßnahmen). | Umfassende und genaue Erfassung aller Einflussfaktoren, sowohl gebäudetechnische wie nutzungsspezifische Schwachstellen werden erkennbar. Durch Variantenrechnungen sind Einsparpotentiale quantifizierbar. | Hoher Aufwand, vor allem für die Datenerfassung. |
| Berechnung über Leistungswerte, z.B. Vollbenutzungsstunden, Gleichzeitigkeitsfaktoren und Benutzungsstunden (zur Bemessung von Netzanschlüssen bei Neubauten, Regressionsanalyse aus Monatswerten/ Lastgängen). | Grundsätzlich bekannt, da bei der Planung von Gebäuden die Leistungswerte (Netzanschluss) ohnehin zu berechnen sind. | Mitunter erhebliche Abweichung vom späteren Ist-Verbrauch; im Gebäudebestand fehlt oft die Datenbasis. |
Bei auffälliger, dauerhafter Diskrepanz zwischen Verbrauchs- und Vergleichswert sind Maßnahmen nach Abschnitt 5 oder 6 erforderlich.
Grafik 6: Beispielhafte Auswertung eines Liegenschaftsbestandes, Portfolio-Analyse
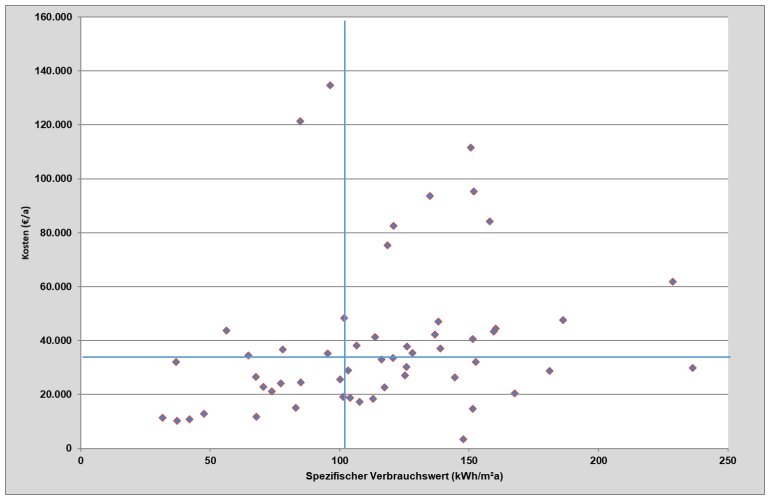
Auswertungsbeispiel: Absolute Energiekosten [Euro/a] gegenüber Kennzahl Wärme [kWh/m2a] zur Prioritätensetzung vertiefter energetischer Untersuchungen:
- Liegenschaften im 1. Quadranten (oben rechts) sind als erstes genauer zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist auf Grund der hohen Kennzahl und des gleichzeitig vorhandenen großen Verbrauchs ein insgesamt hohes absolutes Einsparpotenzial zu erwarten.
- Liegenschaften im 2. Quadranten (unten rechts) sind als zweites zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist auf Grund der hohen Kennzahl ein hohes relatives Einsparpotenzial zu erwarten.
- Liegenschaften im 4. Quadranten (oben links) sind danach zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist aufgrund des hohen absoluten Verbrauchs ein nennenswertes Einsparpotenzial möglich.
- Liegenschaften im 3. Quadranten sind in der Priorität nachrangig weiter zu untersuchen. Bei diesen Gebäuden ist aufgrund des niedrigen Verbrauchs und der gleichzeitig niedrigen Kennzahl kein nennenswertes Einsparpotenzial zu erwarten.
3.4 Information und Berichte
3.4.1 Information der Nutzer
Um dauerhaft Erfolge bei der Reduzierung des Energieverbrauchs zu erreichen, ist eine zeitnahe Rückmeldung der Ergebnisse an die Nutzer erforderlich. Diese beeinflussen den Energieverbrauch maßgeblich. Hierzu bietet sich eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten an. Das schnellste Medium ist die Online-Visualisierung, Informationen zur Verbrauchsauswertung können auch per E-Mail versendet werden (Newsletter). Der Inhalt sollte kurz und auf die wichtigsten Daten beschränken sein. Energie- und Wasserverbräuche sowie Kosten sollten grafisch als Trends (mind. drei Kalenderjahre) dargestellt werden. Weitere Tipps zum Energiesparen runden die Information ab. Auch turnusmäßige "Energie-Gespräche" mit den Nutzern zur Erläuterung der Entwicklung haben sich bewährt.
3.4.2 Energieausweise für öffentliche Gebäude
Gemäß GEG sind in öffentlichen Gebäuden mit mehr als 250 m2 Nutzfläche, in denen Behörden und sonstige Einrichtungen für eine große Anzahl von Menschen öffentliche Dienstleistungen erbringen, Energieausweise öffentlich auszuhängen. Der Energieausweis dokumentiert die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes und beurteilt den Strom- und Wärmebedarf/-Verbrauch. Bei der Darstellung des Energieausweises unterscheidet man zwischen Energieverbrauchs- und Bedarfsausweis.
Energieverbrauchsausweis
Der Verbrauchsausweis wird auf der Basis des gemessenen Endenergieverbrauchs gebildet. Als Grundlagen dienen die Energieverbräuche der letzten drei Jahre. Die Witterungsbereinigung der Heizenergie erfolgt auf das langjährige Mittel von Potsdam. Die Bezugsgröße ist die konditionierte NRF des betrachteten Objektes. Den ermittelten spezifischen Energieverbrauchskennwerten für Wärme und Strom werden Vergleichswerten gegenübergestellt. Für Liegenschaften mit mehreren Gebäuden und einer Verbrauchsmessung kann ein gemeinsamer Energieausweis gebildet werden.
Bei bestehendem Energiecontrolling können die Verbrauchsausweise mit relativ geringem Aufwand über eine EM-Software erzeugt werden. Das Nähere regelt die "Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand" des Bundeswirtschaftsministeriums.
Außerdem hat der Energieverbrauchsausweis den Vorteil, dass die wichtigen Bereiche der Betriebsführung und des Nutzerverhaltens mit erfasst werden. Hier gibt es gerade im kommunalen Bereich ein hohes Einsparpotential.
Über Verbrauchsausweise können also mit begrenztem Aufwand die Gebäude mit besonderem Handlungsbedarf identifiziert werden. Sie zeigen allerdings nicht konkrete Schwachstellen bzw. Ursachen von erhöhten Verbräuchen auf.
Energiebedarfsausweis
Der Energiebedarfsausweis wird nach den Regeln der DIN V 18599 erstellt. Hierzu werden alle Energieströme eines Gebäudes unter Berücksichtigung der betriebstechnischen Anlagen errechnet und bilanziert. Bilanzgrenze ist die Gebäudehüllfläche. Dabei wird die Energiebereitstellung, -umwandlung, -verteilung, Nutzenübergabe und eine Standardnutzungsstruktur berücksichtigt. Über Faktoren wird der Primärenergiebedarf errechnet, um die Vorkette von Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie abzubilden.
Bedarfsausweise sind für Genehmigungsverfahren notwendig. In der Praxis können vor allem das Nutzerverhalten, aber auch die tatsächliche Ausführung in der Bauphase von den
Annahmen der Bilanzierungsrechnung abweichen. Zudem beinhaltet das Berechnungsverfahren nach DIN V 18599 Spielräume in der Wahl von Annahmen. Die Erfahrung zeigt, dass der in der Praxis erfasste Verbrauch eines Gebäudes von den ermittelten Werten des Bedarfsausweises spürbar abweicht.
Für den Gebäudebestand bedeutet die Erstellung von Bedarfsausweisen einen sehr hohen Berechnungsaufwand. Da zudem der Aufbau und die Qualität von Bauteilen im Nachhinein nicht immer sicher festzustellen ist, ist die Aussagekraft nochmals gemindert. Für den Einsatz im Gebäudebestand wird deshalb der Energieverbrauchsausweis als zweckmäßiger bewertet, da er auf tatsächlichen Verbrauchswerten basiert und die Realität abbildet (Diskrepanz zwischen "Theorie" und "Praxis").
Bei der Planung von Sanierungsprojekten, die auf jeden Fall eine umfangreiche
Bestandsaufnahme erfordert, können über das Berechnungsverfahren nach DIN V 18599
Einflussfaktoren auf den Verbrauch, Schwachstellen und Einsparpotentiale quantifiziert werden.
(Siehe auch Abschnitt 3.3.3 und Abschnitt 6.4)
3.4.3 Energieberichte
Der Energiebericht ist ein Tätigkeitsnachweis des Energiemanagements. Er ist ein eher längerfristiges Instrument mit folgendem Inhalt:
- Energiepolitische Rahmenbedingungen (z.B. Zielvereinbarungen zur CO2 - Reduktion),
- Durchgeführte Aktivitäten und Maßnahmen im Energiemanagement,
- Finanzierungssituation und -instrumente,
- Statistik der Energie- und Wasserverbräuche mit Kosten und Emissionen,
- Statistik der Energieerzeugung,
- Praxisbeispiele mit Erfolgsnachweisen (ausgewählte Gebäude).
Die Zielgruppen der Energieberichte sind die politische Ebene (Landtag, Kreistag, Gemeinderat), Landesregierung und Ministerien, Landrat und Bürgermeister, Nutzer und Betreiber der Gebäude sowie interessierte Dritte wie andere Verwaltungen, Forschungsinstitute und Medien.
Der Detaillierungsgrad ist für die jeweilige Zielgruppe aufzubereiten. Hilfreich bei der Darstellung von Statistiken sind Diagramme, wie das Musterbeispiel unten für Verbrauchskennwerte.
Energie- und Wasserverbräuche mit den zusammenhängenden Kosten können als absolute und spezifische Werte (Flächenbezug) dargestellt werden. Die Daten können gegliedert werden nach Gebäudegruppen wie Verwaltungsgebäude, Schulen etc., oder nach Organisationseinheiten. Exemplarisch kann die Entwicklung für ausgewählte Gebäude dargestellt werden. In der Bilanz ist die Veränderung der Energie- und Wasserverbräuche im Vergleich zu einem Basis- oder Vorjahr gegenübergestellt 2.
Entwicklung des Wärmeverbrauchs mehrerer Standorte

4. Energiebeschaffung
4.1 Grundlagen
Neben der Begrenzung des Energieverbrauchs erschließt der sachgerechte Einkauf wesentliche Potentiale zur Optimierung der Energiekosten. Die leitungsgebundenen Energien machen den Hauptanteil aus, wobei Strom als teuerste Energie einen gegenüber seinem Verbrauchsanteil wesentlich höheren Kostenanteil hat.
Mit dem gezielten Einkauf ökologischer Produkte kann zudem die Dekarbonisierung der Energieversorgung unterstützt werden.
Nach der zunächst unübersichtlichen Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes haben sich mit der etablierten Regulierung des Netzbetriebes die Rahmenbedingungen weitgehend geklärt, so dass ein funktionierender Wettbewerb der Energielieferanten genutzt werden kann. Das Zusammenfassen von Verbrauchsstellen kann die Marktmacht steigern und die Preise deutlich senken. Dabei sind nach wie vor die Anforderungen des öffentlichen Vergaberechts und die Bedingungen des Energiemarktes nicht ganz leicht zur Deckung zu bringen.
4.2 Rechtlicher Rahmen des Energiemarktes
Der Netzbetrieb gestaltet sich als natürliches Monopol, für das der Endverbraucher keine Wahlfreiheit hat. Nach dem Energiewirtschaftsgesetzt EnWG haben die Netzbetreiber ihre Leitungsnetze diskriminierungsfrei für die Durchleitungen zur Verfügung zu stellen. Deshalb müssen die Netzbetreiber organisatorisch und wirtschaftliche von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung - d.h. Energieerzeugung und -lieferung - getrennt sein. Die Entgelte für die Netznutzung sind von der Bundesnetzagentur genehmigen zu lassen und zu veröffentlichen.
Durch die Trennung von Netzbetrieb und Lieferung von Strom und Gas wird im Grundsatz der Abschluss mehrere Verträge zur Sicherstellung des Energiebezugs notwendig:
- Der Netzanschlussvertrag regelt die Details der Errichtung und des Gebrauchs des unmittelbaren Anschlusses des Kunden an das örtliche Netz. Dieser Vertrag wird zwischen dem Netzbetreiber und dem Grundstücks-/Gebäudeeigentümer geschlossen. Netzanschlussverträge sind auch die Voraussetzung von Stromerzeugungsanlagen, die in das allgemeine Netz einspeisen.
- Der Netznutzungsvertrag regelt alle Fragen der laufenden Netznutzung einschließlich der Entgelte. Er wird im Grundsatz vom Endkunden mit dem Netzbetreiber abgeschlossen. Die Netznutzung ist durch die Bundesnetzagentur stringent reguliert, so dass hier wenig Spielräume bestehen.
- Der Energieliefervertrag regelt die eigentliche Energielieferung zwischen Endkunde und Energielieferant. Neben den Preisen kann hier auch die Art der Energieerzeugung vereinbart werden.
In der Regel wird die Netznutzung über den Energielieferanten abgerechnet, so dass der Endkunde für Energielieferung und Netznutzung eine gemeinsame Rechnung erhält. Der Energielieferant zahlt die Netznutzungsentgelte an den Netzbetreiber.
Die Netzbetreiber müssen Konzessionsverträge mit den Gemeinden abschließen, mit denen die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb der Netze geregelt werden. Darin werden - im Rahmen gesetzlicher Grenzen - die Konzessionsabgaben festgelegt. Diese können für kleinere Verbraucher (pro kWh) deutlich höher als für Großverbraucher sein. Üblicherweise wird kommunalen Abnahmestellen ein Nachlass von 10% auf die Netznutzungsentgelte gewährt.
Nach dem EnWG wird für die allgemeine Versorgungspflicht ein sogenannter "Grundversorger" bestimmt. Dies ist der Versorger, der die Mehrheit der Abnahmestellen in einem Netzgebiet versorgt. Die allgemeine Versorgungspflicht ist allerdings ausschließlich auf Haushaltskunden und Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch bis zu 10.000 kWh beschränkt. Gewerbekunden, zu denen danach auch die meisten öffentlichen Gebäude zählen, fallen nicht mehr unter die Versorgungspflicht. Gewerbekunden und Verwaltungen sind also gezwungen, sich aktiv um Energielieferverträge zu kümmern.
In Notfällen und über einen Zeitraum bis zu drei Monaten greift für alle Letztverbraucher, die Energie über die Netze der allgemeinen Versorgung in der Niederspannung oder im Niederdruck beziehen, eine Ersatzversorgung über den Grundversorger. Dies gilt, wenn einem Energiebezug kein Liefervertrag zugeordnet werden kann (bei Verzögerungen der Vertragsumstellung beim Lieferantenwechsel), wenn ein Energielieferant insolvent ist, das Recht auf Netznutzung verliert (weil er die Netzentgelte gegenüber dem Netzbetreiber nicht wie vereinbart zahlt) oder aus anderen Gründen die Lieferung einstellt. Die Versorgung mit Energie ist durch die Ersatzversorgung somit gesichert.
In der Ersatzversorgung dürfen die Preise häufiger geändert werden: Jeweils zum ersten und fünfzehnten eines Monats können die Preise ohne Einhaltung einer Frist angepasst werden. Für die Beendigung der Ersatzversorgung gibt es keine Kündigungsfrist. Da die Ersatzversorgung ein vergleichsweise teurer Tarif ist, ist es grundsätzlich empfehlenswert, möglichst schnell einen neuen Lieferanten zu suchen und ihn mit der Energiebelieferung zu beauftragen.
Für die - bei größeren öffentlichen Liegenschaften übliche - Stromversorgung aus dem Mittelspannungsnetz sowie (seltener) der Gasversorgung außerhalb des Niederdrucknetzes gibt es keine verpflichtende Ersatzversorgung. Große Energieversorger bieten eine Ersatzbelieferung an, die aber auch vermieden werden sollte.
Im Rahmen regulärer Energielieferverträge können Lieferkonditionen und -preise frei vereinbart werden, unabhängig von der Höhe des Verbrauchs.
4.3 Vergaberechtliche Anforderungen
4.3.1 Ausschreibungspflicht
Seit der Liberalisierung des Energiemarktes gelten Strom wie auch Gas als "Ware". Das europäische Vergaberecht gewährt den Bietern damit einen Anspruch auf die Einhaltung des Vergaberechtes. Demnach ist von öffentlichen Auftraggebern der Bezug von Strom und Gas europaweit öffentlich auszuschreiben, soweit der Lieferwert des Vertrages den Schwellenwert gemäß VgV überscheitet, was bei gebündelten Rahmenverträgen in der Regel der Fall ist. Darunter gelten weiterhin die haushaltsrechtlichen Regelungen in Verbindung mit den nationalen Regelungen.
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) kann nur unter engen Voraussetzungen ein sogenanntes "Inhouse-Geschäft" geltend gemacht und von einer Ausschreibung abgesehen werden. Dies kann gegeben sein, wenn folgende Sachverhalte gegeben sind:
- der öffentliche Auftraggeber ist alleiniger Anteilseigner des Auftragsempfängers,
- der öffentliche Auftraggeber übt eine Kontrolle über das zu beauftragende Unternehmen wie über eine eigene Dienststelle aus,
- die Tätigkeit des Auftragsempfängers wird wesentlich für den öffentlichen Auftraggeber vollzogen.
Dies kann bei Städten der Fall sein, wenn sich ein örtliches Energieversorgungsunternehmen (Stadtwerke) in ihrem Eigentum befindet. Das ist im Einzelfall genau zu prüfen.
4.3.2 Umweltanforderungen bei der Energiebeschaffung
Öffentliche Auftraggebern können Umweltanforderungen an ihre Beschaffungsgegenstände stellen. Bei der Energiebeschaffung ist die Qualität des beim Verbraucher ankommenden Produktes Strom zwar faktisch unabhängig von der Art der Stromerzeugung des Lieferanten - physikalisch kommt der Strom immer aus dem örtlichen Netz. Deshalb wurde diskutiert, ob die Forderung nach Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ein unzulässiger vergabefremder Aspekt wäre. Seitens der Europäischen Kommission und in der EuGH-Rechtsprechung wird jedoch festgestellt, dass die Nutzung erneuerbarer Energien dem Umweltschutz dient, zu dem sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet haben. Deswegen dürfen öffentliche Auftraggeber die Lieferung von Ökostrom unter folgenden Bedingungen ausschreiben:
- Die Umwelteigenschaften müssen direkt mit dem Auftragsgegenstand verknüpft sein und sich auf die ausgeschriebene Liefermenge beziehen.
- Die Anforderungen dürfen nicht den Marktzugang behindern oder zu einer Diskriminierung von Bietern führen.
- Die Anforderungen und Zuschlagskriterien dürfen dem Auftraggeber keine beliebige Entscheidungsfreiheit einräumen.
- Die Anforderungen müssen ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung oder in der Vergabebekanntmachung genannt sein.
- Das Verfahren muss eine effektive Nachprüfung der Richtigkeit der in den Angeboten enthaltenen Angaben erlauben.
Nicht zulässig wären z.B. folgende Forderungen:
- Vorgaben an die Form, in der das jeweilige Unternehmen der Bieter geführt wird,
- die Wertung einer Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien an andere Kunden des Bieters,
- Vorgabe eines bestimmten Ökostrom-Gütesiegels, da es diverse Gütesiegel gibt, deren Anforderungen nicht miteinander vergleichbar sind und von denen keines im Markt vorrangig verbreitet ist.
- Produkte nach dem Fondsmodell, nach dem ein Teil der mit der Stromlieferung erzielten Erlöse zur allgemeinen Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu verwenden ist; derartige Anforderungen sind von dem eigentlichen Auftragsgegenstand Stromlieferung losgelöst.
Die Herkunft des Stroms kann heute über das Herkunftsnachweisregister nachgewiesen werden.
Der öffentliche Auftraggeber muss die von ihm geforderten Umwelteigenschaften auf jeden Fall transparent und diskriminierungsfrei vorgeben. Die Ausgestaltung ist eine politische Frage, die der Auftraggeber im Einzelfall gründlich vorbereiten muss.
Ausführliche Hinweise dazu gibt der "Leitfaden zur öffentlichen Beschaffung von Öko- und Regionalstrom" des Umweltbundesamtes, zuletzt aktualisiert 2022.
Für die Beschaffung von Biogas bzw. Biomethan stellt sich der Rahmen ähnlich dar. Es gibt allerdings kein Herkunftsnachweisregister. Weiteres hierzu siehe Abschnitt 4.5.
4.4 Strombeschaffung
4.4.1 Marktgrundlagen
Um elektrische Energie wirtschaftlich einkaufen zu können, müssen die Grundlagen für die Strompreisbildung beachtet werden.
Ein wichtiges Abbild dafür ist der Stromhandel an der European Energy Exchange (EEX), in Leipzig. Gehandelt wird hier die Stromlieferung ab Kraftwerk neben dem Spotmarkt (für den Folgetag) auch auf einem Terminmarkt. Hier können zu aktuellen Tagespreisen Strommengen schon für Abnahmen weit in der Zukunft geordert werden (Monats- Quartals- und Jahreskontingente).
Auf dem Terminmarkt werden die Grundlast (Baseload) und die Spitzenlast (Peakload) angeboten. Die Grundlast beinhaltet die Strommenge, die mit konstanter Leistung über 24 h abgenommen wird. Die Spitzenlast umfasst die zusätzliche Strommenge, die mit konstanter Leistung werktags zwischen 08:00 und 20:00 Uhr benötigt wird.
Darüber hinaus wird die restliche benötigte Energiemenge auf dem Spotmarkt in Form von Stundenkontingenten gehandelt. Somit muss für jede Stunde eines Tages am Vortag die am Folgetag benötigte Leistung abgeschätzt und zum Tagespreis geordert werden. Die entstehenden Differenzen zwischen tatsächlich abgenommener und georderter Energie muss als Regelenergie entweder verkauft oder zugekauft werden. Unsaubere Prognosen können hier zu erheblichen Zusatzkosten führen.
Somit wird deutlich, dass ein Stromanbieter über sehr genaue Kenntnisse der Lastverläufe bei seinen Kunden verfügen muss. Es werden daher zur Angebotsabgabe entsprechend gute Daten zumindest über die monatliche Verteilung von Arbeit und Leistung bei den bisherigen Sondervertragsabnahmestellen benötigt. Ebenso sind hinreichende Beschreibungen über die Gebäudetypen bzw. deren Nutzung sinnvoll.
Vollständige Lastverläufe eines Referenzjahres sollten für größere Abnahmestellen bereitgestellt werden. Für jede Abnahmestelle > 30 kW Leistung und i.d.R. > 100.000 kWh Jahresarbeit werden heute elektronische Lastgangzähler verwendet, die 1/4-stündlich die Leistung erfassen und von den Netzbetreibern zur Lastgangerfassung fernausgelesen werden. Diese Lastprofile können vom Netzbetreiber oder dem bisherigen Stromlieferanten angefordert und als Datenbasis für den Einkauf verwendet werden.
Für Abnahmestellen im Kleinverbrauch unterhalb der o.g. Werte sind Standardlastkurven angenommen, die der Strombeschaffung zu Grunde gelegt werden.
Anbieter kalkulieren bei Angebotsabgabe mit den tagesaktuellen Börsenpreisen, können aber erst bei endgültiger Auftragserteilung die Liefermenge fest beschaffen. Deshalb stellt der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Auftragserteilung ein besonderes Kalkulationsrisiko für die Bieter dar. Um dieses Risiko - das sich in Preisaufschlägen widerspiegelt - zu begrenzen, gibt es folgende Möglichkeiten:
- Schnelle Angebotsauswertung und Vergabeentscheidung, um den Zeitraum zu begrenzen (möglichst nur wenige Tage), für öffentliche Verwaltungen auf Grund vorgeschriebener Fristen und Entscheidungsprozesse kaum möglich
- Indizierung des Strompreises an Hand der Börsenpreise über den genannten Zeitraum, d.h. endgültige Preisfixierung bei Zuschlagerteilung
- Ausschreibung einer Preisformel an Hand von Börsenprodukten und Preisfixierung erst nach Auftragserteilung in mehreren Chargen, um das Preisrisiko zu streuen (strukturierte Beschaffung)
Letzteres Verfahren hat sich für öffentliche Auftraggeber weitgehend durchsetzt, weil es geringsten Zeitdruck im Vergabeverfahren mit geringen Risikoaufschlägen der Lieferanten verbindet.
Bei einer Stromausschreibung ist zu berücksichtigen, dass der Zuschlag wenigstens zwei Monate vor Lieferbeginn erteilt sein sollte, damit ein Lieferant hinreichend Zeit hat, mit dem
Netzbetreiber die Modalitäten des Netzzugangs zu klären. Insgesamt muss mit mindestens neun Monaten vom Beginn der Vorbereitungen für ein Ausschreibungsverfahren bis zum Lieferbeginn gerechnet werden.
Mit Blick auf die Veränderungen im Energiemarkt sollte die Laufzeit der Verträge beschränkt bleiben, wegen des beträchtlichen Aufwands einer Ausschreibung aber auch nicht zu kurz gewählt werden. Eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren ggf. mit zweimal einjähriger Verlängerungsoption kann als angemessen betrachtet werden.
In den Ausschreibungen können Vorgaben zur Rechnungsstellung und Datenlieferung definiert werden. Diese sollten aber marktüblich sein, um nicht unnötig Bieter auszuschließen.
4.4.2 Weitere Kosten des Strombezugs
Dem Wettbewerb zugänglich und deshalb ausschreibungspflichtig ist nur die reine Energielieferung. Für den Endabnehmer kommen noch folgende Kosten hinzu:
- Netznutzungsentgelte
- Konzessionsabgaben
- Stromsteuer
- Die gesetzlichen Umlagen z.B. zur Förderung der Kraftwärmekopplung (KWKG) sind z.Zt. stark im Wandel; die in den letzten Jahren bedeutsame Umlage aufgrund des Gesetzes zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG) ist ausgesetzt
- Mehrwertsteuer
Diese Zusatzkosten sollten als durchlaufende Posten stets in ihrer nachzuweisenden Höhe abgerechnet und nicht in Festpreise eingerechnet werden, um den Lieferanten von vermeidbaren Kalkulationsrisiken zu entlasten.
Die Netznutzungsentgelte muss der örtliche Netzbetreiber von der Bundesnetzagentur genehmigen lassen und im Internet veröffentlichen. Die Netznutzungsentgelte werden grundsätzlich unterschieden nach Abnahmestellen mit und ohne Lastgangmessung. Bei ersteren wird weiter unterschieden, auf welcher Spannungsebene - Mittel- oder Niederspannung - der Strom übergeben wird. Weiterhin wird ggf. über die Vollbenutzungsstundenzahl zwischen Abnahmestellen mit steilen oder flachen Lastverläufen unterschieden.
Für eine Ausschreibung sollten die Stromabnahmestellen den Gliederungskriterien des Netzbetreibers entsprechend gebündelt zugeordnet werden.
4.5 Gasbeschaffung
Im Gasmarkt wurde ein breiter Wettbewerb erst später etabliert, heute sind die Marktbedingungen aber weitgehend identisch mit denen des Strommarktes. Das gilt für die Trennung von Netzbetrieb (Monopol, reguliert durch die Bundesnetzagentur) ebenso wie die Preisbildung an der Börse (EEX). Der Markt wurde lange dominiert von wenigen Lieferanten und großen Gasimporteuren - eine Abhängigkeit, die in der Krise 2022 durch explodierende Preise schmerzhaft demonstriert wurde. Durch die inzwischen diversifizierte Einspeisung mittels verflüssigtem Erdgas (LNG 3 ist die Liquidität im Markt wieder gewachsen. Allerdings ist LNG auf Grund der komplexeren Prozesskette und des Transportaufwandes ökologisch noch schlechter als Erdgas, das über Pipelines geliefert wird. Für das Ziel des klimaneutralen Gebäudebestands muss Erdgas durch andere Energieträger ersetzt werden. Bis dahin empfehlen sich ähnliche Beschaffungsverfahren wie beim Strom.
Die Beschaffung von Biogas, dass in Deutschland erzeugt und aufbereitet in das Erdgasnetz eingespeist wird, ist ähnlich der Ökostrombeschaffung grundsätzlich möglich. Allerdings sind die verfügbaren Mengen begrenzt und eine Ausweitung auf Grund der Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung fragwürdig.
Für die Beschaffung von synthetischen Gasen, die mittels Ökostrom erzeugt werden (Power-To-Gas, Wasserstoff und Derivate) entwickelt sich langsam ein Markt. Dies kann zukünftig in bestimmten Stadtteilen oder Regionen gemäß kommunaler Wärmeplanung in Frage kommen. Voraussichtlich werden jedoch zunächst Industrieprozesse beliefert.
4.6 Fernwärme
Die Verteilung von Fernwärme ist im Gegensatz zu Strom oder Gas nur über relativ geringe Entfernungen möglich. Insoweit sind hier Energieanbieter und Netzbetreiber in der Regel identisch und es besteht keine Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Bietern.
Aufgabe des Energieeinkaufs ist hier insbesondere die Überprüfung der vertraglichen Anschlussleistungen, da der Leistungspreis oft einen bedeutenden Kostenanteil ausmacht. Im Gebäudebestand sind oft zu hohe Leistungswerte vereinbart. Um dieses zu erkennen und zu optimieren, bieten sich folgende Verfahren an:
- Ermittlung der Vollbenutzungszeiten (Verhältnis von Jahresenergieverbrauch zur vereinbarten bzw. installierten Leistung) und Vergleich mit Durchschnitts- oder Literaturwerten (siehe Anhang B2 und VDI 2067 Blatt 2); niedrige Vollbenutzungszeiten deuten auf unnötig hohe Leistungswerte hin.
- Genaue Verbrauchsmessung und Aufschreibung z.B. von Stundenwerten, permanent oder für eine begrenzte, charakteristische Periode zur direkten Feststellung tatsächlich benötigter Maximalleistungen.
- Nachrechnen des Wärmebedarfes.
Kommunen können Rahmenverträge mit den lokalen Fernwärmelieferanten anstreben. Bei langfristiger Abnahmegarantie sind Vergünstigungen bei Anschlusskosten und/oder Energielieferpreisen denkbar.
Um die Dekarbonisierung der Fernwärmeerzeugung zu unterstützen, kann der Anschluss weiterer Gebäude an die Fernwärme an entsprechende Zusagen des EVU gebunden werden. Dies sind durch das Wärmeplanungsgesetz aber ohnehin verpflichtet, Pläne zur Dekarbonisierung der Wärmenetze aufzustellen.
Wenn eine Wärmelieferung angestrebt wird und zugleich die technischen Anlagen zu Wärmebereitstellung erst noch bereitgestellt werden sollen (Anlagen-Contracting), entsteht eine Ausschreibungspflicht. (Siehe Abschnitt 7.4)
4.7 Wasser
Wasser kann zwar auch über längere Strecken transportiert werden, aber in der Regel sind Netzbetreiber und Lieferant identisch oder über langfristige Lieferverträge miteinander verbunden. Für die Verbraucher besteht keine Auswahlmöglichkeit, insofern sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt wie bei der Fernwärme.
4.8 Einkauf nicht leitungsgebundener Energien
4.8.1 Heizöl
Für das Ziel des klimaneutralen Gebäudebestands muss Heizöl durch andere Energieträger ersetzt werden. Soweit bis dahin noch benötigt, ist der sehr offene, aber auch sehr volatile Markt zu beachten. Heizöl wird an verschiedenen Handelsplätzen bzw. Börsen gehandelt, Preise aktualisieren sich täglich. Möglich ist eine ggf. europaweite Ausschreibung etwa einer Jahreslieferung mit Auf- und Abgeboten zu veröffentlichten Börsenpreisen oder Indizes. Eine Alternative sind bedarfsabhängige Abfragen von Tagespreisen bei einer hinreichenden Zahl örtlicher Anbieter. Wesentlich ist die börsenbedingte kurze Bindefrist der Angebote (etwa bis 12:00 Uhr am Tage der Preisabfrage) und die daher notwendige zügige Beauftragung.
4.8.2 Flüssiggas
Kennzeichnend für Flüssiggas ist, dass die Flüssiggastanks häufig im Eigentum der Lieferanten verbleiben und von diesen gewartet bzw. die notwendigen externen Sicherheitsüberprüfungen veranlasst werden. In solchen Fällen besteht i.d.R. eine Lieferbindung an die entsprechende Flüssiggasfirma. Entsprechend sind bei Vertragsgestaltung und Laufzeit der Lieferbindung Vorkehrungen zu treffen, dass das Flüssiggas nachweislich zu Marktpreisen geliefert und bei Vertragsausschreibung ein fairer Wettbewerb sichergestellt wird.
4.8.3 Holz
Das klimafreundliche Potenzial von Holz ist begrenzt, weshalb auch das Umweltbundesamt von der energetischen Holznutzung aus Klimaschutzgründen abrät. Hinzu kommen die bei der Verbrennung entstehenden Luftschadstoffe. Nach dem GEG gilt Holz als nachwachsender Rohstoff (Biomasse) unter den Voraussetzungen des § 71g als erneuerbare Energie für die Wärmeerzeugung. D.h. es darf nicht zu Entwaldung und Waldschädigung beitragen und nicht mit Schadstoffen verbunden sein.
Zu unterscheiden ist zwischen Holzhackschnitzeln und Holzpellets.
Hackschnitzel sind im Mittel etwa zigarettenschachtelgroße, gehäckselte oder gehackte naturbelassene Holzstücke. Für die Verfeuerung sind vier Quellen zu unterscheiden:
- Waldholz = Resthölzer aus der Forstwirtschaft,
- Landschaftspflegeholz, z.B. Hölzer aus Pflege öffentlicher Grünanlagen,
- Sägewerksresthölzer;
- Althölzer A 1 = unbehandelte Holzabfälle, z.B. Paletten.
Die unterschiedlichen Quellen bedingen unterschiedliche Preise und Qualitäten der Hackschnitzel. Je nach eingesetzter Anlagentechnik werden bestimmte Anforderungen an den Restfeuchtegehalt, die Hackschnitzelgröße, den max. Aschegehalt etc. gestellt. Eine Beschreibung der Hackschnitzelqualitäten ist in der ISO 17225 - 4 "Biogene Festbrennstoffe - Brennstoffspezifikationen und -klassen -Teil 4 Klassifizierung von Holzhackschnitzeln zu finden. Durch geschickte Mischung von Hölzern aus unterschiedlichen Quellen, kann die gewünschte Qualität sichergestellt und der Aufbereitungsaufwand minimiert werden.
Die Abrechnung der gelieferten Holzenergie sollte den Energiegehalt der Hackschnitzel wegen möglicher Schwankungen z.B. aufgrund des Feuchtegehaltes berücksichtigen, in dem die über die Holzkessel erzeugte Wärme gemessen und als Abrechnungsgrundlage genutzt wird. Hierbei ist der Jahresnutzungsgrad des Kessels zu berücksichtigen.
Wegen der vergleichsweise aufwändigen Anlagentechnik der Wärmeerzeuger samt Brennstoff-Fördereinrichtung kommt die Hackschnitzelfeuerung nur bei Kesselgrößen ab 200 - 500 kW in Frage. Es empfiehlt sich, vor Bau einer Anlage einen langfristigen Liefervertrag abzuschließen, der möglichst auch die Asche-Entsorgung mit beinhaltet.
Für Holzhackschnitzel zu empfehlen ist die Nutzung lokaler Resthölzer. Bei der Nutzung von stadt- bzw. landeseigenen Landschaftspflegehölzern über ein Inhouse-Geschäft erübrigt sich eine Ausschreibung. Längerfristige Verträge mit regionalen Forstbetreibern oder Holzverarbeitern können interessant sein und sind vergaberechtlich zu prüfen.
Holzpellets sind genormte, zylindrische Presslinge aus getrocknetem, naturbelassenem Restholz von einem Durchmesser von 4 -10 mm und einer Länge von max. 45 mm. Qualitätsanforderungen sind in der DIN EN ISO 17225 - 2 "Biogene Festbrennstoffe - Brennstoffspezifikationen und -klassen -Teil 2: Klassifizierung von Holzpellets" definiert. Die ISO-Norm wurde 2021 grundlegend überarbeitet. Ergänzend ist eine Zertifizierung nach dem Standard "DIN plus" möglich. Diese Qualität ist zu empfehlen, da sie die Störungssicherheit des Anlagenbetriebs verbessert.
Holzpellets sind zwar teurer als Hackschnitzel, bieten aber aufgrund besserer Lager- und Transportmöglichkeiten, geringerer Fehleranfälligkeit der Anlagen sowie Vorzügen bei einer vollautomatisierten Verfeuerung Vorteile gegenüber Hackschnitzeln, die sie insbesondere für kleinere Anlagen i.d.R. bis zu einer Obergrenze ca. 150 kW zum bevorzugten Holzbrennstoff machen.
Es existiert für Pellets inzwischen ein gut entwickelter Markt, so dass ein vergaberechtskonformer Abschluss von Lieferverträgen gewährleistet werden kann. In der Regel erfolgt dies über öffentliche Ausschreibungen zu . Langfristige Bindungen an einen Lieferanten sind nicht notwendig.
4.9 Vertragsmanagement
Der Energieeinkauf ist mit Vertragsabschluss nicht erledigt, sondern ein laufendes Geschäft. Während der Vertragslaufzeit sind folgende Aufgaben zu erfüllen:
- Die Pflege der Abnahmestellen, d.h. Aufnahme neuer Abnehmer in das Vertragswerk, Änderung des Nutzers/Vertragspartners, Vertragsbeendigung für nicht mehr benötigte Abnahmestellen
- Anpassung der Vertragsdaten z.B. bei Nutzungsänderungen oder Energiesparmaßnahmen
- Festlegung der Preisfixierungszeitpunkte und der Bestimmung des Strompreises bei strukturierter Beschaffung
- Prüfung der Abrechnungen.
- Beobachtung und Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen der und der Marktentwicklung
- Soweit erforderlich Nachverhandlungen bei sich ändernden Rahmenbedingungen, z.B. Berücksichtigung neuer gesetzlicher Regelungen.
Die Einführung elektronischer Rechnungen hat die Kontrolle und Auswertung der Rechnungen zunächst nicht vereinfacht, da sich die komplexen Inhalte der Energierechnung mit den diversen o.g. Preisbestandteilen nicht in den gängigen Standardformaten elektronischer Rechnungen abbilden lassen. Insofern müssen konventionelle Rechnung in der Regel als pdf-Anhang versandt werden und dann den richtigen Ansprechpersonen zugeleitet werden.
Einige Versorger bieten Web-Portale, aus denen Rechnungsdaten abgerufen werden können, ggf. für Rahmenvertragskunden auch gebündelte Listenauswertungen - dies kann in den Ausschreibungen als eine Bedingung oder Wertungskriterium vorgegeben werden.
5. Gebäudebetrieb
Auch optimal geplante und gebaute Gebäude können im Betrieb unzureichende Ergebnisse liefern, wenn sie nicht angemessen betrieben werden.
Es ist daher erforderlich, dass die Gebäude während der gesamten Nutzungsphase von qualifiziertem Personal begleitet werden. Dabei geht es zum einen um die Überwachung von Verbräuchen, Kosten und technischen Betriebsparametern und zum anderen um die Beratung, Schulung und Kommunikation mit den Nutzern.
Notwendige Grundlage für eine gute Betriebsführung ist eine koordinierte Übergabe von der Bauphase in die Betriebsphase. Ein gewerkeübergreifender Inbetriebnahmeprozess, eine mehrmonatige Einregulierungsphase, eine gute Dokumentation der eingebauten Anlagentechnik, Regelungs- und Betriebsparameter und eine ausführliche Einweisung des Betriebspersonals und der Nutzer in das Gebäude sind dafür unerlässlich.
5.1 Organisatorische Maßnahmen
Konsequent durchgeführtes Flächen- und Belegungsmanagement ist ein wichtiger Baustein für einen nutzungsgerecht minimierten Energieverbrauch.
Das Energiemanagement sollte die Nutzer über mögliche Maßnahmen zur Belegungsoptimierung unter Berücksichtigung der speziellen technischen und gebäudespezifischen Aspekte der einzelnen Gebäude informieren.
Folgende Maßnahmen tragen z.B. zu einem flächenoptimierten und energieeffizienten Betrieb bei:
- Mehrfachnutzungen von Räumen durch verschiedene Nutzergruppen
- Einführung von neuen Arbeitsmodellen wie desksharing, insbesondere bei der Planung neuer Verwaltungsgebäude
- Sondernutzungen wie Elternabende und VHS-Kurse in Schulen möglichst in einen Gebäudeteil und einen Heizbereich legen und terminlich abstimmen.
- Wochenendnutzung von Turn- und Sporthallen durch Vereine auf möglichst wenige Objekte konzentrieren.
- Bei längerer Nichtnutzung während der Heizperiode (Weihnachten oder Winterferien in Schulen) sollten Arbeiten, wie z.B. Grundreinigung der Gebäude nicht stattfinden, um eine wirksame Temperaturabsenkung im Gebäude realisieren zu können.
- Der Hortbetrieb sollte während der Ferien in Abhängigkeit der Belegung auf einzelne Standorte konzentriert werden.
Erfahrungsgemäß stoßen diese Punkte nicht bei allen Nutzern auf Akzeptanz. Um diese zu steigern ist es wichtig, den Nutzen und Sinn dieser Maßnahmen transparent zu machen, möglich Einsparpotentiale möglichst konkret aufzuzeigen und gleichzeitig die nutzungsspezifischen Belange im Blick zu haben.
Dies gelingt nur über eine enge Kommunikation zwischen Energiemanagement, Gebäudebetrieb und Nutzern.
5.2 Nutzerbeteiligung
Dem Nutzer kommt eine zentrale Bedeutung bei dem Bemühen zu, den Energie- und Wasserverbrauch eines Gebäudes zu senken, daher ist die Nutzerbeteiligung ein wichtiger Baustein des Energiemanagements.
Zum einen beeinflusst er durch sein Verhalten den Energie- und Wasserverbrauch. Dauerhaftes Kipplüften statt kurzes regelmäßiges Stoßlüften, zugestellte Heizkörper, offenstehende Außentüren, hochgedrehte Thermostatventile (sofern keine Behördenventile im Einsatz sind), elektrische Geräte im standby-Betrieb, unnötige Beleuchtungszeiten, überhöhte Temperaturansprüche sind klassische Ansatzpunkt für eine Veränderung des Nutzerverhaltens.
Zum anderen sind die Nutzer aber auch eine wichtige Unterstützung und Informationsquelle, wenn es darum geht, einen energieeffizienten Betrieb sicher zu stellen. Undichte Fenster, tropfende Wasserhähne, defekte Thermostatventile, Änderungen in Belegung und Nutzung fallen ihnen als Erste auf. Durch eine schnelle Weitergabe der entsprechenden Informationen an das Energiemanagement bzw. die Objektbetreuer sind Mängelbeseitigung und Optimierungen zügig umsetzbar. Hierfür sollte eine Plattform zur Verfügung stehen, über die Meldungen schnell und strukturiert absetzbar sind.
Auch der Erfolg technischer Maßnahmen hängt letztlich in hohem Maße von der Akzeptanz der Nutzer ab. Gerade bei modernen Gebäuden mit technischen Anlagen, die Nutzer noch nicht gewohnt sind, ist eine gute Information besonders wichtig. Wenn Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung installiert sind, ist für deren Effizienz entscheidend, unter welchen Bedingungen noch Fenster geöffnet werden sollten oder dies zu unterbleiben hat. Entscheidend ist dies, wenn nach einer Gebäudesanierung ein anderes Nutzerverhalten nötig ist als für dieselben Nutzer im selben Gebäude vorher.
Selbst bei hoch automatisiertem Betrieb der technischen Anlagen hat das Nutzerverhalten großen Einfluss auf den Energieverbrauch. Wenn vor Ort wenig Eingriffe in die Anlagensteuerung möglich sind, ist eine gute Kommunikation zum zentralen technischen Betrieb besonders wichtig, um Akzeptanz und Zufriedenheit bei den Nutzern zu erreichen.
Dabei geht es bei der Kommunikation mit den Nutzern nicht nur um technische Fachfragen. Nicht zu vernachlässigen ist die Überzeugungsarbeit, um psychologische Barrieren zu überwinden. Daher bietet es sich an, bei der Personalauswahl im Energiemanagement nicht nur auf Ingenieure und Techniker zurückzugreifen, sondern auch Personal aus dem Bereich Bildung und/ oder Umweltpsychologie einzubinden.
Manche Menschen verbinden mit dem Wort "Energiesparen" noch immer negative Vorstellungen. Energiesparen wird dann mit Frieren, schlechter Beleuchtung und Komfortverlust gleichgesetzt. Hier ist es wichtig für die öffentlichen Gebäude in Abstimmung mit den Nutzern klare Qualitätsstandards (Raumtemperatur, Beleuchtungsstärke etc.) festzulegen und diese zu kommunizieren. Energiesparen bedeutet dann nicht grundsätzlich Verzicht, sondern die Einhaltung einer abgestimmten Qualität.
Um die Nutzer sinnvoll einzubinden und in ihren Bemühungen zu unterstützen bieten sich beispielhaft folgende Maßnahmen an
- Transparente Bereitstellung der Energieverbräuche
Die tatsächlichen Energieverbräuche und erzielten Einsparungen (bzw. Mehrverbräuche) sollten zeitnah in leicht verständlicher Form an die Gebäudenutzer rückgemeldet werden. (siehe auch unter 3.4.1) - Bereitstellen von nutzerspezifischen Infomaterialien
Bereitstellen von nutzerspezifischen Informationen zu den Themenbereichen, Funktion des Gebäudes und der Haustechnik, Hintergrund und Ziele von Energieeinsparmaßnahmen, energiesparende Verhaltensweisen, Einsparerfolge, Ansprechpartner für Anregungen von Nutzern etc.
Die Informationen müssen in Inhalt, Stil und Sprache auf die jeweilige Nutzergruppe angepasst sein. Zur Bereitstellung dieser Informationen bieten sich je nach Nutzergruppe unterschiedliche Formate an wie Flyer, Nutzerhandbücher, Artikel im Intranet, regelmäßige Newsletter, Ausstellungen, Plakate, social media Beiträge etc. - Schulung und Fortbildung des Bedienungspersonals
Schulung und Fortbildung des Bedienungspersonals im Hinblick auf energiesparende Betriebsweise und Bereitstellung von regelmäßig aktualisierten Schulungsunterlagen - Finanzielle Beteiligung der Gebäudenutzer an Einsparungen:
Die Gebäudenutzer erhalten einen bestimmten Anteil der durch Verhaltensveränderung erzielten Einsparung zu ihrer Verfügung. Hiervon kann z.B. zusätzliches Gerät beschafft werden, oder Arbeitsgemeinschaften werden in ihrer Arbeit unterstützt.
Dabei ist die Zuordnung von Einsparungen zum Nutzerverhalten einerseits und technischen Maßnahmen andererseits nicht immer leicht. Prämien sollten aber nur ausgezahlt werden, wenn zielführende Aktivitäten erkennbar sind. Absolute Gerechtigkeit ist hier nicht zu erreichen. Deshalb sind einfache Verfahren zu empfehlen, die im Zweifelsfall großzügig für die Nutzer ausgelegt werden. Möglich ist es auch, die Prämienauszahlungen nicht an den erzielten Einsparungen, sondern an definierte Aktivitäten zu koppeln. (Auseinandersetzung mit Energieverbrauch; Benennung von Energieverantwortlichen, Thematisierung von Energieverbräuchen und Nutzerverhalten) Wirksam können auch persönliche Anreize für Energiebeauftragte (siehe Punkt f) sein - hier sind aber gegebenenfalls personalrechtliche Belange zu berücksichtigen.
In einigen Städten haben insbesondere in Schulen Projekte erhebliche Erfolge erzielt, die finanzielle Anreize mit Informationskampagnen über energiesparendes Verhalten verbinden, bis zur Integration des Themas in den Unterricht. Anreizmodelle sind aber ebenso in anderen Gebäuden möglich, wie Kitas, Hochschulen, Verwaltungsgebäuden. Wichtig ist auch dabei immer die zielgruppenspezifische Aufbereitung. - Budgetierung und dezentrale Bewirtschaftung von Betriebskosten
Die Budgetierung und dezentrale Bewirtschaftung von Betriebskosten ist eine Möglichkeit, die Nutzer direkt von Einsparungen profitieren zu lassen und für die Energie- und Umweltproblematik zu sensibilisieren. Für eine optimierte Energiebeschaffung ist allerdings eine zentrale Bewirtschaftung von Vorteil. - Benennung von gebäudeinternen Energiebeauftragten
Für jedes Gebäude soll aus dem Kreis der dort Beschäftigten ein Ansprechpartner für Energiefragen benannt werden (Energiebeauftragte), der beispielsweise- auf die bedarfsgerechte Beleuchtung und die Einhaltung der Raumtemperaturen achtet,
- Ansprechpartner für die Mitarbeiter in Sachen Energie ist,
- auf Energieverluste sowie energieverbrauchende technische Mängel achtet und entsprechende Informationen an das zentrale Energiemanagement weiterleitet.
Dies können Hausmeister, Mitarbeiter der Hausverwaltung oder andere interessierte Personen sein. In Schulen sind Energieteams aus Hausmeister, Lehrern und Schülern besonders wirksam.
- Benennung Ansprechpartner
Für die Nutzer sollten klare Ansprechpartner im zentralen Energiemanagement oder in der Objektbetreuung zur Verfügung stehen, an die sie sich wenden können, wenn energierelevante Mängel oder Auffälligkeiten festgestellt werden. - Öffentlichkeitswirksame Sonderaktionen z.B. in Wettbewerbsform
Durch spezielle Aktionen wie Wettbewerbe unter dem Motto "Wer wird Energiesparer des Jahres" mit entsprechenden Preisen und Ehrungen lässt sich eine besondere Aufmerksamkeit und Motivation herstellen.
Die Fremdnutzung öffentlicher Gebäude - wie insbesondere in Schulen und Turnhallen üblich - bewirkt oft erhöhte Energie- und Wasserverbräuche. Es sollte geprüft werden, inwieweit die Fremdnutzer zur Erstattung der Energiekosten herangezogen werden können. Dafür sind unter Umständen technische Maßnahmen zur gesonderten Erfassung (Einbau von Zählern) und gezielten Begrenzung (z.B. Zeitschaltungen) der Verbräuche der Fremdnutzer sinnvoll. Dabei muss das Kosten-Nutzen-Verhältnis angemessen sein. Die Trennung der Heizungs-, Strom- und Wasserinstallationen in eigen- und fremdgenutzte Bereiche in bestehenden Gebäuden ist im Allgemeinen nicht vertretbar.
5.3 Technischer Betrieb, Betriebsüberwachung
Die technische Gebäudeausrüstung soll den angemessenen Nutzungsanforderungen entsprechend betrieben werden:
- Nutzungsgerechte Einstellung von Betriebszeiten, Raumtemperaturen, Luftfördermengen etc.,
- regelmäßige Wartung und Prüfung nach technischen Erfordernissen und gesetzlichen Vorgaben,
- zügige Bearbeitung von Betriebsstörungen,
- rechtzeitiges Erkennen und Beseitigen verbrauchserhöhender Mängel,
- Kontrolle der Mängelbeseitigung.
Die Qualifikation des Bedienungspersonals muss der Komplexität der technischen Anlagen entsprechen. Dies ist nicht in jedem Gebäude vor Ort darstellbar. Eine zentral organisierte Betriebsüberwachung durch qualifiziertes Fachpersonal kann deshalb durch regelmäßige Überprüfung der technischen Parameter und unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen erhebliche Energieeinsparungen bewirken.
Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße Übergabe neuer Gebäude bzw. erneuerter Anlagen in den Gebäudebetrieb mit gründlicher Einweisung des Bedienungspersonals. Bei komplexen Anlagen ist dies nicht an einem Tag zu erledigen, sondern erfordert eventuell eine längere Begleitung durch die Anlagenplaner. Bei größeren Projekten ist ein systematisches Inbetriebnahmemanagement erforderlich. Andernfalls kann das unkoordinierte Wirken verschiedener Komponenten in ihren jeweiligen Werkseinstellungen zu sehr ineffektivem Betrieb führen. (Näheres hierzu siehe AMEV-Empfehlungen "Inbetriebnahmemanagement" und "Technisches Monitoring").
Dazu gehört eine Anlagendokumentation mindestens mit folgenden Elementen:
- Gerätelisten
- technische Daten aller Anlagen und Anlagenteilen
- Schemapläne
- Abnahmen, Bescheide, Auflagen, Betriebserlaubnisse
- Prüfprotokolle und Testergebnisse
- Funktionsbeschreibungen insbesondere hinsichtlich des Zusammenspiels verschiedener Anlagen und Komponenten (Heizung/Lüftung) und Regelungskaskaden
- Bedienungsanleitungen
- Prüf- und Wartungsanweisungen
- Montageanleitungen für die Instandhaltung
Die kompletten Revisionsunterlagen sollten jeweils bei der zentralen Betriebsüberwachung verfügbar sein.
Für die Bediener vor Ort müssen übersichtliche, leicht verständliche Informationen zusammengestellt werden (Gebäudebetriebsordner, Anlagenschemata, Betriebs- bzw. Bedienanweisungen).
Für die übrigen Gebäudenutzer ist eine nochmals vereinfachte Zusammenfassung (1 - 2 Seiten) erforderlich. Dies ist besonders wichtig, wenn neue bzw. sanierte Gebäude auf ein anderes Nutzungsverhalten ausgelegt sind, als die Nutzer gewohnt sind. Das betrifft insbesondere Gebäude mit RLT-Anlagen, wo die Fenster in der Regel nicht mehr oder nur noch zu bestimmten Zeiten (Sommerabschaltung der RLT) zum Lüften geöffnet werden sollen.
Die Erstellung derartiger Unterlagen kann als besondere Leistung nach der HAOI betrachtet werden und die Zuständigkeit ist bereits am Anfang der Planung zu bestimmen.
Die Planer haben vor Übergabe der Unterlagen zu prüfen, ob diese der tatsächlichen Ausführung entsprechen.
Nach vorliegenden Erfahrungen ist (nach der Inbetriebnahme- und Einregulierungsphase) eine Überwachung durch Begehung der Gebäude in Intervallen von ein bis vier Monaten zweckmäßig und wirkungsvoll. Die Intervalle sind abhängig von Umfang, Alter und regelungstechnischer Ausstattung der Anlagen. Die Ausrüstung mit einer Gebäudeautomation und zentraler Fernüberwachung kann den Betrieb deutlich verbessern und ermöglicht ggf. längere Intervalle, jedoch keinen völligen Verzicht auf die regelmäßige Begehung.
Meldungen von Gebäudenutzern z.B. über zu niedrige oder unnötig hohe Raumtemperaturen sollen zügig bearbeitet werden, d.h. objektive Überprüfung und ggf. gezielte Gegenmaßnahmen, wie Korrekturen im hydraulischen Abgleich oder von Absenkzeiten, kein vorschnelles Verstellen von Heizkurven ganzer Gebäude.
Die sorgfältige hydraulische Einregulierung wird bei den für Wärmepumpenbetrieb erforderlichen niedrigen Vorlauftemperaturen besonders wichtig.
Die zunehmend eingesetzten RLT-Anlagen erfordern eine ebenso sorgfältige Einregulierung der Luftmengen, um die Ziele der Energieeffizienz, der Hygiene und des Nutzungskomforts zu erreichen.
Die Möglichkeiten, Energieeinsparungen an technischen Anlagen durchzuführen sind vielfältig. Die Maßnahmenliste im Anhang C beinhaltet eine große Auswahl von Einsparmaßnahmen und kann bei der Suche nach Einsparpotentialen im Gebäude auch als Checkliste verwendet werden.
5.4 Gebäudeautomation
Die Ausstattung von Liegenschaften mit einem durchgängigen Gebäudeautomations-System (GA-System) ergibt sich auf der Grundlage der EU-Richtlinie 2018/844 zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.
GA-Systeme eignen sich hervorragend dazu, den Liegenschaftsbetrieb gebäude- und anlagenübergreifend auch in energetischer Hinsicht zu optimieren. Zeit- und ereignisabhängige Schaltprogramme (z.B. nutzungsabhängige Licht-, Lüftungs- und Heizungssteuerung) ermöglichen Optimierungen mit erheblichen energetischen Auswirkungen. Weiteres Potential liegt in der Verbindung von Anlagen- und Raumautomation sowie in der Nutzung der Betriebsdaten von busfähigen Pumpen- und Ventilator-Regelsystemen.
Gebäude mit relevanten Energie- und Medienverbräuchen müssen mit eigenen Einrichtungen zur Verbrauchserfassung ausgestattet sein. Die direkte Integration der Verbrauchszähler für Heizenergie, Strom, Wasser und weitere Medien in die GA mit zentraler Bereitstellung der Verbrauchswerte oder der Einsatz eines eigenständigen Energiemanagement-Systems ermöglicht die Erkennung energetisch auffälliger Gebäude über ein Benchmarking von Gebäuden vergleichbarer Art und Nutzung, die zeitnahe Zuordnung des Verbrauchs zu Großverbrauchern sowie eine transparente Verbrauchsdarstellung. Zudem ist es möglich, automatisierte Alarmmeldungen bei Auftreten von Defekten mit den damit häufig verbundenen Verbrauchsänderungen zu erzeugen.
Grundlegende Aussagen zu den Anforderungen und Vorgaben zur Energieeinsparung auch in Verbindung mit der GA sind im GEG (siehe Abschnitt 6.4) sowie den einschlägigen Normen (u. a. DIN V 18599, DIN EN 15232/DIN EN ISO 52120, DIN EN ISO 52127) zu finden. Hinweise zur technischen Ausführung für unterschiedliche Gebäudetypen sind auch im Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)15 in der Hauptkriteriengruppe "Technische Qualität" unter dem Kriterium "Technische Ausführung" beschrieben.
GA-Systeme unterstützen die Aufgaben des Energiemanagements bzw. können diese weitgehend wahrnehmen. Hierzu zählen Erfassung und Bereitstellung von Verbrauchsdaten (Strom, Wärme, etc.), die energieeffiziente Regelung und Steuerung von Anlagen (Lastmanagement, gleitendes Schalten, Nachtkühlbetrieb, energieeffiziente Regelung etc.) sowie die Unterstützung der Instandhaltung und Störungsbeseitigung (Erkennung der Notwendigkeit des Filterwechsels bei Lüftungsanlagen, Ermittlung von Leckagen und ungünstigen Betriebsweisen).
Mit Unterstützung der GA-Daten lassen sich auch weitergehende Aufgaben wahrnehmen, z.B. die vom Gebäudeenergiegesetz (GEG) geforderte energetische Inspektion (im Idealfall virtuell und vollständig für alle Anlagen) oder die Auswertung von Daten für Ausschreibungen, Wettbewerbe, Technisches Monitoring, Inbetriebnahmemanagement etc..
Obwohl manche GA-Management- und Bediensysteme über optionale Programmfunktionen zur Unterstützung des Energiemanagements verfügen, werden in der Praxis häufig eigenständige Energiemanagement-Softwaresysteme eingesetzt. Hier bietet es sich an, geeignete Schnittstellen für den Datenaustausch vorzusehen.
In der GA sind vielfach Daten aus Feldgeräten wie Pumpen, Volumenstromreglern, Temperaturfühlern etc. verfügbar, die bereits Basisinformationen zur Ermittlung von Verbrauchsdaten bereitstellen, so dass gesonderte Zähleinrichtungen hierbei nicht erforderlich sind.
Die besonderen Anforderungen der Messinfrastruktur (Zähler und Datenlogger) lassen sich mit speziellen Komponenten (z.B. M-Bus-Zähler) sicher (Stromausfälle, ggf. Eichfähigkeit) erfüllen. Ziel soll es sein, GA-Systeme und Energiemanagementaufgaben so zu verknüpfen, dass beispielsweise redundante Systeme und Funktionalitäten reduziert werden und die Anforderungen der IT-/ OT-Sicherheit gewährleistet sind.
Mit der Norm DIN EN 15232 wurden Festlegungen in Form so genannter Energieeffizienzklassen (BACS-Klassen) getroffen, mit dem Ziel, Regelung und Steuerung für den Betrieb von Gebäuden besser zu nutzen. Die Klasse "A" steht dabei für ein hoch effizientes GA-System, "B" für ein höherwertiges, "C" für ein Standard- und "D" für ein nicht energieeffizientes GA-System. Die Effizienzklasse A ist danach nur bei bedarfsgerechter raumbezogener Regelung, integriert in ein übergeordnetes Gebäudeautomationssystem erreichbar. Die für die Anwendung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zugrundeliegenden Berechnungsverfahren sind in der DIN V 18599-11 beschrieben.
Die laufende Systembetreuung einer GA muss je nach Größe und Komplexität des GA-Systems durch Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation sichergestellt werden. Eine Zentrale Managementebene ermöglicht es - insbesondere in Kommunen mit einer Vielzahl auch kleinerer, räumlich verteilter Gebäude - eine Konzentration des hochqualifizierten Fachpersonals in einer zentralen Betriebsüberwachung vorzunehmen und führt damit zu einer Entlastung des Bedienungspersonals vor Ort.
Die vielfältigen Möglichkeiten erfordern ein umfassendes Konzept zur GA, das gründlich zu planen ist, passend zur Gebäude- und Organisationsstruktur der jeweiligen Verwaltung. Eine Hilfestellung und umfassende Hinweise zum Thema GA bietet die vom AMEV-Empfehlung "Gebäudeautomation".
6 Planung, Bau und Sanierung von Gebäuden
6.1 Ziel der Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Handeln ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Beachtung der planetaren Grenzen zur Grundlage von Entscheidungen macht, aber auch Verteilungs- und Generationengerechtigkeit adressiert. Dabei stellt das Bauwesen mit der Inanspruchnahme von Ressourcen und Erzeugung von Emissionen einen wesentlichen Ansatzpunkt dar.
Neu zu errichtende Gebäude müssen zukünftig auf Klimaneutralität ausgelegt werden, d.h. eine ausgeglichene Bilanz aus Energiebedarf und der Deckung aus erneuerbarer Erzeugung unter Ausschluss fossiler Energieträger. Bei der Gebäudesanierung ist dies teilweise nur eingeschränkt möglich, dennoch ist hier ebenfalls eine bestmögliche Annäherung anzustreben. Hier kann eine mittel- bis langfristige Sanierungsstrategie als Sanierungsfahrplan dienen und zielführend sein.
Nachhaltiges Bauen umfasst mehr als die Energieeinsparung und der Einsatz klimaneutraler Energien im (späteren) Gebäudebetrieb. Zu bewerten sind weitere ökologische, ökonomische und soziokulturelle Faktoren. Ziele sind Erhalt der Biodiversität, die Ressourcenschonung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen, die Reduzierung des Flächenverbrauchs, die nachhaltige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen einschließlich der Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette sowie die Sicherung von Gesundheit und Komfort von Nutzern. All diese Anforderungen müssen ressort- und sektorübergreifend angegangen werden. Diese Anforderungen spiegeln die unterschiedlichen Interessenslagen der am Bau Beteiligten und der Gesellschaft wider. Für Bauherren sind vordergründig ein kostengünstiger Bau, später auch die Betriebs- und Instandhaltungskosten von Bedeutung. Für die unmittelbar Nutzenden sind der Komfort und die Funktionalität wesentliche Faktoren, für die Gesellschaft die Inanspruchnahme von Ressourcen und die Reduktion negativer Umweltwirkungen. Kerngedanke des Nachhaltigen Bauens ist es, diese unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen und die an Gebäude gestellten, vielschichtigen und komplexen Anforderungen bestmöglich zu erfüllen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Anforderungen und unterschiedlichen Perspektiven entstehen qualitätvolle Gebäude, die gem. genutzt und wertgeschätzt werden, lange Bestand haben und auf diese Weise wertstabil und zukunftssicher sind.
Ausgangspunkt und wichtige Voraussetzung, um objektive Aussagen über die nachhaltige Qualität eines Gebäudes machen zu können, ist die Betrachtung der gesamten Lebensdauer eines Bauwerks. Die Lebensdauer eines Gebäudes umfasst die Phasen der Planung, der Errichtung - einschließlich der Vorketten der Baustoffherstellung ("Graue Energie") - der Nutzung, des Betriebs und des Abrisses bzw. des Rückbaus oder Umnutzung.
Der Nachweis der nachhaltigen Qualität eines Gebäudes erfolgt meist mittels einer Gebäudezertifizierung. In Deutschland haben sich folgende Zertifizierungs- und Bewertungssysteme durchgesetzt:
- Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB),
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB),
- Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh),
- Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) und
- Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM).
Bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ist zur Bewertung der Ökologie und Nachhaltigkeit von erneuerbaren Energien und auch der eingesetzten Baustoffe ein monetärer Ansatz für die erzielte CO2-Einsparung (Klimakosten von Treibhausgas-Emissionen), über den gesamten Lebenszyklus der technischen Anlagen oder des Gebäudes, zu geben. (näheres siehe Abschnitt 7.2).
Das spätere Kostenbild, energetische und ökologische Bilanz eines Gebäudes wird in den frühen Planungsphasen bereits weitestgehend festgelegt.
6.2 Planungsgrundsätze
Die Entwicklung eines Gebäudes nach den Vorgaben des GEG sowie der Klimaziele der einzelnen Länder und Kommunen erfordert ein ganzheitlich denkendes, interdisziplinär arbeitendes Planungsteam, um alle gestalterischen Möglichkeiten wirtschaftlich abwägen zu können. Durch diese integrale Gebäudeplanung rücken nun Themen wie effiziente Energieversorgung, Nachhaltigkeit, regenerative Energien, Synergieeffekte mehr in den zentralen Fokus.
Zum Thema Nachhaltiges Bauen gibt es umfangreiche Regelwerke und Veröffentlichungen, deren Inhalte hier nicht im Detail wiedergegeben werden können. Verwiesen wird hier auf einige Grundsätze, welche sich aus den Betriebserfahrungen als wesentlich und sinnvoll gezeigt haben.
Energierelevant sind bereits grundlegende Entscheidungen wie
- Standort,
- Kompaktheit des Gebäudes (A/V-Verhältnis),
- Ausrichtung der Gebäudelängsseiten,
- Ausrichtung des Daches in Hinblick auf Nutzung der Photovoltaik,
- Anteile der Fenster- und Fassadenflächen
- Anordnung der Räume mit ähnlichen klimatischen und technischen Anforderungen.
- Vorrangige Konstruktion und Baustoffe.
So kann z.B. durch die entsprechende Ausrichtung und Auslegung des Gebäudes die Sonneneinstrahlung in passiver Weise während der Heizzeit mit zur Erwärmung genutzt werden. Dieser Effekt kann durch eine ausreichende Speicherfähigkeit der Bauteile entsprechend verstärkt werden, dabei muss allerdings ein Abgleich mit dem sommerlichen Wärmeschutz erfolgen. Auch die Einsatzdauer der künstlichen Beleuchtung kann (ggf. unter Verwendung von Lichtlenkungssystemen) durch den Gebäudeentwurf begrenzt werden. Diese baulichen Festlegungen können während späterer Planungsphasen kaum noch korrigiert werden und müssen daher schon bei der Konzeptentwicklung besonders beachtet werden.
Während der ersten Planungsphase sind in enger Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, Architekten und Fachingenieuren ein Versorgungskonzept für das Gebäude und die Technische Gebäudeausrüstung unter Beachtung umweltschonender, ökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte sowie öffentlich-rechtlicher Anforderungen zu entwickeln und im Planungsfortschritt weiter zu optimieren. Stichwort ist hier die integrale Gebäudeplanung, dabei müssen die einzelnen Gewerke übergreifend und sich gegenseitig beeinflussend gesehen werden. Prognosen über den Energiebedarf unterschiedlicher Gebäudekonzepte bei gleichem Raumprogramm haben ergeben, dass die Unterschiede zwischen den zu erwartenden Energiekosten der einzelnen Gebäudeentwürfe bedeutsam sein können.
Die genauen Auswirkungen der Planungsvarianten auf Wirtschaftlichkeit und Energiebedarf können anhand von Normen und anerkannten technischen Regeln beurteilt und verglichen werden. Wichtig ist hierbei das Verständnis, dass die Berechnungen des GEG nicht unmittelbar für die Auslegung der technischen Gebäudeausrüstung herangezogen werden können. Das GEG dient durch seine Witterungs- und Standortbereinigung lediglich dem Vergleich und der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen, jedoch nicht der tatsächlichen Auslegungen des Gebäudes. Hierfür wären folgende einschlägige Regelwerke zu nennen:
- VDI 2067, Wirtschaftlichkeit Gebäudetechnischer Anlagen, insbesondere Blatt 10 und Blatt 40
- DIN EN 12831 - Heizlastberechnung
- VDI 2078 - Kühllastberechnung
- PHPP - Berechnung im Bereich von Passivhäusern
- DIN 4108-2 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz - relevant insbesondere zum sommerlichen Wärmeschutz
Ebenfalls haben sich bei größeren Projekten dynamische Simulationsberechnungen als sinnvolle und geeignete Konzeptionsmethoden durchgesetzt. Anforderungen definiert die VDI 6007.
Kommunen, Länder und Bund stehen dabei in der besonderen Pflicht, durch Vorbildfunktion, den Klimaschutz als festen Planungsbestandteil bei der nachhaltigen Entwicklung von Bauvorhaben zu beachten. Viele Verwaltungen haben bereits eigene Regelungen zur Klimaneutralität erlassen. Ferner können durch politischen Beschluss für den eigenen Gebäudebestand besondere, über das GEG hinausragende Standards für Planung, Bau und energetischer Versorgung festgelegt werden, wie z.B.:
- Unterschreitung der Grenzwerte des GEG für den Energiebedarf um x %
- Passivhausstandard auch für Nichtwohngebäude, ggf. nur bezogen auf die Bauteile
- Festlegung von Anforderungen aus Förderprogrammen
- Begrenzung von Glasflächenanteilen
- Anforderungen an die Nachhaltigkeit (z.B. BNB Bronze-, Silber- oder Goldstandard)
- Vorgaben für Dach- und Fassadenbegrünung
6.3 Planungswettbewerbe
Bei Planungswettbewerben sind die energetischen und ökologischen Anforderungen bereits bei der Auslobung zu konkretisieren und als Prüfkriterium zu benennen. Hinweise dazu gibt die AMEV-Arbeitshilfe "Energie und Kosten in Wettbewerben 2014" und die "Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben" (SNAP) als Vorstufe zum BNB-Verfahren.
Zudem sollen die Betriebskosten für Wärme- und Kälteenergie während der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gebäude ermittelt und einer vergleichenden Bewertung mit den anderen Gebäudeentwürfen unterzogen werden. Für die eingereichten Gebäudeentwürfe werden hierfür dynamische Energiebedarfsberechnungen über die Gebäudehüllfläche nach VDI 2067 Blatt 10 und 11 für Heizen und Kühlen empfohlen. Bei allen Energieprognosen sind wirtschaftliche Materialqualitäten für den baulichen Wärmeschutz zu Grunde zu legen.
Auf dieser Basis können die Preisgerichte ästhetische, technische, funktionale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte der einzelnen Entwürfe in ausgewogener Weise berücksichtigen.
6.4 Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Das "Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG)" hat 2020 das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) abgelöst und deren Anforderungen zusammengefasst, zunächst ohne wesentliche inhaltliche Änderungen. Das GEG regelt die gesamten Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, d.h. Gebäudehülle, Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Beleuchtung.
Für Neubauten wird der Grenzwert des Energiebedarfs gemäß DIN V 18599 über die Berechnung eines Referenzgebäudes mit definierter Ausführung (Hochbau und TGA) ermittelt und mit der geplanten Ausführung abgeglichen. Der Primärenergiebedarf des geplanten Gebäudes darf derzeit maximal 55% des Bedarfs des Referenzgebäudes betragen; eine weitere Absenkung auf 40% war angekündigt, ist allerdings zurückgestellt.
Hinsichtlich der Nutzung werden dabei unterschiedliche Zonen unterschieden. Die einzelnen Zonen werden separat berechnet und abschließend aufsummiert. Für das Referenzgebäude enthält die Norm definierte Vorgaben (Nutzungsprofile) für eine Vielzahl von Nutzungsarten. Bei Einhaltung bestimmter Kriterien kann ein vereinfachtes Ein-Zonen-Modell verwendet werden. Für Wohngebäude konnte bis 2023 neben dem o.g. Referenzverfahren ein vereinfachtes Verfahren unter Einbeziehung von DIN 4701-10 und DIN 4108-6 zur Anwendung kommen, ab 2024 ist auch hier ausschließlich die Berechnung gemäß DIN V 18599 zulässig.
Das GEG unterstützt die ganzheitliche Betrachtung vieler zum Verbrauch beitragender Komponenten. Es fordert eine Mindestqualität der Gebäudehülle und begrenzt vor allem den Primärenergiebedarf, so dass nicht nur besonders energiesparende Lösungen zu beachten sind, sondern auch der Einsatz der verschiedenen Energieträger, überprüft werden muss, um die Anforderungen einhalten zu können.
Durch die Anforderungen des GEG werden Architekten und Fachplaner bereits von Anfang an bei der Entwicklung eines Gebäudes zusammengeführt. Durch kluge Integration der Technischen Gebäudeausrüstung können hochwertige Gesamtsysteme aus Hochbau und Gebäudetechnik verwirklicht werden.
Anforderungen an bestehende Gebäude betreffen die Aufrechterhaltung der energetischen Qualität und bei der Erneuerung von Bauteilen die Begrenzungen der Wärmedurchgangskoeffizienten.
Nachrüstungspflichten eines bestehenden Gebäudes ohne Anlass einer anderweitigen Veränderung betreffen nur die Dämmung oberster Geschossdecken, von Warmwasser- und Heizungsleitungen in unbeheizten Räumen, die Stilllegung von bestimmten (klar veralteten) Heizkesseln und Regelungseinrichtungen.
Mit der GEG-Novelle 2023 wurden die Vorgaben für den Einbau neuer Heizungsanlagen geändert. Gab es zuvor Anforderungen zur anteiligen Nutzung erneuerbarer Energien, sind diese nun vorrangig zu nutzen, entsprechend des Ziels der Ablösung fossiler Brennstoffe bis 2045. Für Neubauten muss ab 2024 jede neu eingebaute Heizung mindestens 65% erneuerbare Energie nutzen. Für den Einbau von Heizungen in Bestandsgebäuden gilt diese Vorgabe erst in Verbindung mit einer kommunalen Wärmeplanung. Diese wird mit dem gesonderten Wärmeplanungsgesetz geregelt, mit Fristen abhängig von der Stadt- bzw. Gemeindegröße, konkret ab dem 30. Juni 2026 in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und ab dem 30. Juni 2028 in allen übrigen Städten und Gemeinden.
Das GEG sieht weitere Übergangs- und Härtefallregelungen vor. Bestehende und funktionierende Heizungen sind von den Regelungen nicht betroffen und können bis Ende 2044 weiter genutzt werden.
Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung der Heizungs- oder kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage oder Klimaanlage von mehr als 290 kW müssen bis Ende 2024 mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung ausgerüstet werden. Diese Vorgabe beinhaltet insbesondere eine Verpflichtung zur Ausstattung mit digitaler Energieüberwachungstechnik.
Für Neubauten sind Energiebedarfsausweise auszustellen. Für Bestandsgebäude sind Energieausweise bei Verkauf oder Neuvermietung gefordert. In öffentlichen Gebäuden mit mehr als 250 m2 Nutzfläche sind Energieausweise öffentlich auszuhängen (siehe Abschnitt 3.4.2)
Die Inhalte des sehr umfangreichen Gesetzes können hier nicht im Detail wiedergegeben werden. Die Anwendung erfordert in der Regel Berechnungen durch einschlägig qualifizierte Energieberater mit entsprechenden Berechnungsprogrammen. Eine Vereinfachung ist im Interesse der Bauherren und Anwender wünschenswert, u.a. dahingehend, die Referenzgebäude so zu definieren, dass gleichartig geplante Gebäude gebaut werden dürfen.
6.5 Einsatz von Erneuerbaren Energien
6.5.1 Allgemeines
Als erneuerbare Energien (EE) oder regenerative Energien werden Energiequellen bezeichnet, die im menschlichen Zeithorizont für nachhaltige Energieversorgung praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen oder sich verhältnismäßig schnell erneuern. Damit grenzen sie sich von fossilen Energiequellen ab, die endlich sind oder sich erst über den Zeitraum von Millionen Jahren regenerieren.
Erneuerbare Energiequellen sind, neben der effizienten Nutzung von Energie, die wichtigste Säule einer nachhaltigen Energiepolitik und der Energiewende. Hierzu zählen Sonnenenergie, Windenergie, Bioenergie, Geothermie, Wasserkraft und Meeresenergie. Ihre Energie beziehen sie von der Strahlung der Sonne, sowie aus der Erdinneren Wärme.
Die Sonne emittiert durch ihre Kernfusionsprozesse große Mengen Energie, die als Solarstrahlung, mittels elektromagnetischer Wellen, die Erde erreichen. Die von der Sonne auf die Erde abgestrahlte Leistung beträgt ca. 174 Petawatt. Etwa 30 % der Strahlung wird reflektiert, sodass ca. 122 PW die Erdoberfläche erreichen. Somit steht rein physikalisch betrachtet wesentlich mehr Energie zur Verfügung, als in absehbarer Zukunft gebraucht werden wird. Erdwärme und Biomasse liefern im Vergleich dazu verhältnismäßig geringe, aber immer noch absolut hohe Beiträge.
Nach dem GEG den EE gleichgestellt ist die Nutzung unvermeidbarer Abwärme, d.h. der Anteil der Wärme, der als Nebenprodukt in einer Industrie- oder Gewerbeanlage oder im tertiären Sektor aufgrund thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten anfällt, nicht durch Anwendung des Standes der Technik vermieden werden kann, in einem Produktionsprozess nicht nutzbar ist und ohne den Zugang zu einem Wärmenetz ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet werden würde.
Damit ist im Umgang mit Energie ein Umdenken bei Planung und Betrieb von Gebäuden erforderlich. Die eingesetzte Wärmeenergie oder Abwärme aus technischen Prozessen, ist zukünftig als Rohstoff zu betrachten, welcher nach Möglichkeit wieder zu verwenden ist. Dies ist nun ähnlich zu sehen wie das bekannte Recycling in der Abfallwirtschaft.
Da in modernen Gebäuden unterschiedliche Lastprofile, Wärmeanforderungen und Abwärme entstehen, ist die Abwärmenutzung ganzheitlich zu sehen und über Wärmerückgewinnungsnetze bzw."Kalte Netze" im Gebäude, einer ganzen Liegenschaft oder auch in Verbindung mit umgebenden Liegenschaft zu verschieben. Durch die Bidirektionalität können Gebäude je nach Lastfall Energieverbraucher oder Energielieferant sein.
6.5.2 Für Gebäude vorrangig verwendbare Formen erneuerbarer Energien
- Photovoltaik
Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung von Sonnenlicht mittels Solarzellen in elektrische Energie. Zur Energiewandlung wird der photoelektrische Effekt von Solarzellen, vorwiegend auf Silizium basierend, genutzt, die ihrerseits wiederum zu Solarmodulen verbunden werden. Die erzeugte Elektrizität wird über Wechselrichter in das Stromnetz eingespeist. Das System aus Solarmodulen, Wechselrichter und Stromleitung wird als Photovoltaikanlage bezeichnet.
Der Ertrag pro Jahr wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Die theoretisch maximal erreichbare Leistung der PV-Anlage (installierte Nennleistung) wird in kW Peak (kWp) angegeben. Standort und Ausrichtung der Module sowie Verschattungen haben einen wesentlichen Einfluss auf den Ertrag. Die mit Solarzellen erzielbaren Wirkungsgrade werden unter standardisierten Bedingungen ermittelt und unterscheiden sich je nach verwendeter Zelltechnologie. Diese betragen derzeit unter reellen Bedingungen zwischen 17 % und 20 %.
Der spezifische Ertrag ist als Wattstunden pro installierter Nennleistung pro Zeitabschnitt definiert und erlaubt einen einfachen Vergleich von Anlagen unterschiedlicher Größe. In Deutschland kann man bei einer einigermaßen optimal ausgerichteten fest installierten Anlage pro Modulfläche mit 1 kWp mit einem Jahresertrag von ca. 1.000 kWh rechnen, wobei die Werte zwischen etwa 850 kWh in Norddeutschland und 1.150 kWh in Süddeutschland schwanken.
Aufgrund der Preisentwicklung am Strommarkt ist die primäre Eigennutzung anzustreben. Um auch die Energiewende weiter voran zu treiben, ist es empfehlenswert, die zur Verfügung stehenden geeigneten Dachflächen komplett mit Photovoltaik zu nutzen, unabhängig vom Eigennutzungsanteil.
Derzeit setzt sich, zur Maximierung der solaren Erträge, eine flache, praktisch vollflächige Verlegung der Solarmodule mit Ost/West-Ausrichtung durch. Hierdurch hat man einen gleichmäßigeren Ertrag über den Tag verteilt als bei einer steileren Süd-Ausrichtung, mit dem Höchstwert zur Mittagszeit.
Die entstehende Flächennutzungskonkurrenz zu evtl. Dachbegrünungen ist wirtschaftlich, auch für den laufenden Betrieb, zu prüfen. Eine Kombination aus Dachbegrünung und Photovoltaik ist zwar möglich, jedoch kritisch zu prüfen. Neben den üblichen Standorten auf Dächern sind Anlagen an den Fassaden möglich, derzeit allerdings noch deutliche teurer. Bei evtl. integrierten Systemen sind die Kosten einer entfallenen Fassadenbekleidung gegenzurechnen und dadurch ggf. wirtschaftlich darzustellen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Planung und Dimensionierung dürften zukünftig reversible Wärmepumpenanlagen sein, welche im Sommerfall zur Kühlung eingesetzt werden können. - Solarthermie
In Solarkollektoren wird die eingestrahlte Sonnenenergie an einen zirkulierenden Wärmeträger abgegeben und kann auf diesem Wege direkt zur Erzeugung von Wärme verwendet werden. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, aber auch zur Unterstützung der Gebäudebeheizung eingesetzt werden. Am weitesten verbreitet ist die Erzeugung von Warmwasser. Es ist aber in jedem Falle ein entsprechender Speicher und ein ergänzendes Heizsystem für sonnenschwache Zeiten und zur Einhaltung der hygienischen Anforderungen nach DVGW-W 551 erforderlich. Warmwasserabnahme, mögliche Solarausbeute und Speichervolumen müssen dabei genau aufeinander abgestimmt sein.
Die verschiedenen am Markt verfügbaren Flach- und Vakuumröhrenkollektoren sind effizient, technisch ausgereift und ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb über mehr als 20 Jahre. Vakuumröhrenkollektoren haben kaum noch Wärmeverluste durch Konvektion oder Wärmeleitung, ihr Wirkungsgrad ist speziell bei niedrigen Umgebungstemperaturen höher als bei Flachkollektoren. Mit ihnen ist auch im Winter eine Heizungsunterstützung über die Solaranlage möglich, die Investitionskosten sind allerdings höher. Im Jahresdurchschnitt werden in Deutschland ca. 1.000 kWh Sonnenenergie je m2 eingestrahlt, daraus können in etwa 400 kWh/m2 Nutzwärme gewonnen werden, dies entspricht einem Energieinhalt von ca. 40 m3 Erdgas bzw. 40 l Heizöl.
Die Solarthermie steht hinsichtlich der nutzbaren Flächen in direkter Konkurrenz zur Photovoltaik. Da der erzeugte Strom vielseitiger nutzbar ist - auch durch Einspeisung von Überschüssen in das öffentliche Netz - sollte bei den meisten öffentlichen Gebäuden die Nutzung der Photovoltaik auf den Dachflächen bevorzugt werden.
Einsatzmöglichkeiten der Solarthermie sind grundsätzlich genau zu prüfen, da häufig eine geringe Korrelation zwischen Erzeugung und Bedarf besteht. Gute Einsatzmöglichkeiten für Solarthermie bestehen in Sportanlagen (besonders in Freibädern), Heimen oder Unterkunftsgebäuden, weniger im normalen Verwaltungsbau oder Schulen aufgrund des fehlenden bzw. geringen Warmwasserbedarfs. In den Fällen, in denen das Warmwassernetz aus Gründen der Legionellen-Prophylaxe mit höheren Temperaturen betrieben wird, ist die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage besonders sorgfältig zu prüfen.
Der Bau von Großanlagen mit Saisonspeicher als Quelle für Nah- und Fernwärmesysteme ist in erster Linie die Aufgabe der EVUs. Bei großen staatlichen Liegenschaften kann dies auch für die öffentlichen Gebäudebetreiber selbst in Frage kommen. - Umweltwärme/Wärmepumpen
Zur Umweltwärme zählt der Energieanteil, der die in der Umwelt bereitstehenden, nutzbaren Temperaturdifferenzen abschöpft. Die Energie steht im Erdreich, Grund- und Oberflächenwasser, der Umgebungsluft oder als Abwärme von technischen Prozessen zur Verfügung und wird über Wärmepumpen (WP) auf ein verwendbares Temperaturniveau gebracht. Eine Wärmepumpe ist eine Kraftwärmemaschine, die unter Aufwendung technischer - in der Regel elektrischer - Arbeit thermische Energie aus Umweltwärme mit niedrigerer Temperatur aufnimmt und als Nutzwärme auf ein zu beheizendes System mit höherer Temperatur überträgt.
Die einfachste Anwendung mit den günstigsten Investitionskosten, die Luft-Wasser-Wärmepumpe, hat den Nachteil, dass genau in den Zeiten mit dem höchsten Wärmebedarf der Wirkungsgrad (COP) am niedrigsten und damit der Strombedarf am höchsten ist. Hinzu kommen unerwünschte Schallemissionen.
Wärmepumpen, welche als Wärmequelle mittels Wasser oder Sole das Erdreich (Oberflächennahe Geothermie), Grund- und Oberflächenwasser mit gleichmäßigerem Temperaturniveau verwenden, sind energieeffizienter, jedoch wesentlich aufwendiger in Planung und Bau. Die üblichste Bauform sind von Sole durchflossene Erdsonden. Zudem erhält künftig auch (Ab-)Wärme mit geringer Temperatur als Energieträger einen Wert, z.B. aus dem Abwasser oder der Kühlung von Rechenzentren.
Sofern nicht zu jeder Wärmepumpe eine eigene Erd- oder Abwärmequelle erschlossen werden kann - z.B. in dicht bebauten Gebieten - ist eine Verteilung über Kalte Wärmenetze möglich.
Das Verhältnis der in den Heizkreis abgegebenen Wärmeleistung zur zugeführten elektrischen Verdichterleistung wird als Leistungszahl (COP - coefficient of performance) bezeichnet. Die Leistungszahl wird auf einem Prüfstand gemäß DIN EN 14511 ermittelt und gilt nur unter den jeweiligen Prüfbedingungen. Der COP ist ein Gütekriterium für Wärmepumpen, erlaubt jedoch noch keine energetische Bewertung der Gesamtanlage. Entscheidend ist die Jahresarbeitszahl, die stark von den Einsatzbedingungen abhängig ist.
Die Arbeitszahl ist umso günstiger, je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur ist. In Kombination mit einem Niedertemperatursystem stellt die Wärmepumpenheizung, eines der zukunftsweisenden Systeme der Gebäudebeheizung dar. Auch die Kombination mit konventionellen Heizkörpern mit Vorlauftemperaturen bis ca. 50°C - was nach energetischen Sanierungen der Gebäudehülle häufig ausreicht - ist bereits etabliert. Aktuelle Entwicklungen der Wärmepumpentechnik gehen auch zu höheren Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C, ggf. mit einem monoenergetischen bivalenten Betrieb mit Heizstab. Dadurch werden Wärmepumpen auch für den unmittelbaren Einsatz bei unmodernisierten Altbauten geeignet. Die Wirtschaftlichkeit während der Leistungsspitzen sollte hier möglichst aufgrund von realen Messwerten betrachtet werden, da konventionelle Heizungsanlagen oft überdimensioniert sind.
Im Ergebnis sind Luft-Wasser Wärmepumpen in der Regel für kleinere Anlagen vorzuziehen (bis 30, max. 100 kW thermische Leistung); damit sind Jahresarbeitszahlen von ca. 3 erreichbar, für größere Leistungen Erdwärmepumpen mit Jahresarbeitszahlen um 4. Zur Verschiebung von Leistungsspitzen können Pufferspeicher gerade bei öffentlichen Liegenschaften sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Sektorenkopplung unterstützen.
Durch den kontinuierlich steigenden Anteil regenerativer Systeme zur Stromgewinnung wird zukünftig das Wärmepumpensystem, unabhängig vom COP-Wert, immer regenerativer.
Wärmepumpen sind meistens reversibel und können somit auch zur Kühlung genutzt werden.
Wärmepumpen benötigen für ihren Kreisprozess ein Kältemittel. Jede WP ist für ein bestimmtes Kältemittel ausgelegt, dieses kann nachträglich nicht ohne Weiteres geändert werden. Die bisher häufig eingesetzten FKW (Fluorkohlenwasserstoffe) haben ein hohes Treibhauspotential und werden nach der europäischen F-Gase-Verordnung schrittweise ausgesteuert. Empfohlen wird die Installation von Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln. Diese erhalten nach der BEG einen Förderbonus von 5%, ab 2028 werden nur noch Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln gefördert. Näheres zur Auswahl enthält die Empfehlung AMEV-Kälte. - Tiefe Geothermie
Die Geothermie nutzt die Wärme des Erdinneren. Die Temperatur steigt mit der Tiefe in der Größenordnung um ca. 3 K pro 100 m an, je nach lokalen geologischen Verhältnissen deutlich mehr oder weniger. In größeren Tiefen (1000 - 3000 m) eignet sich das dort anstehende Temperaturniveau (40 - 100 °C) der Thermalwässer zur Direktbeheizung, in Tiefen von 3000 - 5000 m (über 100°C) ist sogar eine Stromerzeugung möglich (z.B. im Hydrogeothermie- oder Hot-Dry-Rock-Verfahren). Über paarweise angebrachte Bohrungen wird das heiße Wasser aus diesen Tiefen gefördert, in Wärmetauschern abgekühlt und anschließend in der Gewinnungstiefe wieder verpresst. Auf Grund der notwendigen tiefen Bohrungen ist die Tiefengeothermie in der Regel sehr kostenaufwendig und kommt deshalb nur für größere Anlagen in Frage, d.h. große Liegenschaften oder Nah/Fernwärmesysteme. - Biomasse
Darunter versteht man die energetische Nutzung von organischen Stoffen. Bei ihrer Verbrennung wird Energie gewonnen, gleichzeitig wird die beim Wachstum gebundene CO2-Menge wieder abgegeben, d.h. die Verbrennung erfolgt bezüglich der CO2-Emission neutral. Für diese Form der Wärmeerzeugung stehen Anlagen für eine Vielzahl von unterschiedlichen Brennstoffen zur Verfügung. Dabei zielt die Biomassennutzung nicht allein auf die Wärmeversorgung, sondern auch immer mehr auf Stromerzeugung über Kraft-Wärme-Kopplung.
Bei der Biomasse kann es sich um feste Brennstoffe wie Holzhackschnitzel, Pellets, Stroh etc. handeln, die der Verbrennung direkt zugeführt werden. Anlagen für Einfamilienhäuser bis hin zu Heiz-Kraftwerken im mehrstelligen MW-Bereich kommen dabei zur Anwendung. Der Heizwert z.B. von Holzpellets liegt bei ca. 5 kWh für ein kg, diese Menge entspricht bzgl. der Energieausbeute in etwa einem 1/2 m3 Erdgas bzw. 1/2 l Heizöl.
Andere Stoffe wie Bio-Diesel, Bio-Gas, Bio-Ethanol oder Pflanzenöl müssen erst in zum Teil aufwändigen verfahrenstechnischen Schritten und mit entsprechend hohen Investitionen aufbereitet werden. Bei Biogasanlagen lassen sich KWK-Anlagen zur Wärme- und Stromerzeugung unter Berücksichtigung der Einspeisevergütung nach dem EEG einsetzen. Falls vor Ort keine Abnahmemöglichkeiten für die anfallende Wärme aus dem KWK-Prozess besteht, kann das Biogas zu Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist werden, was jedoch technisch aufwendig ist.
Besonders bei Hackschnitzeln ist eine entsprechende Transporttechnologie (Zuwegung, Platzverhältnisse) für die Anlieferung und Lagerung sowie bei Holzpellets die erhöhte Staubbelastung zu beachten. Bei den flüssigen und gasförmigen Brennstoffen stehen neben den ethischen Gründen ("Tank oder Teller", Palmölplantagen statt Regenwäldern) auch zunehmend Bedenken wegen erhöhtem Transportaufkommen und möglichen Geruchsbelästigungen von Biogasanlagen.
Zukünftig ist der Einsatz von Biomasse den Hochtemperatur-Anwendungen vorzubehalten, oder wo bei der Beheizung von Gebäuden keine Niedertemperatursysteme möglich sind (z.B. Denkmalgeschützte Gebäude etc.) und anderweitige Technologien nicht zur Verfügung stehen. - Wasserstoff und Derivate
Freier Wasserstoff kommt in der Natur nur in nicht technisch nutzbarer Form vor. Der genutzte Wasserstoff wird unter Einsatz elektrischer Energie mittels Elektrolyse aus Wasser gewonnen und ist damit ein Sekundärenergieträger. Daher ist eine Wasserstoffwirtschaft nur dann umweltfreundlich und nachhaltig, wenn die Erzeugung durch regenerative Energien stattfindet. Wasserstoff ist besser speicher- und transportfähig als elektrische Energie und kann deshalb eine Ergänzung zur direkten Nutzung regenerativer Energien sein, voraussichtlich weniger in den öffentlichen Gebäuden. Für den Transport über längere Strecken kommt die Umwandlung des Wasserstoffs in Ammoniak (NH3) in Betracht.
Näheres zur Einordnung in zukünftige Energiesysteme siehe auch Abschnitt 1. - Fernwärme
Fernwärme wird heute häufig in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen (KWK) mit mehr oder weniger hohen Anteilen fossiler Brennstoffe erzeugt. Nach dem Wärmeplanungsgesetz müssen alle Wärmenetze spätestens 2045 vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden; damit wird auch Fernwärme perspektivisch als CO2-freie Endenergie betrachtet.
6.6 Gebäudesanierung
6.6.1 Sanierungsbedarf
Viele Gebäude im Bestand entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und haben Sanierungsbedarf. Über die Erkenntnisse der Betriebsüberwachung (siehe Kap. 3 und 5) können die Verhältnisse in diesen Gebäuden über organisatorische Maßnahmen, Optimierung von Regelungen, baulich begrenzte Eingriffe etc. oft schon wesentlich verbessert werden.
In Fällen, in denen trotzdem noch dauerhaft ein erheblich zu hoher Energieverbrauch auftritt, muss eine weitergehende Sanierung erfolgen. Eine Verbindung mit Bauunterhaltungsmaßnahmen ist dabei empfehlenswert. Mitunter ist dabei sogar ein Abriss die energetisch und / oder wirtschaftlich günstigste Lösung, da auch die beste Sanierung keinen Neubaustandard erreichen kann. Dabei ist aber auch die für die Baustoffherstellung erforderliche "graue Energie" zu berücksichtigen. Deshalb kann die Sanierung die ökologisch bessere Lösung sein, auch wenn sie im Gebäudebetrieb etwas schlechter als ein Neubau ist.
6.6.2 Energiekonzept
Vorrangiges Ziel des Energiekonzeptes bei Bestandsbauten ist es, den Weg zur Klimaneutralität für die betreffende Liegenschaft aufzuzeigen, hinsichtlich organisatorischer Abläufe, baulicher und technischer Konzeption sowie ggf. vertraglicher Verpflichtungen eingehend überprüft wird. Prinzipiell ist das folgende Vorgehen denkbar:
- Auswertung vorliegender Verbrauchsdaten und technischer Unterlagen
- Überprüfung der Gebäudehülle (z.B. mittels Thermographie)
- Erfassung relevanter Energieverbraucher und -erzeuger
- Messungen des elektrischen Lastgangs und ggf. einzelner Verbrauchergruppen
- Bewertung des derzeitigen Strom- und Wärmeverbrauchs, ggf. genauere Untersuchung einzelner Verbraucher
- Ermittlung von Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes
- Ermittlung von organisatorischen Änderungen zu Energieeinsparung
- Ermittlung von Strom-, Wärme- und Wassereinsparpotentialen
- Erstellung eines RLT-Konzeptes
- Umstellung der Energieträger zu erneuerbaren Energien
- Nutzung/Verschiebung von Abwärme
- Ermittlung von Vertragsoptimierungen zur Kosteneinsparung
- Wirtschaftliche und ökologische Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen
- Entwicklung eines Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes
Um komplizierte Wechselwirkungen zwischen Architektur, Bauphysik, TGA, Witterungseinflüssen, Nutzungsverhalten und Normkomfortbedingungen zu überprüfen, kann es auch bei Bestandsgebäuden sinnvoll sein, die zu erwartende Dynamik des Verbrauchsverhaltens über Gebäudesimulationsprogramme darzustellen.
7. Finanzierung von Energiesparmaßnahmen
7.1 Nutzen und Kosten des Energiemanagements
Allein durch konsequentes Energiecontrolling und Betriebsoptimierung - ohne größere Investitionen - wurden in vielen Verwaltungen bereits 10 % bis 30 % Einsparung an Energiekosten erreicht. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, je 2 Mio. Euro Energiekosten eine Vollzeitstelle explizit für ein kontinuierliches Energiemanagement zur Verfügung zu stellen. Diese Stellen sparen im Mittel das 3- bis 5-fache der Personalkosten an Energiekosten ein.
Darüber hinaus sind mindestens alle rentierlichen investiven Energiesparmaßnahmen zu finanzieren, um alle wirtschaftlichen Energiesparpotenziale auszuschöpfen.
7.2 Bewertung von Energieeinsparmaßnahmen
Die angespannte Finanzsituation von Bund, Ländern und Kommunen erfordert die wirtschaftliche Bewertung energiesparender Maßnahmen. Dabei besteht gleichzeitig für die öffentliche Hand die Verpflichtung, die politisch bzw. gesetzlich vorgegebenen Klimaschutzziele zu erreichen.
Hierbei ist grundsätzlich der gesamte Lebenszyklus von Gebäuden bzw. der jeweils betrachteten Bauteile/Anlagen zu berücksichtigen. Daher sollten grundsätzlich Lebenszykluskostenberechnungen für alle größeren Baumaßnahmen durchgeführt werden.
Bei der Berechnung sind die vermiedenen Energie-Kosten, die durch die Maßnahmen erreicht werden zu ermitteln und die Investitionen dagegen zu rechnen (Annuitäten- oder Barwertmethode bei längeren Betrachtungszeiträumen). Diese Verfahren sind ausführlich beschrieben in der VDI-Richtlinie 2067 Blatt 1, sowie - speziell dynamische Berechnungen - in VDI 6025.
Allen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ist gemein, dass sie Prognosen der Preissteigerungen und Anlagennutzungsdauer voraussetzen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu verbessern, bieten sich Variantenrechnungen mit unterschiedlich gewählten Parametern an (Sensitivitätsanalyse).
Bei Kombination mehrerer Energiesparmaßnahmen in einem Gebäude gibt es Wechselwirkungen, die keine einfache Addition der Wirkungen der Einzelmaßnahmen erlauben. Wird z.B. der Wärmebedarf eines Gebäudes durch zusätzliche Wärmedämmung vermindert, können zusätzliche Einsparungen durch eine Erneuerung der Wärmeerzeugung nur auf dieses niedrigere Niveau bezogen werden. Für Maßnahmenkombinationen sind also jeweils gesonderte Szenarien zu entwickeln und zu bewerten. Dabei empfiehlt sich vorab durchaus eine Einzelbewertung aller denkbaren Maßnahmen, um daraus die prinzipiell sinnvollen auszuwählen und nur damit Kombinationen zu bilden.
Wichtig ist der Hinweis, dass nur Maßnahmenkombinationen auszuwählen sind, die die Zielvorgaben (z.B. klimaneutrale Gebäude) erfüllen.
Vermiedener CO2-Ausstoß kann seit der Einführung des Emissionshandels direkt monetär bewertet werden. Entsprechende Zertifikate werden international gehandelt (https://www.eex.com/de/marktdaten/umweltprodukte/spot).
Die derzeitigen Preise der CO2- Zertifikate bilden allerdings noch nicht die zu erwartenden Klimafolgekosten ab. Es wird deshalb empfohlen, die gesellschaftlichen Kosten von Umweltbelastungen gemäß Berechnungen des Umweltbundesamtes in die Wirtschaftlichkeitsberechnungen einzubeziehen. Dieses Vorgehen ist in den einzelnen Verwaltungen haushaltsrechtlich abzustimmen.
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/gesellschaftliche-kosten-von-umweltbelastungen#klimakosten-von-treibhausgas-emissionen
Für eine 1-%-Zeitpräferenz (Höhergewichtung der Wohlfahrt der heutigen Generation gegenüber der Wohlfahrt künftiger Generationen) ergeben sich für das Jahr 2021 Kosten in Höhe von 237 Euro/t CO2. Für eine 0-%-Zeitpräferenz (Gleichgewichtig der Wohlfahrt der Generationen) ergeben sich für das gleiche Jahr Kosten in Höhe von 809 Euro/t CO2.
Tabelle 1: UBA-Empfehlung zu den Klimakosten
| UBA-Empfehlung zu den Klimakosten | ||||
| Klimakosten in Euro2022 pro Tonne Kohlendioxid | 2020 | 2022 | 2030 | 2050 |
| 1% reine Zeitpräferenzrate (Höhergewichtung der Wohlfahrt der heutigen Generation gegenüber der Wohlfahrt künftiger Generationen) | 228 | 237 | 241 | 286 |
| 0% reine Zeitpräferenzrate (Gleichgewichtung der Wohlfahrt der Generationen) | 792 | 809 | 791 | 865 |
Für den Strom sollte dabei - unabhängig davon, ob vertraglich Ökostrom bezogen wird - mit den aktuellen spezifischen Treibhausgas-Emissionen (CO2-Äquivalente) des deutschen Strommixes unter Berücksichtigung der Vorketten gerechnet werden. Diese werden vom Umweltbundesamt auf der folgenden Website veröffentlicht:
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/entwicklung-der-spezifischen-kohlendioxid-8
Für das Jahr 2022 ergibt sich danach ein vorläufiger Treibhausgas-Emissionsfaktor unter Berücksichtigung der Vorketten von 434 g CO2/kWh.
Für fossile Brennstoffe wurden ebenfalls Werte vom Umweltbundesamt veröffentlicht und auszugsweise in Anhang B aufgeführt:
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/co2-emissionsfaktoren-fuer-fossile-brennstoffe-0
Bei Fernwärme ist man auf die Angaben des örtlichen Lieferanten angewiesen. Diese sind jedoch immer kritisch zu hinterfragen. Emissionsfaktoren von 0 g CO2/kWh sind auch bei Müllverbrennungsanlagen nicht realistisch, da in der Praxis eine Stützfeuerung erfolgen muss. Bei Stromgutschriften sollten die Treibhausgasemissionen nicht alleine der Stromerzeugung zugerechnet, sondern exergetisch auf Strom und Wärme aufgeteilt werden.
Außerdem sollte bei Arealnetzen ein Mittelwert pro Stadt oder Region verwendet werden, da die Wärmenetze perspektivisch miteinander verbunden werden und Verbrauchseinsparungen unabhängig von den lokalen Emissionsfaktoren notwendig sind.
Fernwärme-Anbieter müssen Netzausbau- und Dekarbonisierungspläne erstellen. Ziel ist eine vollständige Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Daraus ergeben sich schrittweise sinkende Emissionsfaktoren. Für Wirtschaftlichkeitsberechnungen wird empfohlen, mit über den jeweiligen Betrachtungszeitraum gemittelten Emissionsfaktoren zu rechnen.
Sowohl die wirtschaftlichen als auch die ökologischen Aspekte sind bei einer Vielzahl denkbarer Maßnahmen möglichst einheitlich und einfach zu bewerten. Deshalb empfiehlt sich innerhalb einer Verwaltung die Vorgabe eines bestimmten Berechnungsverfahrens und allgemeiner Faktoren, wie Kapitalverzinsung, Kostensteigerung, CO2-Vermeidungskosten oder Umweltbonus und - nach Maßnahmenarten differenziert - Nutzungsdauer und ggf. Betriebskosten. Daraus können auch fertige (maßnahmenspezifische) Annuitäten- oder Barwertfaktoren ermittelt und einheitlich vorgegeben werden.
Das Energiemanagement der Stadt Frankfurt a.M. hat dazu ein Excel-Tool entwickelt:
https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de, Menüpunkt: Gesamtkostenberechnung
7.3 Eigenfinanzierung von Energiesparmaßnahmen, Intracting
Die Finanzierung der Energieeinsparmaßnahmen erfolgt im Regelfall über Baumittel oder den Bauunterhaltungshaushalt. Da diese Mittel vielfach nicht ausreichen, wird bisweilen auf alternative Finanzierungsmodelle zurückgegriffen.
Als eine Sonderform der Eigenfinanzierung kann das Landes- bzw. stadtinterne Contracting betrachtet werden, auch Intracting genannt. Als Contractor tritt hier in der Regel das Energiemanagement auf.
Dies kann geschehen, indem als Anschubfinanzierung ein zweckgebundenes Budget für Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung bereitgestellt wird. Die aus den hiermit realisierten Maßnahmen erzielten Kosteneinsparungen fließen aus dem Verwaltungshaushalt in den Fonds zurück.
Intracting ist eine elegante Form, das vorhandene Geld aus dem Verwaltungshaushalt für verbrauchsgebundene Kosten zur Bedienung kapitalgebundener Kosten umzuschichten.
Das Intracting eignet sich besonders für gering investive Maßnahmen aus dem Bereich des Energiemanagements und für die Abarbeitung von Maßnahmen aus Energiekonzepten. Die Maßnahmen müssen wirtschaftlich vertretbar sein, das heißt z.B. die Energiekosteneinsparung muss größer oder gleich der Annuität für die Investition sein.
Die Organisationseinheit des Energiemanagements soll die Haushaltsmittel eigenverantwortlich bewirtschaften und die eingesparten Energiekosten ohne neue Beantragung in die folgenden Haushaltsjahre übertragen können. Zur Minimierung des Transaktionsaufwandes für das interne Contracting sollten möglichst unkomplizierte Verfahren festgelegt werden (z.B. festgelegte Contracting-Rate unabhängig von Nutzungsänderungen, aktuellen Energiepreisen etc.).
Aus diesem Fonds ist, soweit die haushaltsrechtliche Voraussetzung vorliegt, der Anteil speziell für Energiesparmaßnahmen sowie die Mehraufwendungen für besonders energiesparende Ausführung bei ohnehin notwendigen Baumaßnahmen zu finanzieren. Notwendige Bauunterhaltungsaufgaben oder Sanierungsmaßnahmen sind häufig nicht durch Energiekosteneinsparungen refinanzierbar und sollten, wie in den folgenden Beispielen dargestellt, durch den laufenden Haushalt abgedeckt werden:
- Fassadensanierung
Kosten für Gerüsterstellung, Ausbesserung des Putzes, neuer Anstrich = Bauunterhalt.
Mehraufwendungen für zusätzliche Wärmedämmung = Energiesparmittel - Sanierung Heizungsanlage
Erneuerung Wärmeerzeuger und Heizungsverteilung = Bauunterhalt
Zusätzlicher Einbau Solaranlage mit Speicher = Energiesparmittel.
7.4 Anlagen-Contracting/Energieliefercontracting
Die am häufigsten angewandte Form des externen Contractings ist das Anlagen-Contracting, weil es am transparentesten und für beide Vertragsparteien leicht handhabbar ist. Es gibt - im Gegensatz zum Energiespar-Contracting - in der Regel wenig Interpretations- und Rechtfertigungsbedarf während der Vertragsdauer.
Beim Anlagen-Contracting, auch Energieliefer-Contracting genannt, plant, baut, finanziert und betreibt der Contractor technische Anlagen und Einrichtungen zur Energieversorgung und -bereitstellung und verkauft das Produkt, also Warmwasser (Heizenergie), Dampf, Kaltwasser (Kälte), Strom, Druckluft etc. an den Contractingnehmer.
Anlagen-Contracting kann sinnvoll sein für die Erneuerung geschlossener Anlagen, wenn diese sonst wegen fehlender Haushaltsmittel nicht oder erst wesentlich später realisierbar wäre, oder ausreichendes Betriebspersonal fehlt.
Der Contractingnehmer verpflichtet sich zur Zahlung eines Wärme-, Kälte- bzw. Strompreises, der sich aus einem Grundpreis, Arbeitspreis und Messpreis zusammensetzt.
Über den Grundpreis werden die kapital- und betriebsgebundenen Kosten wie Investitionen, Wartung, Versicherung, Verwaltung, und über den Arbeitspreis die verbrauchsgebundenen Kosten wie Brennstoffe, Strom und Hilfsstoffe verrechnet. Der Messpreis setzt sich aus den Kosten für die Zähler, Eichung und Abrechnung zusammen.
Ein möglicher Anwendungsfall des Anlagen-Contractings ist der Bau von Heiz- und Kältezentralen, Wärmepumpen, BHKW oder Photovoltaik-Anlagen. Die Anlage bleibt während der Vertragslaufzeit Eigentum des Contractors und wird nach Vertragsablauf wieder demontiert, oder kann ggf. vom Contractingnehmers übernommen werden. Die Vertragslaufzeit liegt in der Regel zwischen 10 (nach AVBFernwärmeV) und 20 Jahren (nach freier Vereinbarung).
Der Verfahrensablauf stellt sich wie folgt dar:
- Auswahl der Liegenschaften
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
- Ausschreibung, Angebotserstellung
- Wertung der Angebote
- Wirtschaftlichkeitsvergleich
- Abschluss Energieliefer-Vertrag oder Aufhebung der Ausschreibung
- Maßnahmenrealisierung
- Energielieferung
Das Anlagen-Contracting ist eine Lieferleistung und wird deshalb nach VgV ausgeschrieben. Für die Ausschreibung gelten die Schwellenwerte gemäß VgV, darüber muss europaweit ausgeschrieben werden. Die Zahlungen an den Contractor über eine Vertragslaufzeit von 10 bis 20 Jahren überschreiten in der Regel diesen Betrag.
Im Wirtschaftlichkeitsvergleich sind die Vollkosten der Eigenbesorgung (Planung, Bau und Betrieb) dem Wärme- bzw. Strompreis des Contracting gegenüberzustellen.
Eine Sonderform des Anlagencontractings sind sog."Bürgersolarkraftwerke". Hier werden von interessierten Bürgern, Projektentwicklungsgesellschaften oder Fachfirmen. z.B. auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen auf eigene Kosten errichtet. Von der öffentlichen Hand werden dabei nur die entsprechenden Dach- oder ggf. nicht nutzbare Freiflächen zur Verfügung gestellt. Die Refinanzierung erfolgt über die Einspeisevergütung, den Stromverkauf an die Gebäudenutzer oder sonstige Vermarktung. Grundvoraussetzung sind dabei klare vertragliche Regelungen bezüglich Prüfung und ggf. erforderlicher Ertüchtigung der Statik, Einbringung, Zugänglichkeit, Laufzeiten, Haftung, Wartung- und Instandsetzung sowie Vergütung.
7.5 Energiespar-Contracting
Beim Energiespar-Contracting (ESC) setzt ein Dritter (Contractor) auf eigenes Risiko privates Kapital und Knowhow zur Verbesserung des Energiemanagements sowie der bau- und anlagentechnischen Ausstattung von Gebäuden ein. Der Contractor übernimmt die Garantie, dass der Energieverbrauch bzw. die Energie- und sonstigen Betriebskosten während der Vertragslaufzeit in einem bestimmten Umfang reduziert werden. Für die Berechnung des Einsparerfolgs wird für den Vertragsgegenstand ein Energie-/ Betriebskosten-Referenzwert (Baseline) vereinbart. Die Investitionen des Contractors werden durch ersparte Energie- und sonstige Betriebskosten finanziert, d.h. der Contractor erhält eine Vergütung maximal in Höhe der tatsächlich erzielten Netto-Einsparung. Der Contractingnehmer wird in der Regel von Anfang an am Einsparerfolg beteiligt, z.B. mit 10%. Nach Ablauf des Vertrags bis zur Abnutzung der Anlagen hat der Contractingnehmer den vollen Nutzen der Einsparung. Die Vertragslaufzeit liegt zwischen 7 und 15 Jahren. Einschränkungen können sich aus den Haushaltsgesetzen der Länder ergeben.
Das Energiespar-Contracting befasst sich überwiegend mit folgenden Bereichen:
- Steuer- und regelungstechnische Anlagen
- Optimierung der vorhandenen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Erneuerung Beleuchtungsanlagen
- Erneuerung von Heizungs- und Lüftungsanlagen in begrenztem Umfang
Umfassende, allenfalls langfristig sich refinanzierende Sanierungsmaßnahmen sind hiermit meist nicht möglich, das Ziel klimaneutraler Gebäude ist deshalb hierüber in der Regel nicht zu erreichen.
Wegen des erheblichen organisatorischen Aufwands für das Verfahren sowohl auf Seiten des Auftraggebers wie der Bieter / Auftragnehmer muss für das Energiespar-Contracting ein Mindestvolumen erreicht werden. Dies liegt bei ca. 200.000 Euro/a für die Energiekosten-Baseline bei Einzelliegenschaften bzw. ca. 500.000 Euro/a für Gebäudepools.
Das Energiespar-Contracting ist eine gemischttypische Leistung. Es werden sowohl Bauleistungen als auch Dienst- und Lieferleistungen erbracht. In der Regel liegt beim Energiespar-Contracting der Schwerpunkt bei den investiven Maßnahmen. Dementsprechend ist die Ausschreibung nach VOB/A zu wählen. Es wird empfohlen, grundsätzlich europaweit auszuschreiben. Damit liegt man hinsichtlich des maßgebenden Schwellenwertes auf der sicheren Seite.
Der Wirtschaftlichkeitsvergleich ist zwischen dem Contracting-Angebot des preisgünstigsten Bieters und der Eigenbesorgung, soweit hierfür fachliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, zu erstellen. Sind die Contracting-Angebote unwirtschaftlich, kann die Ausschreibung aufgehoben werden. Ebenfalls zum Projektabbruch kann die Feinanalyse (2. Schritt im Verfahren, nach Zuschlag) führen, wenn sie das Ergebnis der Grobanalyse und damit das Angebot des Bieters nicht im Wesentlichen bestätigt.
Achtung: Finden während der Vertragslaufzeit bauliche Änderungen am Vertragsgegenstand statt oder verändert sich die Nutzung, so ist die Baseline anzupassen. Die Kalkulation solcher Anpassungen ist nicht immer einfach und häufig eine Verhandlungssache mit Konfliktpotenzial. ESC-Projekte sind deshalb durch den Auftraggeber mit gut qualifiziertem Personal intensiv zu begleiten.
Je nach Vertragsmodell übernimmt der Contractor die Betreiberverantwortung für die von ihm eingebauten bzw. veränderten Anlagen, nicht für den gesamten Gebäudebetrieb. Dadurch entstehen häufig Schnittstellenfragen bei Betriebsstörungen oder nutzungsbedingten Änderungsbedarfen. Das stellt z.B. in Bezug auf die Eigenversorgung bei KWK-Anlagen ein Risiko dar. Nach anderen Vertragsmodellen ist der Auftraggeber (Gebäudenutzer) auch bei Neuanlagen der Betreiber.
Weitere Informationen sind, dem Leitfaden der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu entnehmen.
https://www.kompetenzzentrum-contracting.de/umsetzungshilfen/dena-publikationen/leitfaden-energiespar-contracting/
7.6 Energiewirtschaftliche Vorgaben für PPP-Projekte
Unter dem Begriff Public Private Partnership (PPP), im Deutschen öffentlichprivate Partnerschaft (ÖPP), wird in Anlehnung an das PPP-Handbuch des BMVBS 4 die "langfristige, organisatorisch und vertraglich geregelte Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Partnern zum Zwecke der Realisierung eines oder mehrerer öffentlicher Bauvorhaben" verstanden.
PPP-Projekte können in unterschiedlicher Form realisiert und für eine zeitlich befristete Zusammenarbeit vertraglich vereinbart werden. Dabei werden Aufgaben im Rahmen der Planung, der Finanzierung, des Baus sowie des Betriebes und der Verwertung von Bauwerken übernommen. Unter diesen Begriff fallen auch Contracting-Projekte.
Kennzeichnend für alle PPP-Verfahren ist die Betrachtung der gesamten Lebenszykluskosten eines Gebäudes. Die Betriebsphase ist somit in die Betrachtung integriert (wirtschaftliche Gesamtbetrachtung im Sinne einer Lebenszykluskostenbetrachtung). Dadurch sind die Voraussetzungen für die Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen vorhanden, sofern diese mit Kosteneinsparungen verbunden sind. Diese Kosteneinsparungen können der finanzielle Anreiz für den privaten Partner sein und sollten daher im Rahmen der Vertragsgestaltung geregelt werden.
Grundsätzlich sollten gleiche technische Standards wie für konventionell geplante/realisierte Gebäude gelten. Außerdem sollten gedeckelte Energieverbräuche, ggf. mit Nutzungskorrekturoption, vereinbart werden.
Das Energiepreisrisiko bleibt jedoch beim Auftraggeber. Wenn der Energieeinkauf durch den Auftragnehmer erfolgt, dann sind entsprechende Preisgleitklauseln zu vereinbaren.
Neben den finanziellen Anreizen und wirtschaftlichen Interessen des privaten Partners gibt es Möglichkeiten, bestimmte Standards in einem PPP-Projekt festzuschreiben bzw. spezielle Anforderungen zu formulieren. Je nach geforderter Zielvorstellung (Funktionserhalt, Werterhalt, Wertsteigerung), können für die Projektlaufzeit Anpassungen festgelegt werden wie
- Schaffung von Anreizen zur Energieeinsparung: Bonuszahlungen in Abhängigkeit von Energieverbrauch/Kosten
- Festlegung von anteiligen Energiebudgets (z.B. zur Kompensation von Preissteigerungen), die bei Nichtabruf (z.B. aufgrund von Energieeinsparungen) für andere Zwecke verwendet werden können (Ausschüttungen sowohl an die Nutzer, den öffentlichen als auch den privaten Partner)
Die vertraglichen Regelungen der genannten Punkte ermöglicht es, die Vorteile einer lebenszyklusorientierten Betrachtung im Hinblick auf einen energieeffizienten Betrieb auszunutzen. Wegen der zahlreichen Schnittstellen zur Nutzung sind PPP-Verträge jedoch aufwändig in der Umsetzung und führen häufig zu Konflikten. Zahlreiche Projekte enden spätestens beim Ablauf der Laufzeit vor Gericht.
7.7 Fördermittel
Wenn bei der Sanierung bzw. beim Neubau von Gebäuden energiesparende Maßnahmen Berücksichtigung finden, können hierfür zum Teil erhebliche Förderungen in Anspruch genommen werden. Für Kommunen sind mehr Programme zugänglich als für die Länder. Die Inanspruchnahme ist durch Haushaltsordnungen oft mehr oder weniger verpflichtend. Allerdings sind Förderungen innerhalb der öffentlichen Hand volkswirtschaftlich diskutabel, da ein Transaktionsaufwand auf beiden Seiten zur rechtssicheren Abwicklung der Förderung entsteht und letztlich nur Geld zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen verschoben wird.
Zum Teil gibt es komplizierte und langwierige Antrags- und Nachweisverfahren, deren Aufwand so hoch sein kann, dass die Inanspruchnahme kaum noch lohnend ist. Außerdem ist der Erfolg der Antragstellung durch Programmänderungen und durch begrenzte Förderbudgets nur bedingt berechenbar.
Hilfreich wären langfristig gleichbleibende, zuverlässig finanzierte Programme mit einfachen Regeln, z.B. Pauschalsummen pro m2 sanierte Bauteilfläche.
Neben direkten finanziellen Zuschüsse und zinsverbilligten Krediten gibt es auch kostenlose Beratungsangebote. Als Fördergeber kommen in Frage:
- Europäische Union
- Bund, insbesondere BMWK, BMUV, BMBF, BMWSB, KfW, BAFA
- Länder
- Kommunen
- Energieversorgungsunternehmen
- Stiftungen, z.B. Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Die Programme können dabei folgende Ziele verfolgen:
- Forschungsförderung für die Entwicklung innovativer Technologien und deren Einsatz in Pilot- und Demonstrationsprojekten,
- Programme zur Markteinführung von Technologien, die am Anfang der kommerziellen Verbreitung stehen,
- allgemeine Förderung von Klimaschutz und Energieeinsparung.
Sowohl die Anzahl der Fördergeber wie auch die sehr schnell wechselnden Fördermodalitäten lassen es nicht zu, an dieser Stelle einen längerfristig gültigen Überblick zu geben.
Für Kommunen ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit den Programmteilen Nichtwohngebäude (BEG NWG) und Einzelmaßnahmen (BEG EM) interessant und sollte bei jeder Gebäudesanierung in Betracht gezogen werden. Nicht antragsberechtigt sind der Bund, die Bundesländer und deren Einrichtungen.
Im Folgenden wird auf die Institutionen verwiesen, die direkt als Fördermittelgeber fungieren oder durch Hinweise auf Fördermöglichkeiten weiterhelfen:
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html - Kreditanstalt für Wiederaufbau
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/ - Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html - Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie - Service- und Kompetenzzentrum:
Kommunaler Klimaschutz
https://www.klimaschutz.de/de/beratung/das-angebot-des-skkk
Neben den hier genannten Institutionen fördern regional begrenzt auch einige Kommunen selbst oder örtliche Energieversorgungsunternehmen Maßnahmen zur Energieeinsparung.
| Begriffe im Energiemanagement | Anhang A |
Benchmarking
Unter Benchmarking ist hier der energetische Vergleich mit anderen Objekten auf der Basis von Kennzahlen zu verstehen.
Brennwert
Der Brennwert (oder obere Heizwert Hs) bezeichnet die bei einer Verbrennung maximal nutzbare Wärmemenge, einschließlich des Energiegewinns aus der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes
CO2-frei
Prozess ohne Emissionen von CO2, dem bedeutendste Treibhausgas (' Treibhausgasneutral), das im Wesentlichen bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht; unterschiedliche Definitionen in der Einbeziehung von Vorketten sind möglich
CO2-neutral
Prozesse, die CO2-frei sind oder deren CO2-Emissionen durch Gutschrift von CO2-Bindung kompensiert werden, wie bei der Nutzung von Biomasse
Dekarbonisierung
Reduzierung bzw. Abschaffung der Verbrennung von Kohlenstoffverbindungen, d.h. hier fossiler Brennstoffe
Energiebedarfskennwert
Der Energiebedarfskennwert ist das Verhältnis des rechnerisch ermittelten Energiebedarfs eines Gebäudes inkl. der Verluste durch Übergabe, Verteilung und Umwandlung von Energie zur erbrachten Energiedienstleistung (vereinfacht in der Regel Gebäudefläche). Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind dazu normierte Verfahren festgelegt.
Energiecontrolling
Unter Energiecontrolling ist die Anwendung der Methoden des Controllings auf die Betriebsphase des Prozesses der Energiebereitstellung, -verteilung und -anwendung im Gebäude oder einer Liegenschaft zu verstehen.
Grundbestandteil des Energiecontrollings ist das Monitoring als permanenter Soll-/ Ist-Vergleich von Verbrauchswerten und Kosten.
Energiedienstleistung
Die Energiedienstleistung ist die Bereitstellung einer energetisch relevanten Dienstleistung, wie z.B. ausreichend temperierte Nutzfläche, beleuchteter Raum etc.
Energiekonzept
Ein Energiekonzept ist das Ergebnis einer Untersuchung, in welcher - im Sanierungsfall ausgehend von einer Analyse des Ist-Zustandes - eine optimale Lösung für Energieeinsparungen und die Energieversorgung eines Gebäudes / einer Liegenschaft, einer öffentlichen Einrichtung oder eines Unternehmens beschrieben wird.
Es umfasst alle Maßnahmen des Energiemanagements.
Es dient als Entscheidungsgrundlage und Handlungsanleitung für das weitere Vorgehen.
Energiemanagement
Energiemanagement ist der ganzheitliche Prozess zur Steuerung eines effizienten Energieeinsatzes.
Wesentliche Aufgabengebiete sind hierbei die Beschaffung von Energieträgern (Strom, Wärme, Brennstoffe) und die Verbrauchserfassung und -auswertung sowie die Sensibilisierung des Nutzerverhaltens.
Energieverbrauchskennwert
Der Energieverbrauchskennwert ist das Verhältnis des im Betrieb tatsächlich gemessenem Energieaufwandes zur erbrachten Energiedienstleistung (vereinfacht in der Regel Gebäudefläche)
Energievergleichskennwert
Energievergleichskennwerte werden nach statistischen Rechenverfahren aus einer Vielzahl Energieverbrauchskennwerten für unterschiedliche Gebäudearten und -gruppen gebildet.
Erneuerbare Energie
Erneuerbare Energie, auch regenerative Energie genannt, bezeichnet Energie aus nachhaltigen Quellen, die sich laufend erneuern (Sonnenlicht u. -wärme, Windenergie, Erdwärme, Biomasse, Wasserkraft), und damit nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich sind.
Energieversorgungsunternehmen (EVU)
Energieversorgungsunternehmen sind Versorgungsunternehmen, die andere Unternehmen und Letztverbraucher als Erzeuger oder Verteiler mit Energie versorgen.
Betriebszweck von Energieversorgungsunternehmen ist die Beschaffung und/oder Erzeugung von Energie (elektrischer Strom, Erdgas, Fernwärme, Flüssiggas, Nahwärme) sowie Trinkwasser und deren Vertrieb.
Gradtagzahl
Die Gradtagzahl (GTZ) ist ein Maß für den Wärmebedarf eines Gebäudes während der Heizperiode mit der Einheit [K*d/a]. Die GTZ ist die Summe aus den der Differenzen zwischen der gewünschten Raumtemperatur und dem Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur.
Die Gradtagzahl (ortsabhängig) wird gemessen, sobald die Außentemperatur unter der Heizgrenze liegt.
Nach der VDI 3807 und VDI 2067 wird mit einer Raumtemperatur von 20 °C und einer Heizgrenze von 15 °C gerechnet (GTZ 20/15)
Heizwert
Der Heizwert (genauer auch unterer Heizwert Hi) bezeichnet die bei einer Verbrennung maximal nutzbare Wärmemenge, ohne Berücksichtigung des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes.
Kalte Wärmenetze
Kalte Nahwärme bzw. Kalte Fernwärme ist eine technische Variante eines Versorgungsnetzes, das mit niedrigen Übertragungstemperaturen in der Nähe der Umgebungstemperatur arbeitet (etwa im Bereich 5 bis 35°C, meist zwischen 10 und 25°C) und daher sowohl Wärme als auch Kälte bereitstellen kann.
Sie können von einer Vielzahl häufig regenerativer Wärmequellen und Abwärme gespeist werden.
Da die Betriebstemperaturen nicht ausreichend sind für die direkte Warmwasser- und Heizwärmeproduktion, wird die Temperatur beim Abnehmer mittels Wärmepumpen auf das erforderliche Niveau angehoben.
Auf die gleiche Art und Weise kann auch Kälte produziert werden und die Abwärme ins Wärmenetz zurückgespeist werden.
Klima-neutral
In Summe wird das Klima nicht beeinflusst. Über die → Treibhausgasneutralität hinaus können weitere Aspekte Einfluss auf das Klima haben, etwa durch Albedoänderungen oder Veränderungen der Wolkenbedeckung durch den Luftverkehr
Klimafolgekosten
Die durch die Emission von Treibhausgas verursachte Klimaveränderung verursacht Schäden, die monetär bewertet werden können. (Siehe Abschnitt 7.2)
Messstellenbetreiber
Der Messstellenbetreiber ist nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) für den Messstellenbetrieb zuständig, also für den Einbau, die Wartung und die Ablesung von Messgeräten bei Endverbrauchern.
Treibhausgasneutral
Neben CO2 (→ CO2-neutral) werden weitere Treibhausgase (THG) berücksichtigt, die zur Erwärmung der Erdatmosphäre beitragen, wie Methan (CH4), Stickstoffoxide, fluorierte Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid (SF6); siehe § 3 Nummer 16 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes.
Da CO2 das bedeutendste Treibhausgas ist, werden THG-Emissionen in der Regel als CO2-Äquivalente (CO2Äqui) zusammengefasst.
Verteilnetzbetreiber
Ein Verteilnetzbetreiber ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ein Unternehmen, das Strom-, bzw. Gasnetze zur Verteilung an Endverbraucher betreibt.
| Kennwerte zur Energieverbrauchsauswertung | Anhang B |
B1 - Heiz- und Brennwert sowie CO2-Emissionsfaktoren von Energieträgern
|
Endenergieträger |
Mengeneinheit |
Heizwert Hi |
Brennwert Hs |
CO2-Faktor |
| Leichtes Heizöl EL | Liter | 10 kWh/Liter | 10,6 kWh/Liter | 266 g/kWh |
| Erdgas H | m3 | 9,8 kWh/m3 | 11 kWh/m3 | 201 g/kWh |
| Erdgas L | m3 | 8,9 kWh/m3 | 9,8 kWh/m3 | 201 g/kWh |
| Flüssiggas | kg | 12,8 kWh/kg | 14 kWh/kg | 239 g/kWh |
| Stückholz (lufttrocken) | kg | 4,1 kWh/kg | ||
| Holzpellets | kg | 5 kWh/kg | ||
| Holzhackschnitzel | Srm | 650 kWh/Srm |
(Srm = Schüttraummeter)
Quelle z.B: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Informationsblatt CO2-Faktoren
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_infoblatt_co2_faktoren2022.pdf?_blob=publicationFile&v=5
B2 - Orientierungswerte für Benutzungszeiten
Vollbenutzungsstunden bzw. Jahresbenutzungsstunden beschreiben das Verhältnis von Jahresverbrauch zur Anschlussleistung. Die Orientierungswerte ermöglichen
- bei Neubauten die Abschätzung zu erwartender Verbräuche auf Grundlage der Planungswerte
- bei Bestandsobjekten die Überprüfung der Anschlusswerte auf Grundlage der gemessenen Verbräuche
|
Gebäudeart |
Vollbenutzungsstunden Heizung |
Jahresbenutzungsstunden Strom (h/a) |
| Verwaltungsgebäude | 1.800 - 2400 | 1.500 - 3.000 |
| Hochschulinstitute | 2.000 - 3000 | 2.000 - 5.000 |
| Krankenhäuser | 2.000 - 3000 | 4.000 - 5.000 |
| Schulen | 1.000 - 1.800 | 800 - 2.400 |
| Sportbauten | 1.200 - 2.000 | 1.500 - 2.500 |
Die Werte sind abhängig von der objektspezifischen Nutzungsweise und technischen Ausstattung. In der Regel erreichen größere Gebäudeeinheiten höhere Werte als kleinere Gebäude. Sie beziehen sich auf sinnvoll dimensionierte Anlagen. Bestandsanlagen sind oft deutlich überdimensioniert, die Benutzungsstunden dann niedriger. Die tatsächlich in Anspruch genommene Bezugsleistung liegt in der Regel unter der Anschlussleistung, auf die - ggf. messbare - Bezugsleistung bezogene Benutzungsstunden also höher als die Tabellenwerte.
| Maßnahmen zur Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs | Anhang C |
Die Liste möglicher Maßnahmen ist gegliedert nach den Kostengruppen der DIN 276 und nach
- Betriebliche Maßnahmen,
- investive Maßnahmen
sowie zusätzlich
- Organisatorische Maßnahmen
Die im folgenden genannten Maßnahmen müssen in jedem Einzelfall fachlich und wirtschaftlich geprüft werden. Nicht jede Maßnahme ist in jedem Gebäude bzw. technischer Anlage anwendbar bzw. sinnvoll. Die Maßnahmenliste eignet sich bei der Suche nach energiesparenden Maßnahmen zur Verwendung als Checkliste, ist jedoch nicht als abschließender Maßnahmenkatalog, sondern nur als " Anregung" zu verstehen.
Anhang C - Maßnahmenliste
30 - Bauwerk
Betriebliche Maßnahmen
- Überprüfen der Funktion von Türschließern, Türöffnern und der Notwendigkeit von Türfeststellern
- Überprüfen der Sonnenschutzanlagen auf einwandfreie Funktion (Energieeinsparung bei Klimaanlagen)
- Sonnenschutzeinrichtungen rechtzeitig betätigen, um im Sommer ein unerwünschtes Aufheizen der Räume durch Sonneneinstrahlung zu verringern und im Winter die passive Solarenergie zu nutzen
- Nach Dienstschluss alle Fenster fest schließen
Investive Maßnahmen
- Einbau besser wärmegedämmter Fenster und Türen
- Nachträgliches Abdichten von Fenster- und Baufugen
- Nachträgliche Dämmung von Dächern, obersten Geschoss- und Kellerdecken
- Dämmung der Außenwände / Fassadensanierung
- Beseitigung von Mängeln an der Dämmung (Kältebrücken)
- Dämmen von Heizkörpernischen
- Einbau von Türschließanlagen
- Einbau von Windfängen
- Einbau von Sonnenschutzanlagen für Gebäude mit Klimaanlagen
- Innenliegender Blendschutz für Wärmegewinn im Winter bei Sonnenschein, als Ergänzung zu Außen-Jalousien
41- Abwasser- /Wasser- /Gasanlagen
Betriebliche Maßnahmen
- Regelmäßige Überprüfung der Wasserentnahmestellen (Inspektions- und Wartungsmaßnahmen nach VDI 3810), wie z.B. bei WC-, Waschbecken- und Duschanlagen auf Undichtigkeiten
- Reduzieren der Wasserspülmengen bei WC-Spülkästen *)
(6 Liter, sofern die Becken dafür geeignet sind) - Schüttleistung von Duschen überprüfen, gegebenenfalls Einbau von Durchflussbegrenzern veranlassen. *)
- Überprüfen der Zeitselbstschlußventile im Hinblick auf eine Mengenreduzierung des Duschwassers (Duschen 25 Sekunden, Waschtische 10 Sekunden) *)
- Abstellen automatischer Spüleinrichtungen von Urinalanlagen außerhalb der Nutzungszeiten *)
- Außerbetriebnehmen von nicht benötigten Duschen, Waschbecken, sonstigen Trinkwasserentnahmestellen, z.B. Zapfhähnen *)
- Instandhaltung von Rohrleitungsdämmungen
Investive Maßnahmen
- Einbau von Brauseköpfen mit geringer Schüttleistung (6 Liter / Minute) *)
- Einbau von Durchflussbegrenzern, z.B. Sparperlatoren mit konstantem Durchfluss *) (Handwascharmaturen 5 Liter / Minute)
- Einbau von Zeitselbstschlußventilen (bei hoher Benutzerfrequenz)
- Einbau von berührungslosen, elektronisch gesteuerten Armaturen, deren Funktion auslesbar sein sollte
- Einbau von Duschautomaten mit Wertmarken (bei häufiger Fremdnutzung)
- Bei Neuplanungen oder größeren Sanierungsarbeiten Einbau eines Wassermanagementsystems (als Insellösung oder GA-vernetzt)
- Spülwasser aus Hygienespüllungen einer Zweitnutzung zuführen
- Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Außenanlagen
- Nutzung von Regenwasser für die WC-Spülung
- Freiflächengestaltung so ausführen, dass eine intensive Bewässerung vermieden wird
- Bei nur geringem Warmwasserbedarf oder größeren Abständen zur zentralen Warmwasserbereitung, Warmwasser dezentral über Elektrospeichergeräte oder -Durchlauferhitzer bereitstellen
- Einsatz wasserloser Urinale
- Nachrüstung von Rohrleitungsdämmungen
*) Bemerkung: Unter Berücksichtigung der Trinkwasserhygiene!
Bei der Reduzierung der Entnahmemengen ist auf die noch DIN-gerechte Dimensionierung des Rohrnetzes zu achten. Die aus der Reduzierung folgende Überdimensionierung des Rohrnetzes kann zu höheren Verweilzeiten des Trinkwassers bzw. zur Stagnation mit den daraus resultierenden hygienischen Problemen führen. Bei Nichtnutzung von Zapfstellen oder länger andauernde Außerbetriebnahme ist auf den vollständigen, totraumfreien Rückbau der Rohrleitungen zu achten (beachte DIN 1988 / DVGW-Arbeitsblatt 551).
42- Wärmeversorgungsanlagen
Betriebliche Maßnahmen
- Zeitlich definierte Verbrauchskontrollen (dynamischer Soll/Ist - Vergleich)
- Überwachung der Gebäude auf Einhaltung der vorgegebenen Raumtemperaturen (Werte siehe [2])
- Anpassen der Regelkurven an die Gebäudephysik (iterativer Prozess) und regelmäßige Kontrolle der Einstellwerte - ggf. Nachrüsten von Raumtemperaturfühlern
- Thermostatventile auf die vorgegebene Raumtemperatur begrenzen; Einstellung in Abständen überprüfen
- Nutzungsgerechte Einstellung und Überwachung der zentralen Regelanlagen
(Nacht-, Wochenendabsenkung oder Abschaltung/Absenkung bis zu mehreren Stunden vor Nutzungsende) - Die Zeiten der Nachtabsenkung/-abschaltung sind den Gebäudenutzungszeiten anzupassen und zu optimieren. (siehe Anlagenoptimierung)
- Bei zentralen Wärmeversorgungsanalgen für mehrere Gebäude ist zu prüfen ob sich ein zeitversetztes Einschalten des Normalbetriebs positiv auf die Spitzenlast der Wärmeerzeugung auswirkt
- In Übergangszeiten bzw. bei Außentemperaturen von über 5 °C (Frostsicherung) empfiehlt sich ein Abschalten der Heizungsanlage einschließlich aller elektrischer Antriebe außerhalb der Gebäudenutzungszeiten
- Während der Übergangszeiten ggf. nur kurzzeitiger Heizbetrieb
- Außerbetriebnahme der Heizungsanlagen bei Nutzungspausen unter Beachtung der Frostsicherung (z.B. Schulgebäude während der Ferien)
- Beginn und Ende der Heizperiode witterungs- und gebäudeabhängig festlegen und überwachen
- Abschalten bzw. Einschränken der Beheizung in untergeordneten bzw. nicht genutzten Räumen
- Bei Mehrkesselanlagen nur die erforderliche Wärmeerzeugerleistung bzw. Anzahl Kessel betreiben (Vermeidung von Betriebsbereitschaftsverlusten), dabei sind Wärmeerzeuger mit den niedrigsten Emissionen zu bevorzugen; nicht benötigte Kessel sind wasserseitig abzusperren
- Fenster und Türen, die nach außen bzw. zu nicht beheizten Bereichen führen, während des Heizbetriebes geschlossen halten
- Für die sogenannte Stoßlüftung sind die Fenster nur kurzzeitig und möglichst ganz zu öffnen, Heizkörperventile während der Stoßlüftung schließen
- Heizkörper nicht durch Möbel, Vorhänge oder ähnliches zustellen
- Hydraulischer Abgleich der Wärmeverteilungsnetze und falls technisch möglich auch an den Heizkörpern
- Instandhaltung von Rohrleitungsdämmungen
Bei den folgenden Maßnahmen sind auch die DVGW - Richtlinien insbesondere Hygienevorschriften zu beachten:
- Abschalten der Wassererwärmungsanlagen bei längeren Betriebspausen während der Ferien bzw. an Wochenenden
- Außerbetriebnahme der Warmwasserzirkulation außerhalb der Nutzungszeiten
- Anpassung der Speicherkapazität an den tatsächlichen Verbrauch durch Außerbetriebnehmen nicht benötigter Speicher
- Übertragungsverluste durch Reinigung der Wärmeübertragerflächen /Kesselreinigung (in Wärmeübertragern und Heizungskesseln) reduzieren
- Bei Fernwärmeanschlüssen das Anlagenverhalten auf Spitzenleistung überprüfen und wenn möglich Maßnahmen erarbeiten um diese zu glätten. Dadurch kann ein niedriger Leistungspreis entstehen
- Umwälzpumpen für Vorheiz-(VHK), Kühl- und Wärmerückgewinnungs(WRG)-Kreise nur laufen lassen, wenn diese Regelkreise angefordert werden. Bei tiefen Außentemperaturen muss u. U. der VHK-Kreis zirkulieren, um Frostschäden zu verhindern
Investive Maßnahmen
- Nachrüstung von Rohrleitungsdämmungen
- Einbau von Messeinrichtungen zur Überwachung des Energieverbrauchs (Betriebsstundenzähler, Abgastemperaturmessung, Wasserzähler für Warmwasserbereitung u.a.)
- Einbau von Einrichtungen zur Verringerung der Betriebsbereitschaftsverluste der Wärmeerzeuger (wasser- und rauchgasseitig absperren)
- Anpassung der Wärmeerzeugerleistung an den jeweiligen Wärmebedarf des Gebäudes und für Warmwasserbereitung (Kesselgröße, Anzahl der Kessel, Sommerkessel)
- Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in die Abgasführung
- Erneuerung unwirtschaftlicher Kesselanlagen (Einbau von Wärmepumpen oder Anschluss an Wärmenetz)
- Umstellung bzw. Änderung der Versorgungsart (Fernwärme, regenerative Energien)
- Nachrüsten von besonderen Wärmegewinnungsanlagen (z.B. Wärmepumpen)
- Wenn noch Gas eingesetzt wird, KWK - Lösungen vorsehen
- Verringerung des Hilfsenergieaufwandes durch geregelte Hocheffizienz-Pumpen
- Bei sehr großen Anlagen die Brauchwassererwärmung nicht an den Heizkessel anschließen sondern an einen deutlich kleineren Wärmeerzeuger, welcher dann z.B. als Speicherladesystem mit einem sehr hohen Wirkungsgrad betrieben wird. Der große Kessel ist dann komplett im Sommer oder in nutzungsfreien Zeiten ausgeschaltet
- Verbesserung der Wärmedämmung von Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen sowie von Apparaten und Armaturen
- Entkoppelung von Heizungs- und Wirtschaftswärme (z.B. Küche, Wäschereien)
- Thermostatventile mit einstellbarer oberer Begrenzung einsetzen
- Schaffen zusätzlicher, nach der Gebäudenutzung und Himmelsrichtungen orientierter Heizkreise einschl. Regelkreise
- Ersatz veralteter Regelanlagen durch moderne Gebäudeautomation
- Einbau von Zonen- bzw. Einzelraumtemperaturregelungen (fernsteuerbare Einzelraumregelanlagen, Thermostatventile)
- Einbau von Raumtemperaturfühlern in Referenzräumen zur bedarfsgerechten Steuerung einzelner Heizkreise
- Einbau von Heizungs-Optimierungssystemen
- Bei Fernwärmeanschlüssen Speicherladesysteme anstelle von normalen Speicher- oder Durchlaufsystemen vorsehen
- Bei Verwaltungs-, Lehr-, Behördengebäuden oder -Liegenschaften bewohnte Bereiche (z.B. für Hausmeister) mit eigener, kleinerer Heizungsanlage oder separat regelbarem Heizkreis ausstatten, anstatt die gesamte Heizung des Gebäudes / der Liegenschaft in der arbeitsfreien Zeit zu regeln und zu betreiben
43- Lufttechnische Anlagen
Betriebliche Maßnahmen
- RLT - Anlagen an die jeweilige Nutzung anpassen (z.B. Personenbelegung, Außentemperatur, Luftfeuchte)
- RLT-Betrieb mit WRG nur in der Heizperiode, im Sommer Fensterlüftung
- Evtl. RLT-Nutzung zur Nachtauskühlung
- Reduzierung der Außenluftrate bei extrem hohen Außentemperaturen (bei Kühlbetrieb) und extrem niedrigen Außentemperaturen (bei Heizbetrieb)
- Aufheizung von Räumen mit Luftheizung nur im Umluftbetrieb, Aufheizung von Räumen mit stationärer Grundheizung ohne RLT - Anlagen
- Soweit die Nutzung es zulässt und keine bessere Regelungsmöglichkeit gegeben ist, intermittierender Betrieb der RLT - Anlagen
- Filter rechtzeitig reinigen bzw. wechseln (Minimierung der Druckverluste und damit des Stromverbrauchs)
- Nutzungsgerechte Einstellung und Überwachung der RLT - Regelanlagen
- Be- bzw. Entfeuchtung weitgehend reduzieren; Bereich der relativen Feuchte zwischen 30 % und 65 % voll ausschöpfen
- Kein Kühlbetrieb bei Raumtemperaturen unterhalb 26°C (Ausnahmen bei Gebäuden mit besonderer Nutzung beachten). Darüber gleitend mit der Außentemperatur (z.B. Raumsolltemperatur 3°C unter der Außentemperatur)
- An sonnigen Sommertagen außenliegenden Sonnenschutz schließen, auf der Ostseite der Gebäude wegen morgendlicher Sonneneinstrahlung auch nachts - möglichen Windeinfluss beachten
- Durch Sonneneinstrahlung aufgewärmte Räume durch Querlüftung herunterkühlen (freie Kühlung)
- Durch Sonneneinstrahlung aufgewärmte, ungenutzte Dachräume durchlüften
Investive Maßnahmen
- Einbau von Einrichtungen zur Anpassung der Luftleistung an den jeweiligen Bedarf (Drehzahlregelung, Schaufelradverstellung der Ventilatoren u. a.)
- Kanalsystemteile mit zu hohem Druckverlust ermitteln und gegen strömungsgünstigere Kanalteile ersetzen (gehen in dritter Potenz in den Stromverbrauch ein)
- Verbesserung der Regel- und Steueranlagen zur nutzungsgerechten Anpassung des Betriebes (variable Außenluftraten bzw. Umluftmengen, Einzelraumabschaltungen)
- bedarfsgerechte Steuerung durch ständige Messung der Raumluftqualität, CO2-Gehalt, Raumluftfeuchte, (dadurch Reduzierung der Luftwechselraten auf ein notwendiges Minimum)
- Enthalpieregelungen für Umluft-/ Außenluftbetrieb vorsehen
- Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen
- Einbau von Zeitschaltuhren zur Begrenzung der Betriebszeiten
- Umbau von RLT - Anlagen auf gleitende Be- und Entfeuchtung; wenn möglich auf Befeuchtung verzichten
- Entfeuchtungsregelkreise mit zwei Sollwerten betreiben. Der Niedrige für die Befeuchtung, der höhere für die Entfeuchtung. Beispiel erst < 35 % r.F. befeuchten und > 65 % r.F. entfeuchten. Temperierung analog
- Instandhalten und ggf. Verbesserung der Kanalisolierung
- Direkte Abführung und Nutzung innerer Wärmelasten (z.B. Abluftleuchten, Pausmaschinen, Großrechnern)
- Installation von Kältespeichern zur Laufzeitglättung von Kälteerzeugern bzw. Verlagerung der Erzeugerzeiten in Stromüberschusszeiten
- Einsatz alternativer Kälteerzeugungstechnologien, z.B. adiabate Kühlung
- Verwendung von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial
- Austausch veralteter Motoren und Ventilatoren gegen neue Systeme mit höchsten Wirkungsgraden
- Bei Ventilatorantrieben Keilriemen gegen Flachriemen austauschen
- Bei neuen oder zu erneuernden Kanälen die Leckluftraten begrenzen.
- Bei hohen Räumen die Temperaturfühler für die Raumtemperaturregelung nicht in den Abluftkanälen einbauen, sondern im Raum im einzuhaltenden Bereich (ca. 1,5 m bis 2,0 m) Temperaturfühler positionieren
44- Starkstromanlagen
Betriebliche Maßnahmen
- Für den Betrieb von Beleuchtungsanlagen siehe AMEV-Beleuchtung
- Abschalten der Beleuchtung in nicht bzw. vorübergehend nicht genutzten Räumen
- Bei ausreichendem Tageslicht Beleuchtung abschalten
- Bei eingeschränktem Tageslicht zunächst einzelne Leuchtenreihen zuschalten
- Es empfiehlt sich - falls technische Voraussetzungen vorhanden - eine Schalterkennzeichnung: Wand - Mitte - Fenster
- Defekte Lampen durch LED ersetzen
- Einschränkung von Gebäudeanstrahlungen
- Reinigungsbeleuchtung nur im momentanen Arbeitsbereich einschalten
- Benutzungsverbot für zusätzliche elektrische Heizgeräte (z.B. Heizlüfter), soweit nicht aus besonderen betrieblichen Gründen notwendig
- Benutzungsverbot privater elektrischer Geräte (z.B. Kühlschränke, Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschinen)
- Abschalten von elektrisch betriebenen Geräten bei Nutzungsunterbrechung
- Teeküchenausstattung vernünftig betreiben (z.B. Kaffeemaschine nach dem Kaffee kochen ausschalten)
- Einschaltzeiten von elektrischen Geräten (z.B. Kopierer) auf das notwendige Maß reduzieren. Dauerbetrieb, auch im standby-Betrieb, vermeiden
- Geräte mit hoher Leistungsaufnahme möglichst nicht in Zeiten der Spitzenlast bzw. hoher Tarife betreiben (z.B. Brennöfen in Schulen)
- Für beide vg. Maßnahmen ggf. Zeitschaltuhren einsetzen oder Schaltungen über GA realisieren
- Kühlgeräte auf die tatsächlich benötigte Temperatur einstellen
- Nicht (mehr) benötigte Geräte sollten stillgesetzt, ausgesondert oder vom Leitungsnetz getrennt werden
- Bei Beschaffung von Geräten den Energieverbrauch beachten
- Überprüfen der Nennleistung von Elektromotoren im Hinblick auf den tatsächlich erforderlichen Bedarf, gegebenenfalls Austausch veranlassen (Überdimensionierung vermeiden)
- Kontrolle der automatisch geregelten Blindstromkompensationsanlagen
- Betrieb parallel arbeitender Transformatoren im Bereich ihres günstigsten Gesamtwirkungsgrad (z.B. sollte bei zwei gleich großen Transformatoren beim Erreichen von 60 % der Nennlast eines Transformators der zweite Transformator zugeschaltet werden)
- Steckdosen mit Ausschalter ausschalten
Investive Maßnahmen
- Nachrüstung von Photovoltaikanlagen
- Für die Errichtung von Beleuchtungsanlagen siehe AMEV-Beleuchtung
- Freiflächengestaltung so ausführen, dass die Beleuchtung von Plätzen minimiert wird
- Einbau von zonenweisen Schaltungen bei Beleuchtungsanlagen (zum Beispiel Büros u.a.)
- Einbau von zweistufigen Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (Trainings/-Wettkampfbeleuchtung Putzbeleuchtung, Durchgangsbeleuchtung)
- Einbau von helligkeitsabhängigen Abschalteinrichtungen
- Einbau von Zeitschaltuhren und /oder Präsenzmeldern zur Beleuchtungssteuerung (Flure, Turn- und Sporthallen WC, Duschen)
- Einbau von Blindstromkompensationsanlagen
- Aufteilung des Gesamtleistungsbedarfes auf mehrere Transformatoren zur besseren Nutzungsanpassung
- Einbau von Maximumwächtern mit Vorrangschaltung zur Spitzenbegrenzung der elektrischen Leistung
- Einsatz der Ersatzstromanlagen zur Abdeckung der Spitzenlasten (ggf. auch Nutzung der Abwärme für Heizzwecke)
- Einsatz von Lastmanagement-Systemen bzw. Lastabwurfsteuerung
- Bei Leuchtstärken differenzieren zwischen Arbeits- und Umgebungsbereichen
- helle Oberflächen in Räumen bevorzugen (Bessere Reflexionsgrade)
- Geeignete Sonnen- bzw. Blendschutzsysteme vorsehen
- Freiflächengestaltung so ausführen, dass die Beleuchtung von Plätzen minimiert wird
48 Gebäudeautomation
- Messtechnikkonzept unter Berücksichtigung der notwendigen Messdaten
- Vermeidung von Einbaumängeln der Messtechnik und Beachtung, dass die Messtechnik
- möglichst wartungsfrei, bzw. wartungsfreundlich ausgelegt und installiert ist
- regelmäßige Funktionsprüfung von Messstellen
- Einsatz Gebäudeautomation
Wesentliche operative Energiemanagementprogramme der Gebäudeautomation:
- zeitabhängiges Schalten
- ereignisabhängiges Schalten
- Höchstlastbegrenzung für Energien
- Schalten in Abhängigkeit der Eigenstromerzeugung
- gleitendes Schalten
- adaptive Regelkurven
- raumlastabhängige Sollwertführung von zentralen Anlagen
- TGA- Wirkungsgradoptimierung (Kälteaggregat, Eisspeicher, Wärmeerzeuger, Wärmetauscher)
- Nullenergieband Grenzwertregelung (Temperatur / Feuchte)
- variable Totzone / Totzeit (Heiz- / Kühlsequenzregelung)
- Intervallbetrieb - Luftmengenreduzierung
- Nachtkühlbetrieb (Entwärmung der Raumspeichermasse)
- bedarfsabhängige Regelung mit Luftqualitätsfühlern
- Raumtemperaturanhebung im Sommer nach DIN EN 15251 bzw. DIN 4108, Teil 2
- Drehzahlregelung von Pumpen und Ventilatoren
- Energiezufuhr-Abschaltung über Fensterkontakt (z.B. Raumluftanlagen, Heizkreise)
- Umschaltung bei Wärmerückgewinnungsanlagen (WRG) durch Enthalpievergleich
- Sequenzregelung Erhitzer / Kühler mit Integration der WRG
- Regelung des Außenluftanteils nach Arbeitsstättenrichtlinien
- Beleuchtungssteuerung (tageslichtabhängig)
- Sonnenschutzsteuerung
Organisatorische Maßnahmen
- Koordination der Mehrzwecknutzung bei der Bereitstellung von Räumen und Gebäuden außerhalb der allgemeinen Dienst- bzw. Nutzungszeiten bezüglich Ort, Zeit und Beheizungsmöglichkeit (Zusammenlegung von Fortbildungsveranstaltungen, Vereinsarbeit, Elternabende usw.).
- Sport- und Turnhallen von Schulen sollten von Vereinen während der Ferien möglichst nicht genutzt werden.
- Mitwirken bei Auswahl und Einsatz des betriebstechnischen Bedienpersonals (auch Hausmeister) im Hinblick auf eine technische Mindestqualifikation.
- Schulung und Fortbildung des betriebstechnischen Bedienungspersonals bzw. der Hausmeister im Hinblick auf energiesparende Betriebsweise.
- Erarbeiten von Anweisungen, Richtlinien und Hinweisen für Planung, Ausführung und Betrieb mit dem Ziel einer höchstmöglichen Energieeffizienz.
- Regelmäßige Information der Nutzer über den Energieverbrauch.
- Für jedes Gebäude einen Ansprechpartner für Energiefragen benennen.
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit durch Budgetierung der Energie- und Wasserkosten.
- Beteiligung der Nutzer an den durch die Energieeinsparungen erzielten Kosteneinsparungen.
Quellenangaben
Gesetze und Verordnungen
Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 24. Juni 2021GEG 2024
Gebäudeenergiegesetz vom 19. Oktober 2023EnEfG, Energieeffizienzgesetz
Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland vom 13. November 2023EEG 2023, Erneuerbare-Energien-Gesetz
Gesetz über den Ausbau erneuerbarer Energien vom 26. Juli 2023KWKG 2023 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in der geltenden Fassung vom 01. Januar 2023Regeln für Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand, Bekanntmachung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat vom 15. April 2021
EU-Richtlinie mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 2019/944 vom 5. Juni 2019
Europäische Norm
DIN EN ISO 50001 und DIN EN ISO 50005 EnergiemanagementsystemeDIN EN 14511:(2021-04) Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumheizung und -kühlung mit elektrisch angetriebenen Verdichtern.
Veröffentlichungen des Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV):
Technisches Monitoring 2020Weitere Publikationen unter www.amev-online.de
Deutscher Städtetag, Hinweise zum kommunalen Energiemanagement
Die Hinweise werden vom Arbeitskreis "Energieeinsparung" erarbeitet, laufend aktualisiert und ergänzt, deshalb hier nicht im Einzelnen aufgelistet.
Sie sind verfügbar unter
www.staedtetag.de/themen/klimaschutz-und-energie/hinweise-zum-kommunalen-energiemanagement
VDI- Richtlinien
VDI-Richtlinie 2067 Blatt 1, "Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen" [2012] Die Richtlinienreihe VDI 2067 behandelt die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von gebäudetechnischen Anlagen und ist in mehrere Blätter gegliedert. Blatt1 gibt einen Überblick und definiert die wesentlichen Grundlagen und Begriffe.VDI-Richtlinie 2067 Blatt 10, "Energiebedarf von Gebäuden für Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten" [2012]
Dieses Blatt beschreibt die Berechnung des Energiebedarfs von Gebäuden und Räumen zur Einhaltung vorgegebener RaumkonditionenVDI-Richtlinie 2067 Blatt 40, "Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen - Energieaufwand für die Erzeugung" [2013]
Dieses Blatt regelt die Berechnung des Energieaufwands der Wärme- und KälteerzeugungVDI -3807 Blatt 1 "Energie- und Wasserverbrauchskennwerte für Gebäude - Grundlagen" [2013]
VDI 4602 Blatt 3 "Energiemanagement - Messung und Auswertung" [2023]
VDI 6025 "Betriebswirtschaftliche Berechnungen für Investitionsgüter und Anlagen" [2012]
Sonstige Publikationen
Weiterentwicklung des kommunalen Bilanzierungsstandards für THG-Emissionen - Bilanzierungssystematik kommunal - BISKO
CLIMATE CHANGE 19/2020 im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA), April 2020PHPP 10: Planungstool herausgegeben vom Passivhaus Institut, Darmstadt, für die Projektierung von Passivhäusern. [2021]
"Energiemanagementsysteme in der Praxis", Umweltbundesamt (UBA) 2019
"Vergleichswerte für den Energieverbrauch von Nichtwohngebäuden", BBSR-Online-Publikation Nr. 20/2019
Veröffentlichungen der EU zum Thema "Klimaneutralität" sind verfügbar unter
www.consilium.europa.eu/de/topics/climateneutrality/
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Karsten Hübener | Freie Hansestadt Bremen, Der Senator für Finanzen (Obmann) |
| Henrik Bonnet | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Ludwigsburg |
| Hans Egerer | Regierung Mittelfranken, Ansbach |
| Markus Harnoth | Regierung Oberfranken, Bayreuth |
| Regina Bähr | Stadt Aachen, Gebäudemanagement |
| Mathias Linder | Stadt Frankfurt a.M., Amt für Bau und Immobilien |
| Ralf-Dieter Person | HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. |
2) Siehe auch Hinweis zum kommunalen Energiemanagement des Deutschen Städtetages, Ausgabe 9, "Energieberichte für kommunale Liegenschaften" vom 2.Juli 2002
3) liquefied natural gas
4) Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) [Hrsg.]: PPP-Handbuch. VVB Vereinigte Verlagsbetriebe, 2009
 | ENDE |  |
...
X
⍂
↑
↓
