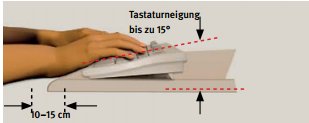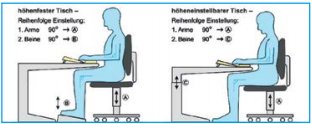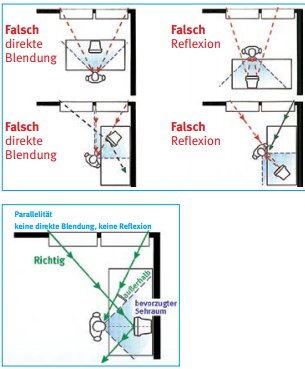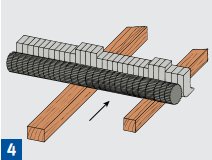Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk; BGI / DGUV-I |  |
BGI 725 / DGUV Information 209-031 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz - Schreinereien/ Tischlereien
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI)
(Ausgabe 10/2005; 12/2013)
Die BG-Information (BGI) Schreinereien/Tischlereien ist das Handbuch für jede Schreinerei/Tischlerei zum Thema "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz". Nur wenn dieses Thema in Ihre Arbeitsorganisation eingebunden ist, werden Sie Erfolg haben, vor allem auch motivierte, arbeitsfähige Mitarbeiter, und damit Ihre Produktivität verbessern und Kosten verringern. Zu Ihrem Erfolg soll diese BGI beitragen. Mit Hilfe des feingliedrigen Inhaltsverzeichnisses gehen Sie dem Problem oder der Frage nach, welches sie gerade lösen wollen, und finden im Text die passenden Hinweise, Empfehlungen und Lösungsvorschläge.
Mit dieser BGI sollen insbesondere hohe Risiken abgebaut werden. Unter Risiko wird in dieser BGI die Wahrscheinlichkeit verstanden, bei einem bestimmten Arbeitsgang (bei einer Tätigkeit) im speziellen Gewerk Schreinereien/Tischlereien Unfälle bestimmter Schwere oder - bei chemischen und physikalischen Einwirkungen - eine Berufskrankheit zu erleiden. Dabei spielt auch die Dauer der Tätigkeit und die Vorsorge gegen Gefährdungen eine wichtige Rolle.
Die Risiken sind in die Gefährdungsstufen I, II und III eingeteilt, die wiederum auf der Auswertung des umfassenden statistischen Materials über Unfälle und Erkrankungen in der Holzwirtschaft beruhen. Es bedeuten:
| I (hoch) Sehr häufig leichtere Unfälle/ Gesundheitsschäden oder relativ oft schwere Unfälle/Gesundheitsschäden zu erwarten. |
| II (erheblich) Häufig leichtere Unfälle/Gesundheitsschäden oder relativ selten schwere Unfälle/Gesundheitsschäden zu erwarten. |
| III (gering) Selten leichte Unfälle/Gesundheitsschäden oder nur in extremen Ausnahmefällen schwere Unfälle/ Gesundheitsschäden zu erwarten. |
Ein hier als gering bewertetes Risiko bedeutet keinesfalls, dass an dem Arbeitsplatz oder Arbeitsgerät sorglos gearbeitet werden kann oder gesundheitliche Belastungen ohne weitere Vorsorge in Kauf genommen werden können. Diese BGI befasst sich nicht mit "Beschaffenheit", diese ist im staatlichen Recht geregelt. In den Bildern wird die jeweilige "empfohlene Regelausführung" dargestellt, wie sie von Herstellern erhältlich ist. Sofern Einrichtungen selbst gebaut werden (z.B. Rahmenpressen), reichen die in dieser BGI gegebenen Hinweise nicht aus. In diesem Fall sowie bei weiteren Fragen zu dieser BGI bitte den Präventionsdienst der BGHM in Anspruch nehmen.
Unter "Prüfen im Betrieb" sind Fragen gestellt, die, wenn sie beantwortet werden, eine Übersicht über sämtliche bestehenden Gefährdungen und die zur Behebung erforderlichen Maßnahmen geben (Gefährdungsbeurteilung nach [3]). Diese Fragen sind auch zusammenhängend als "Check für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Schreinereien/Tischlereien" bzw. "Check für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" bei der BGHM erhältlich.
Sie stehen auch als Download-Datei im Internet unter www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/handlungshilfenfuerkleinundmittelbetriebe/schreinereitischlerei.html zur Verfügung.
1. Arbeitsorganisation
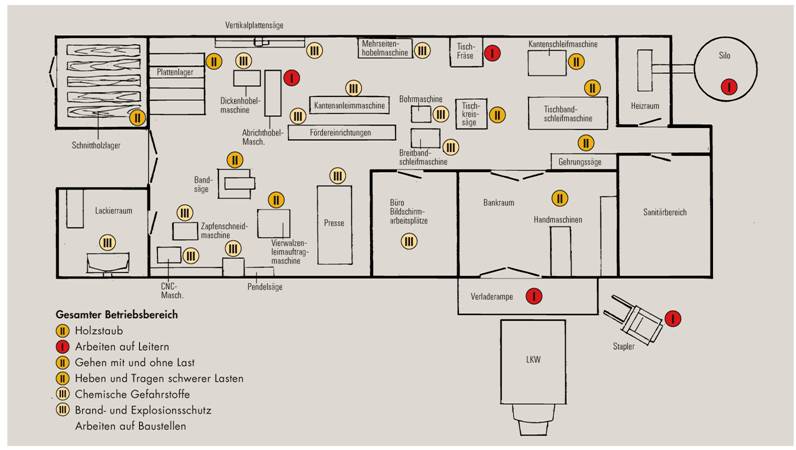
1.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durch Organisation
Unfallhäufigkeit und krankheitsbedingte Ausfallzeiten werden maßgeblich durch die Bereitschaft des Unternehmers und der Führungskräfte beeinflusst, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in die betrieblichen Prozesse und Strukturen zu integrieren.
Risiken für die Beschäftigten können nicht nur von Betriebsmitteln (z.B. Maschinen, elektrischen Anlagen) und Gefahrstoffen ausgehen oder durch körperliche Belastungen entstehen. Zusätzlich müssen auch andere Faktoren mitberücksichtigt werden, z.B. mangelhafte Einweisung, unvollständige Beschreibung der Arbeitsaufgaben, mangelnder Handlungsspielraum, Monotonie der Arbeit und die Arbeitsumgebungsbedingungen.
Eine gut funktionierende betriebliche Arbeitsorganisation mit klaren Zuständigkeiten und die Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeitsgestaltung sind für das Vermeiden oder Verringern von Belastungen von maßgeblicher Bedeutung und tragen nachweislich zu weniger Betriebsstörungen und damit zu einem besseren Betriebsergebnis bei.
Damit der Betrieb auch langfristig leistungsfähig bleibt, muss sich der Betrieb dem Wandel der Arbeitswelt stellen. Schnellere Anpassung an neue Märkte, sich schneller ändernde Produktionsbedingungen und der demographische Wandel sind in der eigenen Personalentwicklung zu berücksichtigen. Belegt ist, dass gerade die Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeitsgestaltung wesentlich für den Erfolg eines Unternehmens ist.
Gute betriebliche Organisation heißt auch, das Wissen und Können der Beschäftigten zu nutzen und zu fördern. So kann zum Beispiel ein erfahrener Mitarbeiter mit einem jungen Beschäftigten gemeinsam Arbeitsaufgaben übernehmen - das sogenannte Tandemmodell. Sie profitieren voneinander. Das höhere Unfallrisiko bei den Jüngeren kann so gesenkt, psychische und physische Belastungen können reduziert werden.
Auch die Qualifizierung am Arbeitsplatz ist eine wichtige Strategie in der Organisation. Durch "Job-Enlargement" (Arbeitserweiterung um gleichartige Aufgaben) kann die Arbeit abwechslungsreicher und weniger belastend gestaltet werden, wodurch die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten steigt.
Eine weitere Stufe ist "Job-Enrichment". Hier wird nicht nur die Arbeitsaufgabe des Beschäftigten erweitert, sondern auch seine Verantwortung und sein Handlungsspielraum. Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen steigen nachweisbar.
Einen gut organisierten Betrieb erkennt man z.B. an folgenden Merkmalen:
- Der Verantwortungsbereich eines jeden Mitarbeiters ist schriftlich festgelegt.
- In einer Job-Beschreibung/Arbeitsanweisung sind das Tätigkeitsfeld und der Aufgabenbereich der Mitarbeiter vollständig festgelegt.
- Verantwortungsbereich, Tätigkeitsfeld und Aufgabenbereich wurden mit dem Mitarbeiter gemeinsam festgelegt.
- Jeder Mitarbeiter wird regelmäßig nach möglichen Störfaktoren und Schwachstellen in seinem Arbeitsbereich befragt.
- Jeder Mitarbeiter wird nach Verbesserungen in seinem Bereich befragt.
- Mit den Mitarbeitern werden gemeinsame Ziele für den Arbeitsbereich besprochen und festgelegt.
- Beschäftigte sind einzuweisen und zu unterweisen.
- Es werden nur sicherheitstechnisch einwandfreie Betriebsmittel beschafft.
- Betriebsmittel werden regelmäßig überprüft.
- Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten ist organisiert.
- Die Mitarbeiter werden über die betrieblichen Entscheidungen informiert und in die Arbeitsgestaltung mit einbezogen.
Ein Formular zur Organisation und Festlegung von Verantwortungsbereichen ist im Anhang beigefügt.
Organisation - Festlegung von Verantwortungsbereichen Tischlereien/Schreinereien
| Verantwortungsbereich Lager, Be- und Entladung | Name | Ausbildung vorhanden | Weiterbildung geplant | Bemerkung |
| Transport | ||||
| Maschinenraum | ||||
| Bankraum | ||||
| Oberfläche | ||||
| Sonstiger | ||||
| Silo | ||||
| Gabelstaplerfahrer | ||||
| Kranführer | ||||
| Sicherheitsbeauftragte (ab 21 Beschäftigte) | ||||
| Fachkraft für Arbeitssicherheit | ||||
| Ersthelfer | ||||
| Betriebsarzt |
Zeitarbeitnehmer (Leiharbeiter)
Zeitarbeit kann Unternehmen helfen, wenn Personal benötigt wird, z.B. zusätzliches Personal für einzelne Projekte, wenn vorhandenes Personal ausfällt.
Häufig sind die Einsätze von Zeitarbeitnehmern nur von kurzer Dauer. Das bedeutet für die Beschäftigten u. a.: Ständig wechselnde Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Arbeitsanforderungen und Ansprechpartnern, veränderten Arbeitsabläufen, unterschiedlichen Organisationsstrukturen, veränderten Umgebungseinflüssen.
Ursachen für das hohe Arbeitsunfallrisiko von Zeitarbeitnehmern sind:
- mangelhafte Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibung
- unzureichende Gefährdungsbeurteilungen
- Wechsel der Tätigkeit im Einsatzbetrieb (beim Entleiher) ohne Absprache mit dem Zeitarbeitsunternehmen (dem Verleiher)
- schlechte Einarbeitung im Einsatzbetrieb
- mangelhafte Unterweisung im Einsatzbetrieb, oft Unkenntnis über Gefährdungen
- fehlende Berufserfahrung im Einsatzbetrieb
- Übermotivation, um sich im Einsatzbetrieb hervorzuheben
Neben der Bereitstellung sicherer und gesunder Arbeitsplätze und einer gründlichen Unterweisung/Einweisung können Unfallrisiken vermieden und die Effizienz der Zeitarbeit gesteigert werden durch sorgfältige Organisation und Vorbereitung:
- Anforderungsprofil für die Tätigkeit festlegen - das ermöglicht es dem Zeitarbeitsunternehmen besser, einen geeigneten Beschäftigten auszuwählen
- geeignetes Zeitarbeitsunternehmen auswählen (Kriterien: Disponent klärt persönlich vor Ort die Einsatzbedingungen, stellt für die Tätigkeit qualifizierte Beschäftigte, betreut persönlich seine Beschäftigten regelmäßig vor Ort, hilft Störungen und Fehler zu vermeiden)
- Arbeitsbedingungen und Schnittstellen mit Disponent des Zeitarbeitsunternehmens persönlich vor Ort abklären
- Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Arbeitsschutzvereinbarung abschließen
- nach dem Einsatz Erfahrungen auswerten und Verbesserungen festlegen
| Tipp: Behandeln Sie Zeitarbeitnehmer so wie Ihre eigenen
Beschäftigten! Informationen für einen effizienten und rechtssicheren Überlassungsprozess siehe BG- Information "Zeitarbeit nutzen - sicher, gesund und erfolgreich - Leitfaden für Unternehmen, die Beschäftigte flexibel einsetzen wollen" (BGI 5021) . |
Einweisung/Unterweisung der Mitarbeiter
Sicheres und gesundes Arbeiten setzt voraus, dass die Mitarbeiter über die Risiken an ihrem Arbeitsplatz informiert sind.
Einweisung
Neue Mitarbeiter müssen vor Aufnahme der Arbeit zunächst in den Betrieb und ihren Aufgabenbereich eingewiesen werden. Dies ist besonders wichtig bei:
- jungen Mitarbeitern (insbesondere Auszubildenden)
- ausländischen Mitarbeitern
- branchenfremden Mitarbeitern
Diese Personengruppen sind aufgrund der fehlenden Kenntnisse oder sprachlichen Schwierigkeiten besonders gefährdet. Zweckmäßigerweise wird für die Einweisung der Neuling bei einem Betriebsrundgang mit allen Räumlichkeiten und Ansprechpartnern bekannt gemacht und einem fachkundigen Mitarbeiter zugeordnet.
Unterweisung
Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Tätigkeit, bei Veränderung im Aufgabenbereich, bei Einführung neuer Technologien und danach in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich durchzuführen.
Angelernte Arbeitnehmer, Leiharbeiter und Jugendliche/Auszubildende sind zunächst bei jedem neuen Arbeitsgang/jeder neuen Tätigkeit zu unterweisen. Dabei sollte immer in 4 Stufen vorgegangen werden:
- vormachen
- erklären
- nachmachen lassen
- kontrollieren
Bau- und Montagearbeiten auf Baustellen
Montagearbeiten auf Baustellen sind beeinflusst durch unterschiedliche Arbeitsschutzsituationen an ständig wechselnden Einsatzorten, psychische Belastungen durch Termindruck und physische Belastungen durch Umgang mit Lasten und längere Fahrtätigkeit.
Da der Unternehmer nicht immer die genaue Arbeitssituation auf den Bau- und Montagestellen kennt, kann er eine Gefährdungsbeurteilung nur gemeinsam mit den Monteuren durchführen. Sie haben Erfahrung über die unterschiedlichen Arbeitsschutzverhältnisse, die sie vor Ort antreffen können. Zur Beurteilung der Gefährdungen und um sich in die Lage zu versetzen, für sich zufriedenstellende und notwendige Arbeitsschutzbedingungen zu schaffen, müssen die Monteure umfassend qualifiziert und unterwiesen werden. Den Monteuren muss auch - vertraglich abgesichert - Entscheidungsspielraum eingeräumt sein, unter welchen Bedingungen sie welche Konsequenzen für den Fortgang der Arbeiten ziehen können.
Siehe hierzu auch BGI 735.
Gütesiegel SMS - Sicher mit System
Erfüllt Ihre Firma bereits die Kriterien eines gut organisierten Betriebes? Dann ist die Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems ein nächster Schritt.
SMS ist das Arbeitsschutzmanagementsystem der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, das Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im ganzen Betrieb zum festen Bestandteil der Organisation macht.
Das System führt zu reduzierten Gefährdungen, verbessertem betrieblichen Gesundheitsschutz und optimierten Betriebsabläufen.
Vorteile von SMS:
- weniger störende Ereignisse
- weniger unsichere Handlungen und Bedingungen
- weniger Ausfallzeiten durch gesündere Mitarbeiter
- weniger Unfallkosten
- weniger Krankenkosten
und eine Verbesserung
- der betrieblichen Abläufe
- der Qualität der Arbeitsergebnisse
- der Produktivität
- der Motivation der Mitarbeiter
- des Betriebsklimas

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall verleiht das SMS-Gütesiegel an Unternehmen, welche das Arbeitsschutzmanagementsystem erfolgreich eingeführt haben.
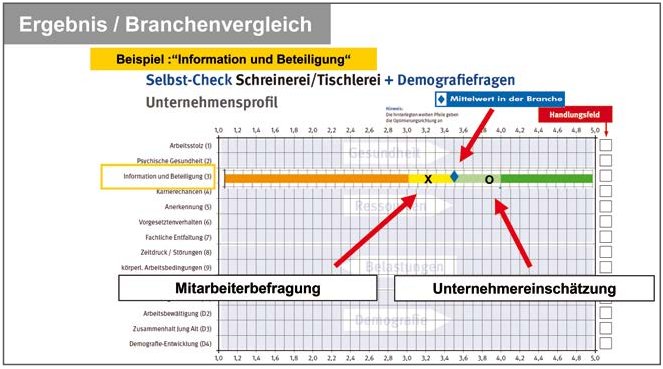
Für Schreinereien/Tischlereien stellt die BGHM ein spezielles Präventionsangebot "GiH-Gesund im Handwerk" zur Verfügung.
Dabei geht es um Gesundheit und Motivation aller Beschäftigten sowie um die demografische Entwicklung des Unternehmens.
Eine schriftliche Befragung von Unternehmer, Vorgesetzten und Mitarbeitern führt zu einem "Selbst-Check" und sensibilisiert im ersten Schritt alle Beteiligten im Unternehmen.
Darüber hinaus wird ein Unternehmensprofil mit branchentypischen Informationen über die individuellen Stärken und Potentiale des Betriebes ermittelt.
In einem weiteren Schritt erfolgt ein Vergleich des Betriebes zu Branchenkennzahlen. Anhand von "Ampelfarben" erkennt der Unternehmer seinen derzeitigen Stand und kann eigenen Handlungsbedarf ableiten.
1.2 Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation
Warum eine Gefährdungsbeurteilung?
Sichere Arbeitsplätze für diejenigen, die dort den größten Teil ihrer Tageszeit verbringen und ihre Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit dem Unternehmen zur Verfügung stellen - das sind selbstverständliche Ziele der Arbeitgeber in Industrie und Handwerk und der Beschäftigten. Auch in der Vergangenheit waren Arbeitgeber wie Beschäftigte bedacht, Arbeitsplätze in Bezug auf Funktionalität, Sicherheit und Gesundheitsschutz zu durchleuchten und ständig zu verbessern. Doch der eine oder andere Aspekt wurde übersehen, und so konnte es dennoch gelegentlich zu Unfällen oder auch Erkrankungen kommen.
Rechtliche Grundlagen
Grundlage für eine umfassende Gefährdungsbeurteilung bildet das 1996 in Kraft getretene Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [3].
Ebenso fordern auch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) [4], die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) [11] und die Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) [12] die Beurteilung der Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe/Gefahrstoffe bzw. physikalischen Einwirkungen.
Die genannten Vorschriften sind die Basisvorschriften für alle Unternehmen für den Umgang mit Arbeitsmitteln und Arbeits- sowie Gefahrstoffen.
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist das "Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit".
Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes".
Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist die "Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen".
Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ist die "Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen".
Die Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" - DGUV Vorschrift 1 - ist die Vorschrift der Berufsgenossenschaften [22].
Überblick über die gesetzlichen Grundlagen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
| ArbSchG
§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen § 3 Gefährdungsbeurteilung GefStoffV § 3 Gefährdungsbeurteilung DGUV Vorschrift 1 - Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention § 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Auskunftspflichten |
Untersuchungen der Arbeitsschutzbehörden (Ämter für Arbeitssicherheit bzw. Gewerbeaufsichtsämter) und der Berufsgenossenschaften haben gezeigt, dass in einer Vielzahl von Betrieben die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung noch nicht vorliegt.
Die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung in den Betrieben einzufordern ist deshalb Teil der "Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie" (GDA) von Bund, Ländern und Versicherungsträgern (z.B. Berufsgenossenschaften).
Rechtssicherheit schaffen
Eine durchgeführte und dokumentierte Gefährdungsbeurteilung ist ein Schritt zu mehr Rechtssicherheit für den Ernstfall. Häufigste Fragen nach einem Unfall sind:
- Wurde die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?
- Wurde der Beschäftigte über die Gefährdungen unterwiesen?
Wer führt die Gefährdungsbeurteilung durch?
Arbeitsschutz ist Chefsache! Der Verantwortung daraus kann er sich nicht entledigen.
Das Arbeitsschutzgesetz (§ 5) verpflichtet deshalb ausdrücklich den Arbeitgeber, Gefährdungen in seinem Betrieb zu ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzulegen.
Die nachfolgende Checkliste soll dem Arbeitgeber dabei helfen seiner Verpflichtung zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nachzukommen. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt bieten dem Unternehmer eine qualifizierte Unterstützung an.
Wann muss eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden?
- Zur Erstanalyse an bestehenden Arbeitsplätzen
- Bei Erweiterung, Umbau oder wesentlicher Nutzungsänderung von Einrichtungen
- Nach Arbeitsunfällen, Beinaheunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen. Aber auch zur laufenden Qualitätskontrolle, d. h. in regelmäßigen Abständen, empfohlen wird eine jährliche Aktualisierung
Wie soll die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden?
Die Vorschriften regeln nicht, wie der Unternehmer die Beurteilung vorzunehmen hat. Hier hat der Gesetzgeber bewusst einen breiten Spielraum gelassen. Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall, die über entsprechende Zahlen und Analysen zur Arbeitsplatzsituation und zu den Gefährdungen verfügt, stellt dafür Checks für Sicherheit und Gesundheitsschutz zur Verfügung.
Mit dem Durcharbeiten dieser Checklisten und dem Umsetzen dessen, was als notwendige Maßnahme des Arbeitsschutzes erkannt wurde, helfen sich die Unternehmer selbst am Besten. Außerdem wird die Verpflichtung des Arbeitsschutzgesetzes, für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten eine Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, gleich mit erfüllt.
Zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung steht der "Check für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Schreinereien/Tischlereien" der BGHM zur Verfügung."
1.3 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
Der Unternehmer hat nach § 2 von [21] Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der nach § 3 und 6 von [5] bezeichneten Aufgaben schriftlich zu bestellen.
Arbeitsmedizinische Betreuung
Mit der fachkompetenten betriebsärztlichen Beratung sollen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) vermieden werden. Jeder Unternehmer weiß, dass der Ausfall von Mitarbeitern wegen Krankheit oder Unfall teuer ist. Deshalb sollten Sicherheits- und Gesundheitsschutzaspekte vorausschauend in den betrieblichen Ablauf eingebracht werden. Durch optimale menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung können viele Faktoren, die das Betriebsergebnis beeinflussen, wie z.B. Störungen im Betriebsablauf, Termindruck, Qualitätsmängel, verminderte Leistung, Nichteinhaltung von Lieferterminen, erhöhte Beanspruchung der verbliebenen Arbeitnehmer vermieden werden. Dies wiederum führt zu erheblichen Kosteneinsparungen im Betrieb. Um eine fachkompetente sicherheitstechnische und arbeitsmedizinischen Betreuung der Beschäftigten sicherzustellen, ist die Betreuung möglich durch:
- Interne im Betrieb angestellte Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte
- Freiberuflich tätige Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte
- Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienste
Kombinationen dieser Betreuungsmöglichkeiten sind ebenfalls möglich. So kann z.B. ein Arbeitsmedizinischer Dienst für die betriebsärztliche Betreuung beauftragt werden und eine eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit für die sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten sorgen. Der Einsatz ist abhängig vom Bedarf, der bestimmt wird von den Gefährdungsmomenten im Betrieb. Diese werden in der Gefährdungsbeurteilung durch den Unternehmer festgestellt. Hilfestellung leistet die BGHM.
Sicherheitstechnische Betreuung
Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) wird vom Unternehmer die schriftliche Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) und eines Betriebsarztes gefordert. Das gilt für jedes Unternehmen ab 1 Beschäftigten.
In der DGUV Vorschrift 2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" ist die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten geregelt. Dabei wird unterschieden zwischen Regelbetreuung und alternativer Betreuung (siehe nachfolgende Tabelle).
Regelbetreuung
Alle Betriebe, die sich für die Regelbetreuung entscheiden, müssen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und einen Betriebsarzt bestellen und den erforderlichen Betreuungsaufwand festlegen. Dieser richtet sich nach der Gefährdung im Betrieb.
Alternative Betreuung
Für Betriebe bis 50 Beschäftigte wurde eine Wahlmöglichkeiten geschaffen. Hier kann der Unternehmer die sicherheitstechnische Betreuung weitgehend selbst übernehmen, mit Unterstützung des Betriebsarztes und externer Berater.
Dazu wird der Unternehmer zu Fragen der Arbeitssicherheit , des Gesundheitsschutzes und der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in einem Unternehmerseminar geschult, zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen motiviert und über die Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung informiert.
| Unternehmensgröße | Regelbetreuung | Alternative Betreuung |
| Bis zu 10 Beschäftigte | Ja, Grundbetreuung, anlassbezogene Betreuung, Seite 50 ff. | Ja, entsprechend der UVT-Regelung, Seite 52 ff. UVT = Unfallversicherungsträger |
| Mehr als 10, bis zu 50 Beschäftigte | Ja, Grundbetreuung, Seite 24 ff und betriebsspezifische Betreuung, Seite 34 ff. | Ja, entsprechend der UVT-Regelung, Seite 52 ff. UVT = Unfallversicherungsträger |
| Mehr als 50 Beschäftigte | Ja, Grundbetreuung, Seite 24 ff und betriebspezifische Betreuung, Seite 34 ff. | Nein |
Hinweis:
Tabelle wurde weitestgehend aus "DGUV Vorschrift 2 - Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit - Hintergrundinformationen für die Beratungspraxis" entnommen.
Entscheidet sich ein Unternehmer dafür, wird er persönlich in die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung seines Betriebes eingebunden. Er ist Dreh- und Angelpunkt für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Folgendes ist dafür erforderlich bzw. zu erledigen:
- Aktive Teilnahme des Unternehmers an den Informations- und Motivationsmaßnahmen, diese bestehen aus:
Ausbildungsstufe 1
Seminar, Dauer 1 Tag
Ausbildungsstufe 2
Seminar, Dauer 2 Tage, oder Fernlehrgang mit schriftlicher Prüfung - Im Rahmen des betrieblichen Praktikums erstellt der Unternehmer die Gefährdungsbeurteilung für sein Unternehmen, dabei wird er auf Wunsch durch einen Mitarbeiter der BGHM beraten.
- In einem Abschlussgespräch mit einem Mitarbeiter der BGHM wird die erfolgreiche Qualifizierung festgestellt und der Unternehmer erhält das Abschlusszertifikat für die Alternative Betreuung.
- Der Unternehmer bildet sich regelmäßig fort.
Dieses "alternative" Betreuungsmodell ist genau auf Handwerksbetriebe abgestimmt. Deshalb hat sich ein großer Teil der Handwerksunternehmen bereits dafür entschieden.

Wenn der Unternehmer schwierige Probleme nicht lösen kann, braucht er einen beratenden Ansprechpartner. Der steht ihm mit den Mitarbeitern der BGHM zur Verfügung. Ansprechpartner für alle Beratungen sind die Mitarbeiter der Präventionsdienste (kostenfreie Service-Hotline 0800 9990080-2).
Feste Vorgaben, wann im Betrieb eine Beratung notwendig ist, gibt es nicht. Einige Anlässe, bei denen Beratungsbedarf erforderlich sein könnte, sind:
- Praxistauglichkeit von Schutzkonzepten neuer und komplexer Anlagen
- Planung von Explosionsschutzmaßnahmen
- Anwendung neuer Produktionstechniken
- Messen der Luftgeschwindigkeiten neuer oder wesentlich geänderter Absauganlagen
- Neubau oder Umbau von Betriebsstätten,
- Verwendung neuer Arbeits- und Gefahrstoffe.
Arbeitsmedizinische Betreuung
Die arbeitsmedizinische Betreuung erfolgt durch die Bestellung eines Betriebsarztes oder durch die Beauftragung eines arbeitsmedizinischen Dienstes. Durch kostengünstige Leistungen unterstützt die BGHM die Mitgliedsbetriebe z.B. durch Untersuchungen des Gehörs oder der Augen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien Hotline-Nummer: 0800.999 0080-2. Fragen zum arbeitsmedizinischen Dienst beantworten die zuständigen Ansprechpartner der Abteilung Prävention (kostenfreie Telefonhotline: 0800.999 0080-2).
1.4 Sicherheitsbeauftragte
Zur Unterstützung des Unternehmers bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten hat der Unternehmer Sicherheitsbeauftragte zu bestellen (§ 20 von [22]).
Sie haben sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Beschäftigten aufmerksam zu machen. Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.
In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter Berücksichtigung der im Unternehmen für die Beschäftigten bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren in der erforderlichen Anzahl Sicherheitsbeauftragte zu bestellen (§ 22 von [1]).
1.5 Arbeitsschutzausschuss
Zur Beratung der Anliegen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung haben Unternehmer von Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden (§ 11 in [5]).
Der Arbeitsschutzausschuss setzt sich zusammen aus:
- dem Unternehmer oder einem von ihm Beauftragten
- zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern, sofern vorhanden
- Betriebsärzten
- Fachkräften für Arbeitssicherheit
- Sicherheitsbeauftragten
1.6 Beschäftigungsbeschränkungen
Für folgende Personen bestehen Beschäftigungsbeschränkungen in Schreinereien/Tischlereien.
Für werdende oder stillende Mütter können folgende Beschränkungen in Schreinereien/Tischlereien bestehen (§ 4 von [7]:
- regelmäßiges Heben von Lasten, Arbeiten mit Beizen, Lösemitteln, Leimen, Klebern und/oder Holzstäuben, sofern Art, Umfang und Dauer der Exposition zu einer relevanten Gefährdung i. S. d. Mutterschutzgesetzes bzw. der Verordnung für Mütter am Arbeitsplatz führen können
- Lärm mit einem Tages-Lärmexpositionspegel (LEX, 8h) > 80 dB (A)
Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren dürfen mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden sicherheitstechnischem Bewusstseins oder wegen mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können, nicht beschäftigt werden (§ 22 von [6]. Als besonders gefährliche Arbeiten gelten Tätigkeiten an Abrichthobelmaschinen, Säge- und Fräsmaschinen jeder Art, ausgenommen Dekupier- und Handstichsägemaschinen.
Sie dürfen ferner nicht beschäftigt werden:
- mit dem Beseitigen von Stauungen in Silos
- mit dem selbstständigen Steuern von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand
- wenn sie gesundheitsschädigendem Lärm ausgesetzt sind, d.h. ihr persönlicher Beurteilungspegel 85 dB (A) übersteigt
- bei Überschreitung der Luftgrenzwerte von Lacken, Lösemitteln und Holzstaub (auch Erwachsene dürfen bei Überschreitung der Luftgrenzwerte nur mit persönlicher Schutzausrüstung arbeiten)
Dies gilt nicht für Jugendliche (ab 15 Jahren), soweit:
- die o.g. Arbeiten zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich sind, d. h. soweit sie im Ausbildungsrahmenplan festgelegt sind, z.B. für Tischler/Schreiner im 1. Lehrjahr (ausgenommen Tischfräsmaschine) und Tätigkeit an der Tischfräsmaschine ab dem 2. Lehrjahr
- ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist
1.7 Unterweisungen
Risiko
Unzureichendes Wissen über die einzelnen Arbeitsgänge oder Maschinen durch ungenügende oder nicht regelmäßig wiederholte Unterweisung ist mit erhöhtem Risiko verbunden. Die Unfallstatistik zeigt, dass Beschäftigte, die Arbeiten an einer Maschine erst seit kurzer Zeit ausführen, häufiger verunglücken. Die ersten Arbeitstage stellen das größte Risiko dar. Dies gilt insbesondere für Lehrlinge, die in der ersten Zeit nach Einführung in die Maschinenarbeit besonders häufig verunglücken.
Beschäftigte sind daher über die Gefährdungen am Arbeitsplatz ausreichend zu unterweisen (§ 4 von [22]. Lehrgänge, z.B. über das sichere Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen, ersetzen die Unterweisung am Arbeitsplatz nicht, da sie nicht auf individuelle Betriebssituationen eingehen und nicht regelmäßig wiederholt werden.
Die Unterweisung ist vor Aufnahme einer Tätigkeit, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, bei der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie und danach in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich, durchzuführen. Angelernte Arbeitnehmer, Leiharbeitnehmer und Jugendliche sind besonders intensiv zu unterweisen.
Über die übliche Unterweisung hinaus müssen Beschäftigte, die in besonders gefährlichen Arbeitsbereichen tätig werden, über die besondere Gefährlichkeit dieser speziellen Arbeitsplätze unterwiesen und über die zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet sein.
Besonders gefährliche Arbeitsbereiche bestehen
- beim Arbeiten auf Leitern,
- beim Führen von Flurförderzeugen,
- in Silos,
- an Abrichthobelmaschinen,
- an Tischfräsmaschinen für Einzelfertigungen, die häufig umgerüstet werden müssen, sowie
- dort, wo sich aus der sicherheitstechnischen oder betriebsärztlichen Betreuung oder aus den Ergebnissen von Vorsorgeuntersuchungen Hinweise auf weitere besondere unfall- oder arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren ergeben.
Für verschiedene Arbeitsbereiche/ Tätigkeiten hat die BG Unterweisungshilfen erstellt (siehe Anhang 2):
- Leitern
- Flurförderzeuge
- Silos
- Abrichthobelmaschinen
- Tischfräsmaschinen
usw.
Die Unterweisungshilfen stehen als Download zur Verfügung:
http://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/unterweisungshilfen.html
Bei Beschäftigten, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, muss sichergestellt werden, dass die Unterweisungen verstanden werden, z.B. durch Verwenden von Piktogrammen auf Schildern oder Übersetzen von Anweisungen.
Folgende Reihenfolge soll bei der Durchführung von Unterweisungen beachtet werden:
- Erklären der Arbeitsgänge mit Unterweisungshilfen (z.B. die bebilderten Unterweisungsvorschläge des Anhanges 2, auch für Gefahrstoffe)
- Vormachen der Arbeitsgänge
- Nachmachen lassen
- Kontrollieren
1.8 Lärm
Risiko
Die Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten bei Schreinern/Tischlern.
Das Risiko, an Lärmschwerhörigkeit zu erkranken, ist in Gefährdungsstufe II als erheblich eingestuft.
Ermittlung
Die Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h sind zu ermitteln und zu dokumentieren. Es ist zu unterscheiden:
- 80 dB (A) <= LEX, 8h < 85 dB (A)
- 85 dB (A) <= LES,8h
Kennzeichnung, Informationspflicht
Bereiche mit einem Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h > = 85 dB(A) sind zu ermitteln und zu kennzeichnen. Es ist sicherzustellen, dass dort Gehörschutz getragen wird. Wird festgestellt, dass der Tages-Lärmexpositionspegel kleiner als 85 dB(A) aber gleich bzw. größer als 80 dB(A) ist, sind die dort Beschäftigten über die Gefahren des Lärms zu unterweisen. Geeigneter Gehörschutz ist bereitzustellen

Maßnahmen zur Vorsorge
- Arbeitsmedizinische Vorsorge Beschäftigte in Schreinereien/Tischlereien, die in Bereichen arbeiten, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h > = 80 d B(A) festgestellt wurde, ist eine arbeitsmedizinische Gehöruntersuchung anzubieten. In den Bereichen, wo ein Pegel LEX, 8h > = 85 dB(A) ermittelt wurde, ist für die dort tätigen Beschäftigten eine regelmäßige arbeitsmedizinische Gehöruntersuchung zu veranlassen.
- Technische Maßnahmen
Von einem Tages-Lärmexpositionspegel LEX, 8h > = 85 d B(A) an ist ein Lärmminderungsprogramm aufzustellen und durchzuführen.
Lärmminderungsmaßnahmen
- Bei der Neuplanung von Betriebsstätten:
- Vorsehen von Schallschluckdecken/-wänden
- Trennung von Bank- und Maschinenraum
- Bei Neukauf von Maschinen:
- Beschaffung lärmarmer Maschinen (bei geprüften Holzbearbeitungsmaschinen wird sichergestellt, dass die Maßnahmen zur Lärmminderung nach dem Stand der Technik ausgeführt sind, z.B. durch Lärmkapselung). Geprüfte Holzbearbeitungsmaschinen siehe: http://www.dguv.de/dguvtest/de/zertifikatsrecherche/hozertifikatsrecherche/index.jsp
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erledigen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Lärm | |||||||||||
1. Sind die Lärmbereiche im Betrieb gekennzeichnet? Dies betrifft stets den Maschinenraum und darüber hinaus den Arbeitsbereich von:
| O | O | O | O |  | ||||||
| 2. Werden in diesen Bereichen Gehörschutzmittel benutzt? | O | O | O | O | |||||||
| 3. Werden Spezialisten der BGHM in den Fällen eingeschaltet, wo Hinweise des Betriebsarztes auf Gehörschädigungen vorliegen? | O | O | O | O | |||||||

1.9 Persönliche Schutzausrüstungen
Den Beschäftigten müssen persönliche Schutzausrüstungen in ausreichender Anzahl zur persönlichen Verwendung für die Tätigkeit am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Für die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen müssen - mit Ausnahme von Hautschutzmitteln - EG-Konformitätserklärungen vorliegen. In Schreinereien/Tischlereien sind folgende persönliche Schutzausrüstungen notwendig (§ 29 von [22]):
- Sicherheitsschuhe, mindestens Klasse S1 (mit Stahlkappen nach [40]. Auf Baustellen sind Sicherheitsschuhe Klasse S3 (zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle) erforderlich, da sonst mit Fußverletzungen durch Hineintreten in spitze und scharfe Gegenstände zu rechnen ist (siehe auch Kapitel 10 "Arbeiten auf Baustellen").
- Gehörschutz bei Aufenthalt in Lärmbereichen (siehe 1.8 "Lärm").
- Atemschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen, sofern der Luftgrenzwert überschritten wird oder mit erhöhter Exposition zu rechnen ist. Der Atemschutz muss auf den Gefahrstoff bzw. das Arbeitsverfahren abgestimmt sein, z.B.
- Atemschutzmasken mit Partikelfilter P2 oder partikelfiltrierende Halbmasken FFP 2 nach [44] oder Atemschutzhauben nach [43] bei Stäuben.
- Werden überwiegend Schleifarbeiten durchgeführt, sollten partikelfiltrierende Halbmasken nach [44] oder Atemschutzmasken mit Partikelfilter P2 nach [42] verwendet werden.
- Beim Einfahren in nicht entleerte Silos Vollmaske mit Partikelfilter P2NR.
- Atemschutzmasken mit Kombinationsfilter FFA2P2NR nach [41] beim Spritzlackieren.
- Augenschutz beim
- Umgang mit ätzenden Arbeitsstoffen, z.B. Säuren, Laugen, Bleichmitteln, Abbeizern,
- Schleifen von Metallwerkstücken, - Bearbeiten von Aluminium oder zum Splittern neigenden Kunststoffen,
- Einsteigen und Befahren von Silos (nur Korbbrille mit Befestigungsband) nach [45].
- Hautschutz beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen (siehe "Hautschutzplan", Anhang 2)
- Schutzhelm bei bestimmten Tätigkeiten auf Baustellen.
- Lederschürzen mit Splitterschutz bei Arbeiten an Mehrblattsägemaschinen.
Die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen muss der Unternehmer bereitstellen.

1.10 Hygienische Maßnahmen
In den Arbeitsräumen
- möglichst nicht essen und keinesfalls rauchen
- keine Nahrungsmittel aufbewahren
- verschmutzte Haut mit speziellem, möglichst mildem Hautreinigungsmittel oder Seife waschen. Als Arbeitsstoffe eingesetzte Lösemittel dürfen zur Hautreinigung auf keinen Fall verwendet werden. Nach der Reinigung der Haut unbedingt Hautpflegemittel auftragen (siehe "Hautschutzplan", Anhang 2).
1.11 Beschaffen von Arbeitsmitteln
Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, Ausrüstungsgegenständen oder Arbeitsstoffen hat der Unternehmer sicherzustellen, dass diese den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. Solche Anforderungen ergeben sich insbesondere aus dem Produktsicherheitsgesetz [8], der Gefahrstoffverordnung [11] sowie der Betriebssicherheitsverordnung [4]. In den Vertrag ist auch aufzunehmen, dass die zu liefernden Produkte diesen Arbeitsschutzanforderungen entsprechen müssen.
Es empfiehlt sich, vor Auftragserteilung mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger sowie mit der Arbeitsschutzbehörde die maßgeblichen Anforderungen abzuklären.
1.11.1 Beschaffen von Maschinen
Beim Beschaffen einer Maschine ab Baujahr 1995 ist darauf zu achten,
- dass die Maschine mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet ist und
- die EG-Konformitätserklärung sowie die Betriebsanleitung mitgeliefert werden [8], [10].
Mit der Konformitätserklärung und dem Anbringen des CE-Zeichens an der Maschine bestätigt der Hersteller, dass die Maschine den Anforderungen des Anhangs I der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.
Dieses Bescheinigungsverfahren ist nach der EG-Maschinenrichtlinie zwingend erforderlich. Um eine ordnungsgemäße Lieferung sicherzustellen, sollte dies bereits bei der Bestellung schriftlich mit dem Hersteller oder dessen Bevollmächtigten (Verkäufer) vereinbart werden.
Bei der Beschaffung von Anlagen größeren Umfanges stellt sich die Frage hinsichtlich des Ausstellens der Konformitätserklärung in vielen Fällen unübersichtlicher dar. Fragen zur CE-Kennzeichnung oder Konformitätserklärung beantworten die Mitarbeiter der Präventionsdienste der BGHM (kostenfreie Service-Hotline: 0800.999 0080-2).
Vorhandene und Gebrauchtmaschinen vor Baujahr 1995 müssen mindestens dem Anhang 1 der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Forderungen der zuletzt gültigen Unfallverhütungsvorschrift VBG 7j "Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz und ähnlichen Werkstoffen" eingehalten werden [20]. Wenn Maschinen wesentlich verändert wurden oder aus einem Nicht- EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)- Land eingeführt wurden, müssen sie der Maschinenverordnung (9. ProdSV) entsprechen.
GS-/BG-PRÜFZERT-Zeichen
Anders als beim Bescheinigungsverfahren wird das GS-Zeichen auf Antrag eines Herstellers im Rahmen einer freiwilligen Prüfung vergeben. Es ist also beim Kauf einer neuen Maschine nicht zwingend erforderlich und ersetzt auch nicht das CE-Zeichen. Jedoch darf der Maschinenkäufer beim Vorhandensein eines GS-Zeichens davon ausgehen, dass dieses Produkt als sicher angesehen werden kann.
Das Gleiche trifft auch für das BG-PRÜFZERT- Zeichen zu, das z.B. Werkzeuge, Schutzvorrichtungen als sicherheitstechnisch geprüft kenntlich macht bzw. an Absauggeräten oder Maschinen auf die bestandene Prüfung der Holzstaubemission hinweist.
Sonstige Empfehlungen beim Beschaffen von Maschinen
- Bei der Beschaffung transportabler Maschinen, z.B. für Arbeiten auf Bau- und Montagestellen, sollte darauf geachtet werden, dass
- geeignete Transporthilfen, z.B. Griffe und
- Zusatzeinrichtungen für eine ergonomische Arbeitshöhe, z.B. Tisch e oder schnellmontierbare Füße für Kreissägen, vorhanden sind.
- Leisere Maschinen sollten beim Kauf bevorzugt werden. Die erreichbare Lärmemission wird für die einzelnen Maschinen im Abschnitt 4 angegeben. Es handelt sich dabei um Emissionswerte, die unter festgelegten Arbeitsbedingungen ermittelt werden. Im Betrieb können sich je nach Arbeitsgang und Beschaffenheit von Wänden und Decken höhere Werte ergeben.
Sicherheitstechnische Abnahme von verketteten Anlagen
Schutzkonzepte verketteter Anlagen sollten vor Inbetriebnahme auf offensichtliche Mängel hin überprüft werden. Solche Anfragen sind an die Mitarbeiter der Präventionsdienste zu richten (kostenfreie Service-Hotline: 0800.999 0080-2).
1.11.2 Beschaffen von Fräswerkzeugen für die Holzbearbeitung
1.11.2.1 Werkzeuge für Handvorschub (z . B . für Tischfräsmaschinen)
Beim Beschaffen von neuen Holzbearbeitungsmaschinen-Werkzeugen für Handvorschub und für Arbeiten mit dem Vorschubapparat ist darauf zu achten, dass sie wie folgt gekennzeichnet sind: Name oder Zeichen des Herstellers, Baujahr und "MAN". Ferner muss der zulässige Drehzahlbereich (z.B. n 6000-9000) oder die Höchstdrehzahl angegeben sein. Geprüfte Werkzeuge können zusätzlich das "BG-TEST"- oder "BG-PRÜFZERT"-Zeichen tragen.
Für gebrauchte Werkzeuge sind baujahrabhängige Einzelheiten in den Tabellen 1 und 2 des Anhangs 3 zusammengestellt.
1.11.2.2 Werkzeuge für mechanischen Vorschub (z . B . für Automaten)
Neue Werkzeuge für mechanischen Vorschub müssen mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers, dem Baujahr und mit "MEC" gekennzeichnet sein. Ferner muss die zulässige Höchstdrehzahl (z.B. n max. 6000) angegeben sein. Geprüfte Werkzeuge können zusätzlich das "BG-PRÜFZERT"-Zeichen tragen. Gebrauchte Werkzeuge können auch mit " MECH. VORSCHUB" gekennzeichnet sein.
1.11.2.3 Überprüfung im Betrieb vorhandener Werkzeuge
Im Betrieb vorhandene Werkzeuge sollten zunächst anhand der Kennzeichnung auf ihre Eignung geprüft werden (siehe Tabellen). Werkzeuge mit dem BG-FORM-Zeichen dürfen auf Tischfräsmaschinen nicht mehr verwendet werden und sind mit "MECH. VORSCHUB" oder "MEC" zu kennzeichnen. Ist keine Kennzeichnung vorhanden, sollte Folgendes geprüft werden:
- Vorhandensein einer formschlüssigen Messerbefestigung
- Eignung für Handvorschub durch Prüfung der Spandickenbegrenzung und Spanlücke des Fräswerkzeugs mittels Prüfschablone
Bezüglich des Betriebs wird auf 4.1.2 und auf das Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten mit Fräswerkzeugen für die Holzbearbeitung" verwiesen (s. Anhang 2).
1.12 Prüfpflichtige Einrichtungen und Anlagen in Tischlereien/Schreinereien
Folgende Anlagen, die häufig in Tischlereien/Schreinereien betrieben werden, müssen regelmäßig von befähigten Personen geprüft werden:
| Anlage/ Betriebsmittel | Prüffrist (Empfehlung) | Prüffrist eingehalten | Erledigungsvermerk | nächste Prüfung | |
| ja | nein | ||||
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | alle 4 Jahre | ||||
| Handmaschinen | 1/2 jährlich | ||||
| Kraftbetriebene Fenster, Türen, Tore | jährlich | ||||
| Feuerlöscher | alle 2 Jahre | ||||
| Flurförderfahrzeuge | jährlich | ||||
| Hebebühnen | jährlich | ||||
| Krane | jährlich | ||||
| Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb | jährlich | ||||
| Winden, Hub- und Zuggeräte | jährlich | ||||
| Druckbehälter | je nach Größe und Druck | ||||
| Anlagen im explosionsgefährdeten Bereich | alle 3 Jahre | ||||
2. Bildschirmarbeitsplätze
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Risiko, das sich auf Halswirbelsäulenbeschwerden und Erkrankung der Augen bezieht.
Im Handwerk sind Bildschirmarbeitsplätze meist nicht ständig besetzt. Um Halswirbelsäulenbeschwerden und die Erkrankung der Augen zu vermeiden, sind bei der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen die im folgenden "Fragebogen zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen" genannten Gesichtspunkte zu beachten.
Fragebogen zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen
Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen bei Bildschirmarbeitsplätzen ist ein Teil der Aufgabe der Arbeitgeber. Diese Aufgabe ergibt sich aus der Richtlinie 89/391/ EWG, bzw. dem Arbeitsschutzgesetz und der Bildschirmarbeitsverordnung.
Die Folgen von ungünstigen Arbeitsbedingungen an Bildschirmgeräten können Erkrankungen der Muskeln, des Skeletts und der Augen, Konzentrationsstörungen sowie Stresssituationen sein.
Gesunde Arbeitsbedingungen sind ein wichtiges Element für die Leistungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes. Der vorliegende Fragebogen soll dabei helfen, diese Aufgaben effektiv und sinnvoll wahrzunehmen. Er umfasst nur die wichtigsten Fragen.
Im Einzelfall und bei der Beantwortung der Fragen mit "nein" können eingehendere Untersuchungen notwendig sein.
Der Fragebogen ist für jeden Bildschirmarbeitsplatz auszufüllen und stellt so einen Nachweis der Erfüllung der Dokumentationspflicht dar.
Mehr zum Thema Bildschirmarbeitsplätze siehe BGI 742 und BGI 650.
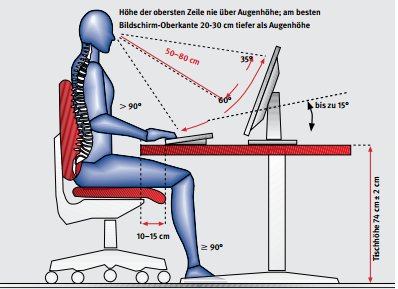
Arbeitsplatz:
__________________________
__________________________
__________________________
Mitarbeiter:
__________________________
__________________________
__________________________
Prüfer:
__________________________
__________________________
__________________________
Datum:
__________________________
__________________________
__________________________
Mängel zu erledigen bis:
__________________________
| Bildschirm:
Sind die Buchstaben gut lesbar? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Wird eine Positiv-Darstellung verwendet?
Hinweis: Dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund . | ja
[_] | nein
[ ] |
| Liegt die oberste Bildschirmzeile unterhalb der Augenhöhe (am besten 20-30 cm)? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Ist der Bildschirm frei und leicht dreh- und neigbar? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Tastatur:
Ist die Tastatur vom Bildschirm getrennt? | ja
[_] | nein
[ ] |
Ist die Tastatur nicht zu hoch?
| ja
[_] | nein
[ ] |
| Ist vor der Tastatur eine freie Tischfläche von 5-10 cm? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Hat die Tastatur eine matte und helle Gehäuseoberfläche? Ist sie nicht schwarz? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Arbeitstisch/Arbeitsstuhl:
Ist ausreichend Tischfläche vorhanden? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Ist die Höhe ausreichend?
Hinweis: Bei nicht höhenverstellbaren Tischen 74 ± 2 cm; bei höhenverstellbaren Tischen mindestens 68-76 cm. | ja
[_] | nein
[ ] |
| Oberfläche der Arbeitsfläche hell und matt bzw. seidenmatt? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Ist der Stuhl richtig eingestellt?
| ja
[_] | nein
[ ] |
| Ist die Sitzfläche nicht zu kurz, aber auch nicht länger als die Oberschenkel des Beschäftigten?
Hinweis: Schon bei mittelgroßen Personen ist sie oft zu kurz | ja
[_] | nein
[ ] |
| Reicht die Rückenlehne mindestens bis zur Unterkante der Schulterblätter und ermöglicht die Rückenlehne eine Unterstützung im Lendenbereich | ja
[_] | nein
[ ] |
| Anordnung im Raum/keine Blendung: | ||
| Ist die Blickrichtung parallel zur Fensterfront und den Leuchtbändern (keine Blendungen)?
| ja
[_] | nein
[ ] |
| Ist an den Fenstern Blendschutz vorhanden? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Software: | ||
| Ist die Software für die Arbeitsaufgabe geeignet? | ja
[_] | nein
[ ] |
Kann mit der Software problemlos gearbeitet werden? z.B.:
Eingaben bzw. kleine Fehler |
ja [_] |
nein [ ] |
| Arbeitsablauf/Organisation: | ||
| Besteht die Möglichkeit, die Bildschirmarbeit durch Tätigkeitswechsel (z.B. Aktenablage) oder Kurzpausen zu unterbrechen? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Sind die Beschäftigten für die Arbeit an Bildschirmgeräten eingewiesen? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Sind die Beschäftigten über mögliche Gesundheitsgefahren informiert? | ja
[_] | nein
[ ] |
| Wurde eine Erst- oder Nachuntersuchung angeboten? | ja
[_] | nein
[ ] |
3. Holzstaub
Risiko
Gefährdungsstufe insgesamt II.
- Es besteht ein erhebliches (II) Erkrankungsrisiko, bei langjähriger Inhalation von Eichen- und/oder Buchenholzstaub und bestimmten Zusatzstoffen, wie z.B. Chromaten, Holzschutzmittelwirkstoffen, Nasenschleimhautkrebs zu entwickeln.
- Es besteht ferner das Risiko bevorzugt bei der Inhalation, aber auch beim Hautkontakt, chronische oder obstruktive Atemwegs- oder Hauterkrankungen zu entwickeln. Dieses Risiko ist aber - je nach Holzart - sehr unterschiedlich.
| Holzart | Risiko (Haut) | Risiko (Atemwege) |
| Abachi, Mahagoni (außer Meranti), Teak | gering (III) | hoch (I)* |
| Esche, Ahorn | gering (III) | erheblich (II) |
| Eiche, Kiefer | gering (III) | gering (III) |
* Das Abachi-Allergen ist mittlerweile identifiziert. Sofern bei der Bearbeitung von tropischen Hölzern Atemwegsprobleme auftreten, bitte umgehend die BGHM und den Betriebsarzt informieren.
Staubgeminderte Bereiche in Schreinereien/Tischlereien
- Im Arbeitsbereich von stationären spanabhebenden Holzbearbeitungsmaschinen, die dem hier geschilderten Stand der Technik entsprechen, ist in Schreinereien/ Tischlereien der Stand der Technik eingehalten, sofern sie an eine wirksame Absaugung angeschlossen werden und auch sonst auf Staubvermeidung geachtet wird. Sie gelten als staubgemindert [14]. Das Erkrankungsrisiko ist dann minimiert; Vorsorgeuntersuchungen sind in diesem Fall nicht zwingend erforderlich.
- An Hand- und Montagearbeitsplätzen kann auch bei Berücksichtigung des Standes der Technik in größeren Schreinereien/Tischlereien (mehr als 5 Beschäftigte) eine erhöhte Exposition möglich sein [75]. Vorsorgeuntersuchungen sind dann nach der Gefahrstoffverordnung erforderlich.
Weitere Maßnahmen zum Vermeiden von Gesundheitsgefahren beim Umgang mit Holzstäuben sind in [23] beschrieben. Maßnahmen zum Vermeiden von Hauterkrankungen siehe "Hautschutzplan", Anhang 2.
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Holzstaub | |||||||||||
1. Sind alle staubintensiven Maschinen an die Absaugung angeschlossen (als weniger staubintensiv können
| O | O | O | O | |||||||
| 2. Sind eventuell vorhandene mobile Entstauber (keine Industriestaubsauger) mit dem Prüfzeichen H2 bzw. H3 gekennzeichnet? | O | O | O | O |  | ||||||
3. Werden Handmaschinen, wie
abgesaugt? | O | O | O | O |    | ||||||
| 4. Werden Handschleifarbeiten an abgesaugten Tischen durchgeführt? | O | O | O | O |  | ||||||
| 5. Ist die Wirksamkeit der Absauganlage geprüft - z.B. durch Spezialisten der BGHM (kostenfreie Service-Hotline 0800.999 0080-2) | O | O | O | O | |||||||
| 6. Werden Partikelfilter oder filtrierende Halbmasken der Schutzart " P2 NR" zur Verfügung gestellt? | O | O | O | O |  | ||||||
| 7. Werden Experten der BGHM in den Fällen eingeschaltet, wo Hinweise des Betriebsarztes auf allergische Reaktionen oder anderweitige Schädigungen durch Holzstaub vorliegen? | O | O | O | O | |||||||
4. Holzbearbeitungsmaschinen
4.1 Standard-Holzbearbeitungsmaschinen
Bei den unter 4.1 angegebenen Lärmwerten handelt es sich um Emmisionswerte, die unter festgelegten Arbeitsbedingungen ermittelt wurden. Im Betrieb können sich, je nach Arbeitsgang und Beschaffenheit von Wänden und Decken, höhere Werte ergeben.
4.1.1 Abrichthobelmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe I. Es besteht hohes Verletzungsrisiko an der Messerwelle, da das Werkstück mit der Hand unmittelbar über die Messerwelle geschoben wird. Besonders risikoreich ist das Abrichten langer schmaler (< 60 mm) Werkstücke.
Alternativausstattung für Baujahre bis 1994
Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 3 des Anhangs 3 zusammengestellt.
Betrieb
Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten an Abrichthobelmaschinen" (Anhang 2).
Stand der Absaugtechnik
Alle abgesaugten Abrichthobelmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeiten u. a.).
Beschaffenheit*
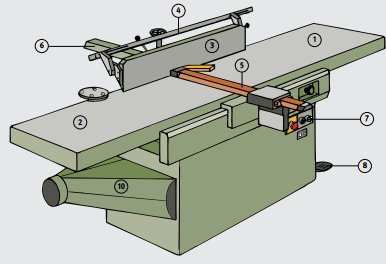
1 Aufgabetisch
2 Abnahmetisch
3 schrägstellbarer Parallelanschlag
4 schwenkbarer Hilfsanschlag
5 Messerwellenverdeckung vor dem Anschlag
6 Messerwellenverdeckung hinter dem Anschlag
7 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)
8 Höhenverstellung des Aufgabetisches
9 Fügeleiste mit Halterung
10 Absaugstutzen
Regelausstattung bis Baujahr 1995
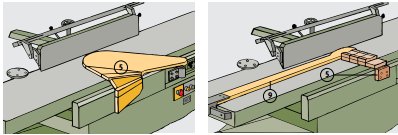
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [50]: 90 bis 91 dB(A) je nach Messerwellenlänge.
Dieser Pegel wird durch lärmmindernde gezahnte Tischlippen erreicht. Als zusätzliche Maßnahmen, insbesondere für ältere Maschinen, hat sich der Einbau von Spiralmesserwellen bewährt.
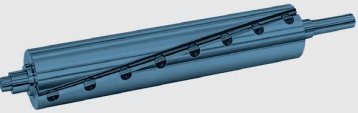
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Abrichthobelmaschinen | |||||||||||
| 1. Sind Schutzeinrichtungen wie Gliederschutz mit Fügeleiste und Hilfsanschlag oder Schwingschutz mit Hilfsanschlag oder ein Brückenschutz montiert und ohne sichtbare Mängel und werden diese benutzt? | O | O | O | O | 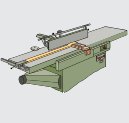 | ||||||
| 2. Sind Hilfsmittel wie Zuführlade und Schiebeholz griffbereit an der Maschine? | O | O | O | O | |||||||
| 3. Sind die Schutzeinrichtungen so eingestellt, dass die Messerwelle soweit wie möglich verdeckt ist? | O | O | O | O |  | ||||||
| 4. Werden beim Hobeln kleiner Werkstücke die Zuführlade oder das Schiebeholz verwendet und bei schmalen Werkstücken zusätzlich der Hilfsanschlag? | O | O | O | O |  | ||||||
4.1.2 Tischfräsmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe I. Es besteht hohes Verletzungsrisiko am Fräswerkzeug, das sich insbesondere aus der Häufigkeit und Schwere der Unfälle beim Bearbeiten geringer Stückzahlen ergibt. Das Werkstück wird mit der Hand unmittelbar am Werkzeug vorbeigeschoben. Eine der Ursachen ist die Nichtverwendung von Schutzvorrichtungen vor allem beim Probe- und Einsetzfräsen. Beim Fertigen von Werkstücken in großen Stückzahlen werden Schutzvorrichtungen zuverlässig benutzt. Die Gefährdung sinkt dann auf Stufe III.
Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 4 des Anhangs 3 zusammengestellt.
Beschaffenheit
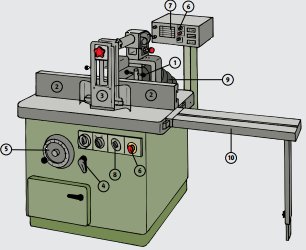
Regelausstattung ab Baujahr 1995

1 Fräsanschlag mit Schutzkasten
2 Fräsanschlaglineale
3 Werkzeugverdeckung vor dem Anschlag
4 Spindelarretierung
5 Höhenverstellung der Spindel
6 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)
7 Drehzahlanzeige
8 Schaltsperre
9 Absauganschluss
10 Tischverlängerung
Beschaffenheit der Fräswerkzeuge siehe Abschnitt 1.11.2
Betrieb
Merkregeln für das Rüsten und Einstellen:
- Nach Möglichkeit das Arbeiten mit dem Vorschubapparat vorsehen, auch beim Bogenfräsen
- Geeignete Werkzeuge auswählen, d. h. nur Werkzeuge für Handvorschub, auch für das Fräsen mit Vorschubapparat
- Die günstigste Drehzahl innerhalb des angegebenen Drehzahlbereichs einstellen
- Für Einsetzfräsarbeiten Rückschlagsicherungen vorsehen, z.B. Tischverlängerung mit Queranschlag
- Werkzeug gut befestigen, Zwischenringe so auswählen, dass das Gewinde der Fräserdorn-Mutter voll ausgenutzt wird
- Nach Möglichkeit Fräserdorne mit Mindestdurchmesser 30 mm verwenden
- Fräswerkzeug entsprechend der Drehrichtung und der vorgesehenen Arbeitshöhe aufspannen
- Tischöffnung durch Einlegeringe so weit wie möglich schließen
- Einstellvorrichtungen verwenden, Probefräsen nur mit Vorschubapparat
Weitere Hinweise zum Betrieb, insbesondere zu Rückschlagsicherungen beim Einsetzfräsen siehe Unterweisungsblätter "Sicheres Arbeiten an Tischfräsmaschinen" und "Sicheres Arbeiten mit Fräswerkzeugen für die Holzbearbeitung" (Anhang 2).
Stand der Absaugtechnik
Alle abgesaugten und mit oberer und unterer Absaugung (Tisch) ausgerüsteten Tischfräsmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeit u. a.).
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [48]: 84 dB(A).
Dieser Pegel wird mit einem Fügefräser als Normwerkzeug erreicht. Bei der Verwendung von Profilwerkzeugen können sich Pegelerhöhungen bis ca. 8 dB(A) ergeben.
Einstelleinrichtung

Rüsten einer Tischfräsmaschine mit Fräswerkzeug

Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Tischfräsmaschinen | |||||||||||
| 1. Sind für Fräsarbeiten am Anschlag Werkzeugverdeckungen wie Handabweisbügel in Verbindung mit Druckvorrichtungen (Druckfedern, Druckkämme) oder Druck- und Schutzvorrichtung vorhanden? | O | O | O | O |  | ||||||
| 2. Sind für Fräsarbeiten am Anlaufring oberer Werkzeugverdeckungen Zuführleisten vorhanden? | O | O | O | O | |||||||
| 3. Sind zum Einsatzfräsen Rückschlagversicherungen in Form von stufenlos verstellbaren Queranschlägen und für kurze Werkstücke zusätzlich eine Spannlade vorhanden und werden diese benutzt? | O | O | O | O |  | ||||||
| 4. Sind alle Werkzeuge für Handvorschub geeignet? | O | O | O | O |  | ||||||
| 5. Sind Hilfsmittel wie Schiebehölzer oder Schablonen griffbereit an der Maschine vorhanden? | O | O | O | O | |||||||
| 6. Werden die Schutzeinrichtungen so eingestellt, dass das Fräswerkezeug soweit wie möglich verdeckt ist und wird wenn möglich der Vorschubapparat verwendet? | O | O | O | O | 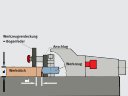 | ||||||
4.1.3 Tisch- und Formatkreissägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe I. Es besteht hohes Verletzungsrisiko durch Berühren des Sägeblattes, insbesondere beim Schneiden schmaler Werkstücke.
Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 5 des Anhangs 3 zusammengestellt.
Betrieb
Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten an Tisch- und Formatkreissägemaschinen" (Anhang 2).
Stand der Absaugtechnik
Alle abgesaugten und mit oberer (an der Haube) und unterer Absaugung (unter dem Tisch) ausgerüsteten Tisch- und Formatkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeit u. a.).
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [55]: 87 bis 91 dB(A) je nach Sägeblattdurchmesser. Nach Möglichkeit Sägeblätter verwenden, die als "lärmarm" angeboten werden. Zum Pfeifen neigende Sägeblätter sofort austauschen, sofern neu, dem Hersteller zurückgeben.
Alternativausstattung für Sägeblattdurchmesser < 250/315 mm
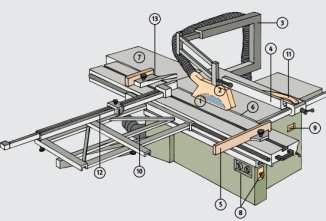
Besonders leises Kreissägeblatt (spezielle Anordnung der Schneiden, minimalste Spanlücke)
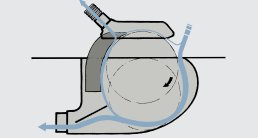
Beschaffenheit
Regelausstattung ab Baujahr 1995
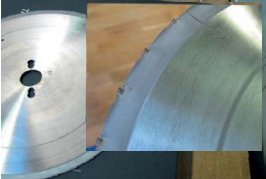
1 Spaltkeil
2 Schutzhaube mit Absauganschluss
3 Schutzhaubenträger
4 Parallelanschlag
5 kurzer Quer- und Gehrungsanschlag
6 Tischeinlage, auswechselbar
7 Tischverlängerung
8 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)
9 Drehzahlanzeige
10 Absauganschluss unten
11 Schiebestock mit Halterung
12 Queranschlag
13 Besäumniederhalter (Klemmschuh)
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Tisch- und Formatkreissägemaschinen | |||||||||||
| 1. Ist der Spaltkeil montiert und richtig eingestellt? | O | O | O | O | 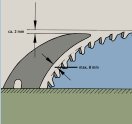 | ||||||
| 2. Wird die Schutzhaube immer auf Werkstückhöhe eingestellt? | O | O | O | O |  | ||||||
| 3. Sind Hilfsmittel wie Schiebestock, Schiebehölzer, Wechselgriffe und Besäumhilfen griffbereit an jeder Maschine vorhanden? | O | O | O | O | |||||||
| 4. Werden insbesondere beim Schneiden schmaler Werkstücke unter 120 mm Breite Schiebebstöcke und unter einer Breite von weniger als 30 mm Schiebehölzer verwendet? | O | O | O | O |  | ||||||
| 5. Wird kontrolliert, dass vor einem Sägevorgang die obere Schutzhaube grundsätzlich bis auf die Werkstückhöhe abgesenkt wird? | O | O | O | O | 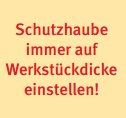 | ||||||
| 6. Sind an Tischkreissägemaschinen im Bankraum Tischverlängerungen vorhanden ? | O | O | O | O |  | ||||||
4.1.4 Dickenhobelmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Risiko der Verletzung durch Werkstückrückschläge.
Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 6 des Anhangs 3 zusammengestellt.
Stand der Absaugtechnik
Alle abgesaugten Dickenhobelmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeiten u. a.).
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [51]: 80 dB(A). Dieser Pegel wird durch absorbierende Auskleidung der oberen Haube und teilweise durch Kunststofflamellen an der Ein- und Ausschuböffnung erreicht.
Betrieb
Angaben der Betriebsanleitung hinsichtlich der Mindestlänge von Werkstücken beachten. Vorschubgeschwindigkeit entsprechend der vorgesehenen Oberflächenqualität wählen. Bei Störungen sofort den Werkstückvorschub abschalten. Rückschlaggreifer stets scharf und gängig halten.
Bereich abfliegender Werkstücke und Werkstückteile beachten.
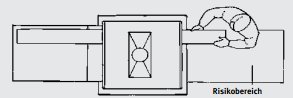
| Aufgrund neuerer Erkenntnisse ist der Messerüberstand
an älteren Maschinen (Maschinen ohne CE-Kennzeichnung) mit kraftschlüssiger Messerbefestigung - unabhängig von den Angaben in der Betriebsanleitung - aus sicherheitstechnischen Aspekten auf 1,1 mm einzustellen. Diese Einstellung empfiehlt sich auch an Maschinen mit CE-Kennzeichnung. Des Weiteren darf die Höhenverstellung nur vorgenommen werden, wenn sich kein Werkstück auf dem Maschinentisch befindet. Erläuterung: Bei Versuchsreihen wurde festgestellt, dass
|
Beschaffenheit
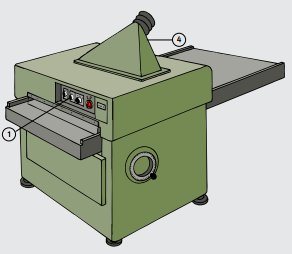
1 Stellteile (EIN - AUS, NOT - AUS)
2 Messerwelle
3 Greiferrückschlagsicherung, gegen Durchpendeln gesichert
4 Absaugung (der Anschlusstrichter zum Absaugrohr verhindert den Zugriff zur Messerwelle)
5 Druckbalken
6 Einzugswalze
7 Auszugswalze glatt
8 Tischwalzen
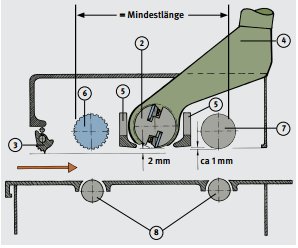
| Einen Messerüberstand von maximal 1,1 mm wählen, bei größerem Messerüberstand besteht Rückschlaggefahr!
Die Höhenverstellung des Maschinentisches nur vornehmen, wenn sich kein Werkstück in der Maschine befindet. |
- Hobeldicke = Ausgangsdicke abzüglich Spanabnahme. Dabei nicht die maximal mögliche Spanabnahme ausnutzen (hohe Belastung der Maschine), sondern durch mehrere Hobelvorgänge das Endmaß herstellen.
- Zum Hobeln nicht paralleler Flächen geeignete Schablonen verwenden, z.B. eine festliegende Schablone (siehe Bild 2) oder eine durchlaufende Schablone.
- Bei unterschiedlich dicken Werkstücken dürfen bei starren Einzugswalzen und Druckbalken im Gegensatz zu Maschinen mit Gliedereinzugswalzen und -druckbalken (siehe Bild 4) nur zwei Werkstücke gleichzeitig bearbeitet werden (siehe Bild 3). Die Werkstücke sind an den Außenseiten der Einschuböffnung zuzuführen.
| Hobeln breiter Werkstücke. Durch mehrere Hobelvorgänge das Endmaß herstellen.
| Hobeln mit Schablone.
Bei nicht parallelen Flächen geeignete Schablonen verwenden.
|
| Hobeln schmaler Werkstücke. Bei starren Einzugswalzen und Druckbalken maximal zwei Werkstücke gleichzeitig bearbeiten.
| Bei Maschinen und Gliederdruckbalken dürfen mehrere Werkstücke gleichzeitig bearbeitet werden.
|
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Dickenhobelmaschine | |||||||||||
| 1. Ist insbesondere der Schneidenüberstand auf höchstens 1,1 mm eingestellt? | O | O | O | O | 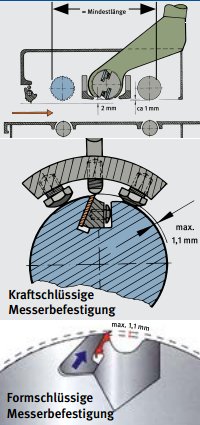 | ||||||
4.1.5 Tischbandsägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe II. Es besteht erhebliches Verletzungsrisiko durch Berührung des Sägeblattes.
Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 7 des Anhangs 3 zusammengestellt.
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Tischbandsägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern sie mit einem Erfassungselement unter der Schneidstelle und mit einer gelochten Tischeinlage (siehe Anhang 1 von [23]) ausgerüstet sind. In Schreinereien/Tischlereien mit handwerklicher Fertigung sind an Tischbandsägemaschinen, selbst ohne Anschluss an eine Absauganlage, aufgrund der geringen Einsatzzeiten dieser Maschinenart keine kritischen Konzentrationen zu erwarten.
Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [54] : 84-85 dB(A), je nach Rollendurchmesser.
Beschaffenheit
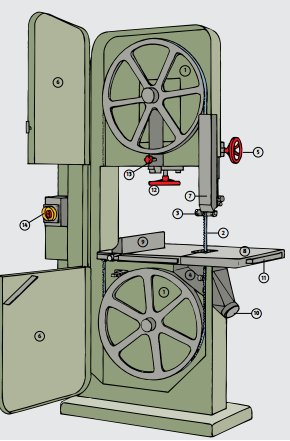
1 Bandsägerollen
2 abwärtslaufender Teil des Sägeblattes
3 obere Sägeblattführung
4 untere Sägeblattführung
5 Verstellung der oberen Sägeblattführung
6 Verkleidung der Bandsägerollen
7 verstellbare Verdeckung des Sägeblattes
8 Tischeinlage
9 Parallelanschlag
10 Absaugstutzen
11 Befestigungsschiene für Tischvergrößerung
12 Spannvorrichtung für das Bandsägeblatt
13 Neigungsverstellung der oberen Bandsägerolle
14 Stellteile (EIN-AUS, NOT-AUS)
Betrieb
Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten an Tischbandsägemaschinen" (Anhang 2).
Die Laufruhe, insbesondere im Leerlauf, wird von fachgerecht ausgeführten Bandstößen, Rollenbelägen ohne Unterbrechungen und funktionsgerechten Sägeblattführungen bestimmt.
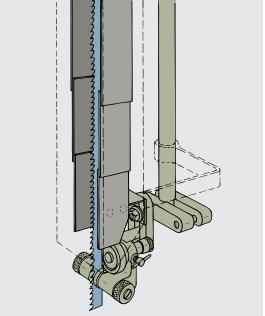
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| 1. Ist die verstellbare Verdeckung des Schneidbereichs vorhanden? | O | O | O | O | 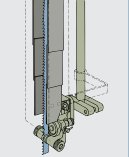 | ||||||
| 2. Ist der übrige Teil des Bandsägeblattes gesichert ? | O | O | O | O | 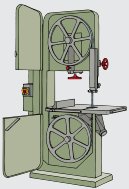 | ||||||
| 3. Wird die verstellbare Verdeckung (z.B. Winkelbrett) beim Sägen auf das Werkstück abgesenkt | O | O | O | O |  | ||||||
4.1.6 Abricht-Dickenhobelmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe I (Abrichthobelmaschine)/ III (Dickenhobelmaschine). Es gelten die gleichen Gefährdungseinstufungen wie bei den Einzelmaschinen (siehe 4.1.1 und 4.1.4).
Beschaffenheit
Grundsätzlich gelten für die Abricht- bzw. Dickenhobeleinheiten die gleichen Anforderungen, wie sie in den Abschnitten 4.1.1 und 4.1.4 für die Einzelmaschinen dargestellt sind [64].
Betrieb
Siehe 4.1.1 und 4.1.4. Zusätzliche Gefährdungen ergeben sich bei der Umrüstung der Bearbeitungsart, da hierbei auch eine Umrüstung der Sicherheitseinrichtungen erforderlich ist.
Hinweis:
An neuen Maschinen werden die o.g. Anforderungen, mit Ausnahme der Messerwellenverdeckung vor dem Anschlag, durch zwangsläufig wirkende Maßnahmen, z.B. Verriegelungsschalter, Einrastklinken, sichergestellt.
An älteren Maschinen (vor Baujahr 1995) muss die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen durch eine sicherheitsgerechte Umrüstung gewährleistet werden.
Stand der Absaug- und Lärmminderungstechnik
entsprechend Einzelmaschinen (siehe 4.1.1 und 4.1.4).
Der Zugriff zum unteren Teil der Messerwelle muss verhindert werden, z.B. durch die unten angebrachte elektrisch verriegelte Absaughaube


Beim Dickenhobeln muss der Zugriff zum oberen Teil der Messerwelle verhindert werden, z.B. durch die Absaughaube. Wenn die Abrichttische in die senkrechte Position geschwenkt werden, müssen diese gegen Kippen gesichert werden.

4.1.7 Kombinierte Tisch- und Gehrungskappkreissägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe II. Es gelten die gleichen Gefährdungseinstufungen wie bei der Tisch- bzw. handbetätigten Gehrungskappkreissägemaschine (siehe 4.1.3 und 4.2.1).
Die sicherheitstechnischen Anforderungen werden in [57] geregelt.
Betrieb
- Bei Maschinen nach Bild 1 muss beim Betreiben als Tischkreissägemaschine der Spaltkeil eingeschwenkt bzw. eingebaut und die Sägeblattverdeckung angebracht werden
- Parallelanschlag montieren
- Bei Maschinen nach Bild 2 muss beim Betreiben als Gehrungskappkreissägemaschine das Sägeblatt über dem Sägetisch vollständig verkleidet werden
- Für eine ergonomische Arbeitsweise Maschine möglichst auf ein Untergestell oder einen Tisch aufsetzen
Stand der Absaug- und Lärmminderungstechnik entsprechend Einzelmaschinen (siehe 4.1.3 und 4.2.1).
| Als Gehrungskappsäge
| Als Tischkreissäge
|
| Als Gehrungskappsäge
| Als Tischkreissäge (ohne Parallelanschlag abgebildet)
|
4.1.8 Handmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe insgesamt II. Es besteht erhebliches Verletzungsrisiko durch Berühren des Werkzeuges oder durch wegfliegende Teile. Bei langandauernden Arbeiten mit Handstich- und Handschwingschleifmaschinen (mehr als 2 h/Tag) sind Gesundheitsschäden durch Hand-/Armschwingungen nicht sicher auszuschließen.
Allgemeine Merkregeln zur sicheren Handhabung:
- Maschine nur so verwenden, wie es der Hersteller in der Bedienungsanleitung vorsieht
- Kontrollieren, ob alle Schutzeinrichtungen an der Maschine angebracht sind und ob Anschlussleitung und Steckvorrichtung keine Beschädigungen aufweisen
- Zum Werkzeugwechsel Maschine von der Energiezufuhr trennen
- Beide Hände verwenden, wenn die Maschine für das Führen mit zwei Händen vorgesehen ist
- Nach dem Arbeitsgang die Maschine sofort ausschalten. Werkzeugstillstand abwarten. Maschine in einer sicheren Lage ablegen
- Maschine nur mit dem Geräteschalter ein- und ausschalten. Nicht durch Betätigen der Steckvorrichtung ein- oder ausschalten
- Die elektrische Steckvorrichtung nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose herausziehen
- Vor dem Beseitigen von Störungen Maschine sofort stillsetzen und von der Energiezufuhr trennen
Nach § 22 des Änderungsgesetzes vom 24.02.1997 zum Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendliche nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können.

Deshalb ist auch die Beschäftigung mit folgenden Handmaschinen untersagt:
- Handkreissägemaschinen
- Handoberfräsmaschinen
- Lamellendübelfräsmaschinen
- Handhobelmaschinen
- Handkettensägemaschinen
- Handbandsägemaschinen
Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer mindestens 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.
Das Verbot gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit
- die Tätigkeit zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist
- ihr Schutz durch die Aufsicht eines
Fachkundigen gewährleistet ist - der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen unterschritten wird
Ausbildungsziele und die einzelnen Ausbildungsschritte sind in den Ausbildungsordnungen oder Rahmenlehrplänen festgelegt.
Stand der Absaugtechnik
Möglichst alle zerspanend arbeitenden Handmaschinen zur Bearbeitung von Holz oder Holzwerkstoffen absaugen. Nur mit ausreichend wirksamen integrierten Absaugeinrichtungen (Staub- und Spänefangbeutel an der Maschine) betreiben oder an externe Absaugeinrichtungen (z.B. Industriestaubsauger der Klasse M) anschließen, z.B. Handhobelmaschinen, Handkreissägemaschinen. Siehe auch BG-Information "Holzstaub-Gesundheitsschutz" (BGI 739-1) [23]
Angaben in der Betriebsanleitung über Absaugstutzen, Mindestluftgeschwindigkeit und Unterdruck beachten!
Möglichst Staubsauger mit eingebauter "Automatiksteckdose" verwenden, der sich automatisch mit der Handmaschine ein- und ausschaltet.
Als transportable externe Absaugeinrichtungen dürfen nur geprüfte Industriestaubsauger oder Kombigeräte (Kombination aus Entstauber und Industriestaubsauger) verwendet werden.
Stand der Lärmminderungstechnik
Der Stand der Lärmminderungstechnik ist in den einzelnen Produktnormen der Handmaschinen beschrieben. An den im Folgenden beschriebenen Maschinen sind Schalldruckpegel über 90 dB(A) zu erwarten. Es empfiehlt sich, auch bei kurzen Laufzeiten Gehörschutz zu tragen. Die Lärmminderungsmöglichkeiten beschränken sich für den Anwender auf wenige Punkte:
- Stets scharfe Werkzeuge verwenden.
- Schwingungsfreie Werkstückauflagen schaffen, z.B. durch Gummi- oder Weichkunststoff-Zwischenlagen.
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Handmaschinen | |||||||||||
| 1. Werden für Arbeiten mit Handkreissägen immer wenn möglich Führungsschienen, für Arbeiten mit Lamellendübelfräsmaschinen Arbeitstische mit Spannvorrichtungen für das Werkstück benutzt? | O | O | O | O |   | ||||||
| 2. Sind die Beschäftigten im sicheren Umgang mit Handmaschinen unterwiesen? | O | O | O | O | |||||||
4.1.8.1 Handkreissägemaschinen
Beschaffenheit
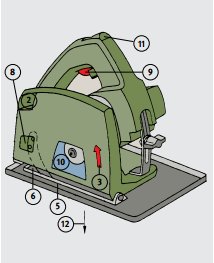
Tauchkreissäge
1 Feste Verkleidung
2 Späneauswurföffnung, Absauganschluss
3 Drehrichtungsangabe für das Sägeblatt
4 Bewegliche Schutzhaube
5 Führungsplatte, Sägetisch
6 Spaltkeil
7 Öffnungsrichtung der beweglichen Schutzhaube
8 Spaltkeilhalterung
9 Handgriff mit EIN-AUS-Schalter
10 Sägeblatt
11 Entriegelungshebel für Raste in Ausgangsstellung
12 Eintauchrichtung
Handkreissäge mit Pendelschutzhaube
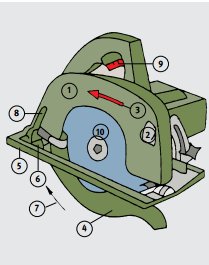
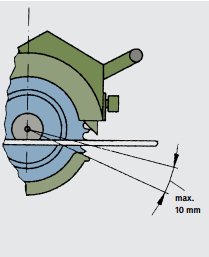
Die bewegliche Schutzhaube muss den aus dem Sägetisch herausragenden Teil des Sägeblattzahnkranzes am Umfang und beidseitig bis auf einen Öffnungswinkel von 10° verdecken.
Spaltkeil
Handkreissägemaschinen müssen mit einem Spaltkeil ausgerüstet sein. Ausnahmen für neue Maschinen ab Baujahr 2007 siehe EN 6074-2-5.
Die Dicke des Spaltkeils muss der Dicke des Kreissägeblattes angepasst sein. Der Spaltkeil darf nicht dicker als die Schnittfugenbreite und nicht dünner als der Sägeblattgrundkörper sein.
Spaltkeilabstand vom Kreissägeblatt so gering wie möglich einstellen. Der Abstand darf nicht größer als 5 mm sein.
Spaltkeil ca. 2 mm unter der höchsten Sägezahnspitze einstellen.
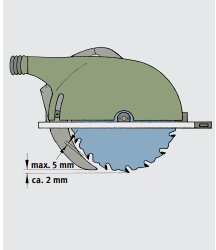
Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten mit Handmaschinen" (Anhang 2).
Kreissägeblatt
Für Material und Arbeitsgang geeignetes Kreissägeblatt verwenden. Beispiele hierzu siehe folgende Bildreihe.
| HM-Flachzahn
Für Rohzuschnitt von Vollholz (Massivholz) in Faserrichtung | HM-Wechselzahn
Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten und weiche Kunststoffe | HM-Wechselzahn
Für Platten mit beschichteten oder furnierten Oberflächen und Vollholz (Massivholz) quer zur Faserrichtung | HM-Trapezflachzahn
Für Aluminiumplatten und -profile, harte und faserverstärkte Kunststoffe |
 |  |  |  |
Höchstzulässige Drehzahl des Kreissägeblattes nicht überschreiten.
Kreissägeblatt wegen möglicher Beschädigung der Schneiden nie direkt auf dem Maschinentisch, sondern immer auf weichen Unterlagen, z.B. Holz, Pappe, ablegen.
Verharzungen durch Reinigungsbad entfernen (Reinigungszeit nach Gebrauchsanleitung beachten).
Beschädigte Kreissägeblätter, z.B. mit ausgebrochenen Zähnen, Rissen, der Benutzung entziehen.

- Schnittqualität
- Vorschubkräfte
- Schnittkräfte
Kreissägeblätter mit
- großem Spanwinkel bevorzugen zum Schneiden in Faserrichtung,
- kleinem Spanwinkel bevorzugen zum Schneiden quer zur Faserrichtung und von Spanplatten.
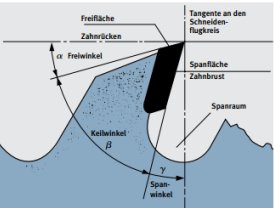
| Maschine grundsätzlich mit beiden Händen führen. |
Zuschneiden von Vollholz (Massivholz)
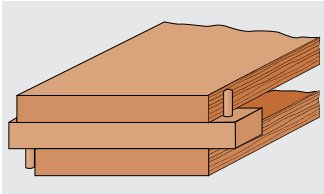
Werkstück gegen Verschieben sichern, z.B. mit Dübeln.
Kreissägeblatt für Querschnitt wählen.
Spaltkeilabstand und Befestigung prüfen.
Zuschneiden von Plattenmaterial

Kreissägeblatt für Plattenmaterial wählen (z.B. vielzahniges HM-Wechselzahn-Sägeblatt).
Für eine sichere Führung der Handkreissägemaschine sorgen, z.B. durch Führungslineal oder Führungsschiene.
Einsetzsägen

| Werden Handkreissägemaschinen stationär in Tische eingebaut, sind die Anforderungen an Tisch- und Formatkreissägemaschinen zu beachten. |
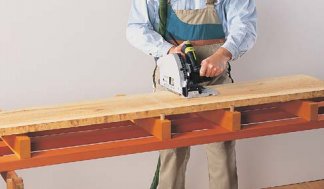
Erforderliche Schnitttiefe einstellen (Richtwert: höchstens 10 mm mehr als Werkstückdicke).
Unterlagen so anordnen, dass das Sägeblatt unter dem Werkstück frei läuft.
Montagearbeiten

Für Montageschnitte beim Innenausbau geeignete Arbeitsvorrichtungen zur sicheren Werkstückauflage und präzisen Werkzeugführung benutzen.
Tauchkreissäge verwenden. Spaltkeil entfernen, gegebenenfalls Spaltkeilhalterung festziehen. Führungsschiene auf Werkstück auflegen und festspannen. Anschlagnocken für Einsetzpunkt und Aussetzpunkt an der Führungsschiene befestigen.
Handkreissägemaschine am hinteren Anschlagnocken anlegen. Nach dem Einschalten der Maschine Sägeblatt in das Werkstück eintauchen und Maschine bis zum vorderen Anschlagnocken vorschieben. Sägeblatt aus dem Werkstück schwenken und Maschine ausschalten.
Nach Beendigung der Einsetzarbeiten den Spaltkeil wieder anbringen.
4.1.8.2 Handstichsägemaschinen
Beschaffenheit
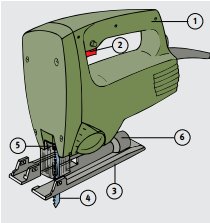
1 Handgriff
2 EIN - AUS-Schalter
3 Führungsplatte, Sägetisch
4 Sägeblatt
5 Berührungsschutz oberhalb des Führungstisches
6 Absauganschluss
Betrieb
Bei mehr als 2-stündigem Arbeiten mit der Handstichsägemaschine sollt im Rahmen der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung der Betriebsarzt zur Bewertung der dadurch verursachten Hand-/Armschwingungen hinzugezogen werden.
Für den zu bearbeitenden Werkstoff das geeignete Sägeblatt auswählen
Für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt auswählen.

Vollholz (Massivholz)
grobe Zahnteilung, Wechselschliff und großer Spanwinkel

Plattenwerkstoffe
feine Zahnteilung, Wechselschliff und mittlerer Spanwinkel

Kunststoffe
mittlere Zahnteilung, Wechselschliff und mittlerer Spanwinkel
Metalle
Wellenzahnung und sehr kleiner Spanwinkel

| ||
| Herstellen geschweifter Werkstücke
. Werkstück auflegen, gegebenenfalls festspannen bzw. gegen Verschieben sichern. Maschine mit dem Sägetisch an der Werkstückkante ansetzen. Danach Maschine einschalten und Arbeitsgang durchführen. Werkstück oder Abfallstücke nicht im Schneidbereich halten. | Herstellen von Ausschnitten
Ansetzpunkte für Innenschnitte durch Bohrungen herstellen. Bohrungsdurchmesser sollte mindestens 3 mm größer als die Sägeblattbreite sein, um ein Klemmen im Ansetzpunkt zu vermeiden. Maschine erst mit dem Sägetisch aufsetzen, dann einschalten. Darauf achten, dass sich das Sägeblatt während des Schneidvorganges unter dem Werkstück frei bewegen kann, z.B. bei Ausschnitten in Decken- oder Wandverkleidungen. | |
4.1.8.3 Handhobelmaschinen
Beschaffenheit
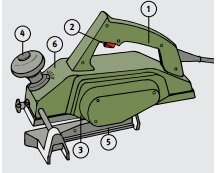
1 Handgriff
2 EIN - AUS-Schalter
3 Messerwelle (nicht sichtbar)
4 Hobeltiefeneinstellung
5 Führungsanschlag
6 Späneabsauganschluss (nicht sichtbar)
Betrieb

Messerwelle
An Handhobelmaschinen sind nur runde Messerwellen mit einem Schneidenüberstand von maximal 1,1 mm zulässig.
Die Messer müssen formschlüssig befestigt sein.
| Maschine grundsätzlich mit beiden Händen führen. |
Hobeln von Flächen

Werkstück sicher einspannen. Vorgesehene Spanabnahme einstellen.
Maschine mit vorderem Teil der Führungsfläche auf dem Werkstück aufsetzen. Maschine sofort nach Beendigung des Arbeitsganges ausschalten.
Maschine erst nach Auslauf der Messerwelle ablegen.
Beim Ablegen Maschine nicht auf die Messerwellenschneide stellen.
4.1.8.4 Handoberfräsmaschinen
Beschaffenheit
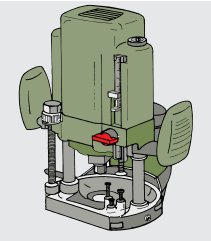
Betrieb
Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten mit Handmaschinen" (Anhang 2). Sieht der Hersteller den Einbau einer Handoberfräsmaschine in einen Tisch ausdrücklich vor, sind die Anforderungen des Herstellers gemäß der Bedienungsanleitung zu beachten.

Bearbeiten von Werkstückkanten

Werkstück gegen Verschieben sichern. Maschine mit dem Frästisch an der Werkstückkante aufsetzen und bei Maschinenstillstand Fräshöhe und Frästiefe einstellen. Danach Maschine einschalten und mit dem Anlaufring an der Werkstückkante führen. Nur im Gegenlauf fräsen.

Einfräsen von Nuten

Werkstück gegen Verschieben sichern. Führungsschiene oder Schablone auf dem Werkstück befestigen. Maschine mit dem Frästisch auf Führungsschiene aufsetzen.
Wird eine Schablone verwendet, Maschine mit dem Frästisch auf Schablone aufsetzen und bei Maschinenstillstand Frästiefe einstellen. Maschine in Ausgangsstellung zurückführen. Danach Maschine einschalten und Arbeitsgang durchführen.

Kombinierte Bohr-Frässchablone Schablonen und Vorrichtungen können häufig so gestaltet werden, dass verschiedene Arbeitsgänge an demselben Werkstück oder verschiedene Arbeitsgänge an unterschiedlichen Werkstücken ausgeführt werden können. Schablone ausreichend stabil machen. Schablonen müssen so groß sein, dass sie durch Druck auf die Handgriffe der Kniehebel nicht kippen können. Höhe der Schablone möglichst gering wählen, damit die Werkzeugverdeckung möglichst weit auf den Maschinentisch abgesenkt werden.

Stabile und abriebfeste Schablonenkanten vorsehen. Geeignet sind z.B. Multiplexplatten oder mit Massivholzanleimern oder Kunststoffkanten beschichtete Führungskanten. Bei Bohrschablonen Buchsen einsetzen. Gute Gleitfähigkeit auf dem Maschinentisch sicherstellen, z.B. durch einen Belag mit niedrigem Reibwert. Schablonengewicht an den Arbeitsgang anpassen:
- Schwerer: Beim Fräsen von geschweiften Werkstücken mit handgeführten Schablonen. Da der Werkstückwechsel nur in sicherem Abstand vom Werkzeug durchgeführt werden darf, kann bei solchen Schablonen eine Vergrößerung der Tischauflage notwendig werden.
- Leichter: Schablonenschneiden auf Kreissägemaschinen oder Tischbandsäge oder wenn Schablone vom Maschinentisch weggehoben werden muss.

Vorrichtung zum Bearbeiten von Werkstücken in der Fläche und zum Herstellen von Innenkonturen
Werkstück in Schablonengrundplatte einlegen und mit einem eingenuteten Schieber (z.B. T-Nut) auf der Hobelbank mit Bankhaken spannen.


Mit Handoberfräse Kontur herstellen

Frässchablone mit eingearbeiteter Kontur auf Grundplatte auflegen. Diese muss formschlüssig (z.B. durch Dübel) auf der Grundplatte fixiert werden.
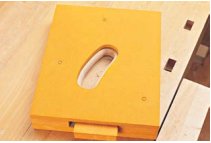
4.1.8.5 Lamellendübelfräsmaschinen
Beschaffenheit
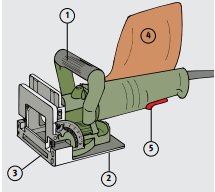
1 Handgriff
2 Führungsplatte
3 Fräswerkzeug (nicht sichtbar)
4 integrierte Späneabsaugung
5 EIN - AUS-Schalter
Fräswerkzeuge

In Formfedernutfräsmaschinen sind nur Fräswerkzeuge zu verwenden, die entweder mit der Aufschrift "MAN" und ggf. dem BG-TEST-Prüfzeichen oder bei älteren Werkzeugen mit der Aufschrift "HANDVORSCHUB" bzw. dem BG-TEST-Prüfzeichen gekennzeichnet sind.
Die auf dem Fräswerkzeug angegebene höchstzulässige Dreh zahl darf nicht überschritten oder der angegebene Drehzahlbereich muss eingehalten werden
Betrieb
Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten mit Handmaschinen" (Anhang 2).
| Maschine grundsätzlich mit beiden Händen führen. |
Einfräsen von Nuten

Werkstück bei liegender Bearbeitung auf eine ebene Unterlage auflegen.

Werkstück bei stehender Bearbeitung durch Stützwinkel sichern.
| Werkstücke festspannen. |
Ausfräsen von Harzgallen

Beim Harzgallenausfräsen Maschine mit beiden Händen führen.
| Werkstücke festspannen. |
Detailansicht einer Schablone zum Harzgallenfräsen.
Die Maschine wird auf drei Seiten geführt und kann somit mit zwei Händen geführt werden.
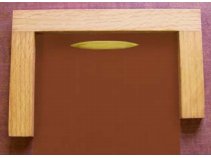
4.1.8.6 Winkel- und Trennschleifer
Beschaffenheit
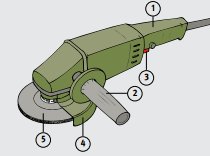
1 Handgriff
2 Zusatzgriff
3 EIN-AUS-Schalter
4 Schutzhaube
5 Schleifkörper
Durch die Schutzhaube müssen mindestens 175° des Schleifkörperumfanges und die zur Maschine hin gerichtete Seite verdeckt sein.
Für das zu bearbeitende Material geeignete Schleifkörper oder Trennscheiben verwenden. Angegebene Verwendungsbeschränkungen beachten. Spannflansche zum Befestigen der Schleifkörper unter Berücksichtigung von
- Schleifkörperform
- Schleifkörpermaßen
- Schleifkörperbindung
- Maschinenart
auswählen.
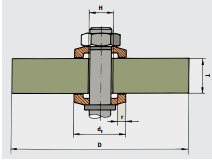
Spannflanschdurchmesser d1: z.B. bei
- Handschleifmaschinen mit geradem Schleifkörper d1 = 1/3 D
- Handtrennschleifmaschinen d1 = 41 mm
Schleifkörper
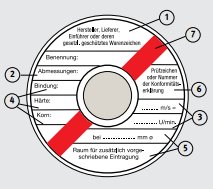
Nur Schleifkörper verwenden, die mindestens mit folgenden Angaben gekennzeichnet sind:
1 Hersteller, Lieferer, Einführer oder deren geschütztes Warenzeichen,
2 Nennmaße
3 Arbeitshöchstgeschwindigkeit oder zulässige Drehzahl
4 Schleifmittel und Bindung
5 ggf. Verwendungsbeschränkungen
6 Prüfvermerk (bis Herstellungsdatum 31.03.1996) oder Prüfzeichen mit der Aufschrift "Geprüft nach § 15 Abs. 1 UVV VBG 49" oder Nummer der Konformitätsbescheinigung einer akkreditierten Prüfstelle
7 Farbstreifen für Höchstgeschwindigkeiten
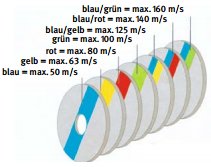
- Schleifwerkzeuge nur bis zur angegebenen Arbeitshöchstgeschwindigkeit oder zulässigen Drehzahl betreiben
- Nach jedem Befestigen einer Schleifscheibe einen Probelauf von mindestens 30 Sekunden vornehmen. Dabei jedoch höchstens die auf der Schleifscheibe angegebene Arbeitshöchstgeschwindigkeit oder zulässige Drehzahl an der Schleifmaschine einstellen
- Winkelschleifer und Trennschleifer nur mit Schutzhaube betreiben
- Zur Bearbeitung muss das Werkstück gegen Verschieben gesichert sein
- Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden
- Maschine immer beidhändig führen. Nicht verkanten! (Trennscheiben können zerspringen!)
- Darauf achten, dass besonders beim Trennschleifen durch Funkenflug kein Brand verursacht wird. Abgeschliffene heiße Metallteilchen können bis 10 m weit fliegen!
4.1.8.7 Eintreibgeräte
Beschaffenheit
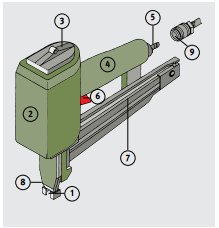
1 Auslösesicherung
2 Gehäuse
3 Aufhänger
4 Handgriff
5 Anschlussnippel
6 Auslöser
7 Magazin
8 Mündung
9 Schnellkupplung
Eintreibgeräte können je nach Verwendungszweck mit unterschiedlichen Auslösesystemen ausgerüstet sein, z.B. Einzelauslösung, Einzelauslösung mit Sicherungsfolge, Kontaktauslösung, Dauerauslösung.
Energiezufuhr
Sauerstoff und brennbare Gase dürfen als Energiequelle für druckluftbetriebene Eintreibgeräte nicht verwendet werden.
Druckluftbetriebene Geräte nur an Leitungen anschließen, bei denen der maximal zulässige Druck des Gerätes um nicht mehr als 10% überschritten werden kann. Sonst muss ein Druckregelventil (Druckminderer) mit nachgeschaltetem Druckbegrenzungsventil eingebaut sein.
Der auf druckluftbetriebenen Eintreibgeräten angegebene zulässige Druck darf nicht überschritten werden.
Betrieb
Nur die in der Betriebsanleitung bezeichneten Eintreibgegenstände, z.B. Nägel, Klammern, Stifte, Wellenklammern, Dübel, Muffen, Kabelschellen, Bodenträger, verwenden.
Eintreibgeräte, die mit einem auf der Spitze stehenden Dreieck  gekennzeichnet sind, nur mit wirksamer Auslösesicherung betreiben.
gekennzeichnet sind, nur mit wirksamer Auslösesicherung betreiben.
Eintreibgeräte ohne diese Kennzeichnung, die bis zum 31.12.1974 hergestellt worden sind und bei denen Eintreibgegenstände von mehr als 25 mm Eintreiblänge verwendet werden können, ebenfalls nur mit einer wirksamen Auslösesicherung betreiben.
Eintreibgeräte, die mit Kontaktauslösung oder Dauerauslösung mit Auslösesicherung ausgerüstet sind, dürfen nicht verwendet werden:
- auf Baustellen oder bei wechselnden Arbeitsplätzen, insbesondere auf Gerüsten, Treppen, Leitern und beim Einlatten von Schrägdächern
- zum Schließen von Kisten oder Verschlägen
- beim Anbringen von Transportsicherungen, z.B. auf Fahrzeugen und Waggons
Es wird empfohlen, an diesen Geräten eine Kennzeichnung vorzunehmen.

Bei Störungen, z.B. durch verklemmte Eintreibgegenstände, Gerät sofort von der Energiequelle trennen.
Defekte oder nicht einwandfrei arbeitende Eintreibgeräte sofort von der Druckluft abkuppeln und einem Sachkundigen zur Prüfung zuleiten.
4.2 Sonstige
Sägemaschinen
4.2.1 Stationäre handbetätigte Gehrungskappkreissägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe II. Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko am Sägeblatt infolge:
- nicht ausreichender Verdeckung in der oberen Ausgangsstellung
- falscher Arbeitsweise, weil das Sägeblatt nicht ganz in die obere Schutzstellung geführt wird, während gleichzeitig das Werkstück vorgeschoben wird.
Beschaffenheit
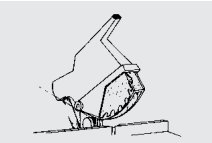
Maschine mit Schleppschutzhaube
Betrieb

Maschine mit Linienlaser

- Bei langen Werkstücken zusätzliche Werkstückauflage anbringen
- Werkstück fest gegen den Werkstückanschlag drücken
- Beim Verschieben des Werkstückes oder beim Entnehmen von Abschnitten nie unter das ungesicherte Sägeblatt greifen
- Zum einfachen Erkennen der Schnittfuge möglichst Linienlaser einsetzen
- Prüfen, ob das Sägeaggregat selbsttätig in die obere Ausgangsstellung zurückkehrt
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Gehrungskappkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [57]: 86 bis 89 dB(A) je nach Sägeblattdurchmesser.
Die Möglichkeiten des Anwenders zur Lärmminderung beschränken sich auf den Einsatz sogenannter lärmarmer und scharf gehaltener Sägeblätter.
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Stationäre handbetätigte Gehrungskappkreissägemaschinen | |||||||||||
| 1. Verdeckt die Schutzhaube nach jedem Schnitt das Sägeblatt vollständig? | O | O | O | O |  | ||||||
| 2. Sind die Beschäftigten darüber informiert, dass das Werkstück erst dann vorgeschoben werden darf und Abfallstücke erst dann entnommen werden dürfen, wenn sich die Säge wieder in der Ausgangsstellung befindet? | O | O | O | O | |||||||
| 3. Sind die Beschäftigten darüber informiert, dass sie eine Schutzbrille tragen müssen? | O | O | O | O | |||||||
4.2.2 Handbetätigte Pendelkreissägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Verletzungsrisiko am Sägeblatt in Ruhestellung.
Bei Beschäftigten, die ausschließlich schwere Bretter und Massivholzbohlen zuschneiden, kann die Wirbelsäule durch Heben und Tragen der Lasten geschädigt werden (Gefährdungsstufe II).
Betrieb
- Bei langen Werkstücken zusätzliche Werkstückauflage anbringen
- Werkstück fest gegen den Werkstückanschlag drücken
- Beim Verschieben des Werkstückes oder Entnehmen von Abschnitten nie vor das ungesicherte Sägeblatt greifen
- Teile der Werkstückanschläge austauschen, wenn Durchtrittsöffnung für das Sägeblatt zu groß
- Nur spezielle Querschnittsägeblätter mit Spanwinkel: 55 ° verwenden
- An Arbeitsplätzen mit ständigem oder häufigem Zuschnitt schwerer Bretter und Massivholzbohlen Hebeeinrichtungen zur Verfügung stellen
- Prüfen, ob das Sägeaggregat selbsttätig in die hintere Ausgangsstellung zurückkehrt
Beschaffenheit
Regelausstattung
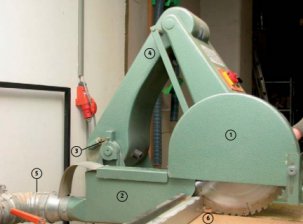
Durchtrittsöffnung für das Sägeblatt im Anschlag (max. Breite 8 mm)
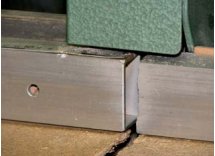
1 Schutzhaube
2 Sägeblattverdeckung in Ausgangsstellung
3 Bolzen für Einrastklinke (Festhaltevorrichtung der Säge in Ausgangsstellung)
4 Selbsttätige Rückführung des Sägeaggregates in die Ausgangsstellung
5 Absauganschluss
6 Tisch (ggf. mit abklappbarer Tischverbreiterung)
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Pendelkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern sie mit einer Späneerfassung nach Anhang 1 von [23] ausgerüstet sind.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [60]: 89 bis 94 dB(A) je nach Sägeblattdurchmesser. Neben der Auswahl lärmarmer Sägeblätter empfiehlt es sich, die obere und untere Schutzhaube schallabsorbierend auszukleiden. Allerdings darf der Abstand zwischen Auskleidung und Sägeblatt nicht kleiner als 20 mm sein.
Sägeblattverkleidung mit schallabsorbierender Auskleidung

Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Handbetätigte Pendelkreissägemaschinen | |||||||||||
| 1. Geht das Sägeblatt insbesondere nach Beendigung des Sägevorganges selbsttätig in Ausgangsstellung zurück und ist es in dieser Stellung vollständig verkleidet? | O | O | O | O | 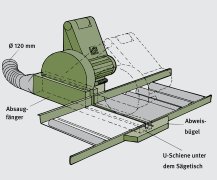 | ||||||
4.2.3 Handbetätigte Auslegerkreissägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Verletzungsrisiko am Sägeblatt in Ruhestellung.
Bei Beschäftigten, die ausschließlich schwere Bretter und Massivholzbohlen zuschneiden, kann die Wirbelsäule geschädigt werden (Gefährdungsstufe II).
- Betrieb
- Bei langen Werkstücken zusätzliche Werkstückauflage anbringen
- Werkstück fest gegen den Werkstückanschlag drücken
- Beim Verschieben des Werkstückes oder Entnehmen von Abschnitten nie vor das ungesicherte Sägeblatt greifen
- Teile der Werkstückanschläge austauschen, wenn Durchtrittsöffnung für das Sägeblatt zu groß
- Nur spezielle Querschnittsägeblätter mit Spanwinkel: 55 ° verwenden
- An Arbeitsplätzen mit ständigem oder häufigem Zuschnitt schwerer Bretter und Massivholzbohlen Hebeeinrichtungen zur Verfügung stellen
- Prüfen, ob das Sägeaggregat selbsttätig in die hintere Ausgangsstellung zurückkehrt
Beschaffenheit
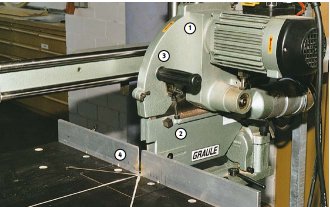
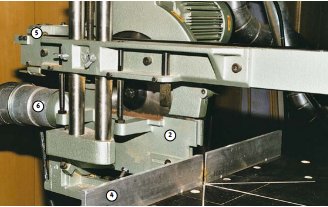
1 Schutzhaube
2 Sägeblattverkleidung in Ausgangsstellung
3 Festhaltevorrichtung (Einrastklinke)
4 Werkstückanschlag
5 Selbsttätige Rückführung des Sägeaggregates in Ausgangsstellung
6 Absauganschluss
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Auslegerkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [59]: 89 dB(A), je nach Sägeblattdurchmesser. Neben der Auswahl lärmarmer Sägeblätter empfiehlt es sich, die obere und untere Schutzhaube schallabsorbierend auszukleiden. Allerdings darf der Abstand zwischen Auskleidung und Sägeblatt nicht kleiner als 20 mm sein.
Optimierungsvorschlag für Maschinen für Gehrungsschnitte
Variante für gerade Schnitte
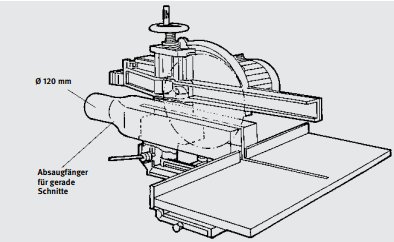
Variante für beliebige Gehrungsschnitte
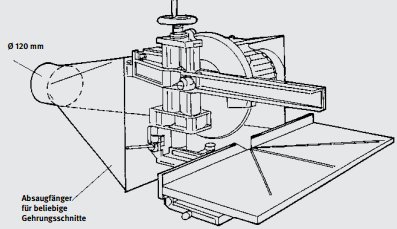
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Handbetätigte Auslegerkreissägemaschinen | |||||||||||
| 1. Geht das Sägeblatt insbesondere nach Beendigung des Sägevorganges selbsttätig in Ausgangsstellung zurück und ist es in dieser Stellung vollständig verkleidet? | O | O | O | O |  | ||||||
4.2.4 Vertikal-Plattenkreissägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Risiko der Sägeblattberührung in Ausgangsstellung und während des Schnittes.
Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 9 des Anhangs 3 zusammengestellt.
Betrieb
- Grundsätzlich Spaltkeil verwenden Beim Einsetzschneiden darf der Spaltkeil ausgeschwenkt sein.
- Bewegliches Schutzhaubenteil auf Leichtgängigkeit überprüfen
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Vertikal-Plattenkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [56]: 77-88 dB(A), je nach Sägeblattdurchmesser. Dies wird i.d.R. durch ausgekleidete Sägeaggregate erreicht. Nachträgliche Lärmminderungsmaßnahmen durch den Betreiber beschränken sich auf die Auswahl lärmarmer Sägeblätter.
Beschaffenheit
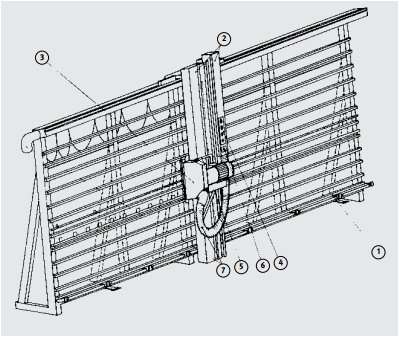
Regelausführung
1 Gestell (Werkstückauflage)
2 Sägewagen
3 Sägeaggregat
4 Bedienelemente
5 Handgriff
6 Notaus-Schalteinrichtung
7 Absaugung
| Selbsttätig schließende Sägeblattverkleidung
| Sägeblattwechsel
|
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Vertikal-Plattenkreissägemaschinen | |||||||||||
| 1. Ist insbesondere der Spaltkeil montiert und richtig eingestellt? | O | O | O | O |  | ||||||
4.2.5 Horizontal-Plattenkreissägemaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. In Schreinereien/ Tischlereien mit einem großen Anteil an Plattenbearbeitung besteht ein geringes Risiko der Sägeblattberührung während des Schnitthubes.
Bei Personen, die ausschließlich mit Plattenzuschnitt beschäftigt sind, kann die Wirbelsäule durch Heben und Tragen der Lasten geschädigt werden (Gefährdungsstufe II).
Betrieb
- Beschädigte Lamellen austauschen
- An Arbeitsplätzen mit ständigem Plattenzuschnitt Hebeeinrichtungen zur Verfügung stellen
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Horizontal-Plattenkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [56]: 80-82 dB(A). Nachträgliche Lärmminderungsmaßnahmen durch den Betreiber beschränken sich auf die Auswahl lärmarmer Sägeblätter.
Beschaffenheit
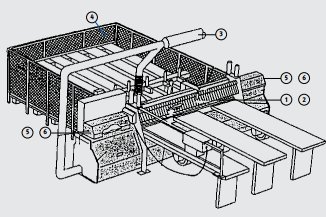
Regelausrüstung
1 Druckbalkensicherung (Schaltleiste)
2 Lamellenvorhang als Sicherung des Schneidbereichs neben den Werkstücken
3 Absauganschluss
4 Zugriffsicherung von der Rückseite (z.B. durch Umzäunung)
5 Verkleidung des Sägeblattes in den Endstellungen
6 Elektrische Verriegelung der beweglichen Verkleidung in der Sägeblattwechselstellung mit dem Sägeblattantrieb und Zuhaltung bis zum Werkzeugstillstand

Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Horizontal-Plattenkreissägemaschinen | |||||||||||
| 1. Ist die Druckbalkensicherung (Schaltleiste) funktionsfähig? | O | O | O | O | 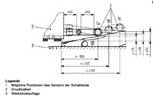 | ||||||
| 1. Wurden beschädigte Streifen des Lamellenvorhanges ersetzt? | O | O | O | O | 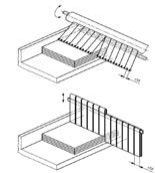 | ||||||
| 1. Wurde die Maschine so aufgestellt, dass im Ausschubbereich ein Mindestabstand zwischen festen Teilen der Umgebung und dem von der Säge größtmöglich zu bearbeitendem Werkstück von 500 mm sichergestellt ist? | O | O | O | O | 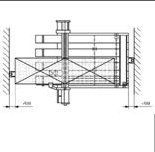 | ||||||
4.2.6 Mehrblattkreissägemaschinen mit Plattenbandvorschub
Risiko
Gefährdungsstufe II. In Schreinereien/ Tischlereien mit einem großen Anteil an Vollholzbearbeitung besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Rückschläge von Werkstücken und Werkstückteilen.
Bei Beschäftigten, die ausschließlich mit Vollholzzuschnitt beschäftigt sind, kann die Wirbelsäule durch Heben und Tragen der Lasten geschädigt werden (Gefährdungsstufe II).
Betrieb
- Rückschlaggreifer und Splitterfänger leichtgängig, Rückschlaggreifer scharfkantig halten
- Druckwerk nur verstellen, wenn sich kein Werkstück mehr in der Maschine befindet
- Beim Beschicken der Maschine direkt vor der Einschuböffnung Lederschürzen mit Splitterschutz tragen
- Zum Wechsel schwerer Sägepakete Hebehilfen einsetzen und Schutzhandschuhe tragen
- An Arbeitsplätzen mit ständigem Vollholzzuschnitt Hebeeinrichtungen zur Verfügung stellen
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Mehrblattkreissägemaschinen mit Plattenbandvorschub entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [58]:
85 bis 86 dB(A). Nachträgliche Lärmminderungsmaßnahmen durch den Betreiber beschränken sich auf die Auswahl lärmarmer Sägeblätter.
Beschaffenheit
Regelausstattung

Anordnung der Rückschlag- und Splitterfangeinrichtungen
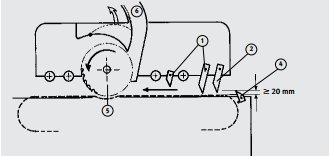
1 Greiferrückschlagsicherung (unterschiedliche Systeme und Kombinationen möglich)
2 Obere Splitterfangeinrichtung (unterschiedliche Systeme und Kombinationen möglich)
3 Seitliche Splitterfangeinrichtung (bei neuen Maschinen Teil des Maschinengehäuses)
4 Untere Splitterfangeinrichtung
5 Tür zum Sägeblattwechsel (ab Baujahr 1990 Verriegelung mit dem Sägeblattantrieb und Zuhaltung bis zum Stillstand der Sägeblätter)
6 Absauganschluss
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Mehrblattkreissägemaschinen mit Plattenbandvorschub | |||||||||||
| 1. Sind die Rückschlagsicherung und Splitterfangeinrichtungen funktionsfähig (Rückschlaggreifer leichtgängig, scharfkantig, Abstände)? | O | O | O | O | |||||||
| 2. Für Altmaschinen vor Bj. 1995 und CE-Maschinen bis Bj. 2001: Greiferrückschlagsicherung: Abstände zwischen den Greifern halbe Greiferbreite. | O | O | O | O | |||||||
| 3. Für Altmaschinen vor Bj. 1995 und CE-Maschinen bis Bj. 2001: Splitterfangeinrichtung: Abstände zwischen den Greifern 1 mm. | O | O | O | O | |||||||
| 4. CE-Maschinen gemäß DIN EN 1870-4 (ab Bj. 2002): Greiferrückschlagsicherung: Abstände zwischen den Greifern 1 mm | O | O | O | O | |||||||
| 5. CE-Maschinen gemäß DIN EN 1870-4 (ab Bj. 2002): Splitterfangeinrichtung: Abstände zwischen den Greifern 1 mm. | O | O | O | O | |||||||
| 6. Ist die Splitterfangeinrichtung so eingestellt, dass der Spalt zwischen Plattenband/ Maschinentisch und der Unterkante der Splitterfangeinrichtung weniger als 1 mm beträgt? | O | O | O | O | |||||||
| 7. Tragen die Mitarbeiter bei der Beschickung dieser Maschine Lederschürzen mit Schutzeinlagen? | O | O | O | O | |||||||
4.3 Bohrmaschinen
4.3.1 Mehrfachbohrmaschinen mit Handbeschickung
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Risiko der Berührung rotierender Werkzeuge in Ausgangsstellung.
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Mehrfachbohrmaschinen mit Handbeschickung entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61]: 82 dB(A).
Beschaffenheit

Dübelbohrmaschine
1 Werkzeugverdeckung, kann entfallen, wenn die Werkzeuge in Ausgangsstellung stillstehen
2 Werkstückanschläge
3 Absauganschluss
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Mehrfachbohrmaschinen mit Handbeschickung | |||||||||||
| 1. Sind insbesondere bei Mehrfachbohrmaschinen die Bohrer verdeckt, wenn diese in der Ausgangsstellung nicht selbsttätig still stehen? | O | O | O | O | |||||||
4.4 Schleifmaschinen
4.4.1 Kantenschleifmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe II. Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Berühren der Schleifbandkante, das sich aus der Häufigkeit der Unfälle ergibt.
Betrieb
- Nicht benutzte Schleifrollen verkleiden
- Bei der Bearbeitung kleiner Werkstücke Werkstückanschlag verwenden
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Kantenschleifmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61]: 82 dB(A).
Beschaffenheit
Regelausführung

1 Verdeckung der Schleifkanten im Umlenkbereich
2 Werkstückanschlag
3 Absaugstutzen an den Bandumlenkrollen
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Kantenschleifmaschinen | |||||||||||
| 1. Sind die Schleifbandkanten an Kantenschleifmaschinen verdeckt? | O | O | O | O |  | ||||||
4.4.2 Tischbandschleifmaschinen mit Schiebetisch
Risiko
Gefährdungsstufe II. Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Berühren der Schleifbandkante, das sich aus der Häufigkeit der Unfälle ergibt.
Betrieb
- Schleifbandbereiche, die nicht zum Schleifen benötigt werden, verdecken
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Tischbandschleifmaschinen mit Schiebetisch entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61] : 84 dB(A).
Beschaffenheit

Begrenzung des Tischfahrbereiches um Schnittverletzungen durch das Schleifband zu vermeiden


1 Verkleidung der Schleifkante
2 Verkleidung der Umlenkrollen
3 Begrenzung des Tischfahrbereiches
4 Absauganschluss an den Bandumlenkrollen
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Verhalten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Tischbandschleifmaschinen | |||||||||||
| 1. Steht bei maximal eingeschobenem Tisch das Schleifband nicht über? | O | O | O | O |  | ||||||
4.4.3 Breitbandschleifmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Verletzungsrisiko durch Quetschen der Hände im Ein- und Ausschubbereich.
Stand der Absaugtechnik
Alle abgesaugten Breitbandschleifmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeiten u.a.).
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61] : 83 dB(A).
Beschaffenheit
| Einschubseite
| Ausschubseite
1 Schaltleiste |
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Handlungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Breitbandschleifmaschinen | |||||||||||
| 1. Ist auf der Einschubseite eine Abschaltleiste vorhanden und sind die Rollenzwischenräume im Ausschubbereich ausgekleidet? | O | O | O | O |  | ||||||
4.5 Mehrstufige Maschinen
4.5.1 CNC-Oberfräsen und -Bearbeitungszentren
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Verletzungsrisiko insbesondere durch Schneiden am Werkzeug und Quetschen an den bewegten Maschinenteilen des Vorschubs. Darüber hinaus kann es zu Gefährdungen durch wegfliegende Werkzeugteile insbesondere bei der Massivholzbearbeitung kommen. In Deutschland hat es deshalb schon einen tödlichen Unfall gegeben.
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte CNC-Oberfräsen und Bearbeitungszentren entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik Kapselung, wie sie auch der Absaugung dient, mit schallabsorbierender Auskleidung. Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [49]: 85 bis 90 dB(A) für teilgekapselte Maschinen, 73 dB(A) für vollgekapselte Maschinen.
Maßnahmen zur Minderung der Auswirkung des Wegschleuderns von Werkzeugen bzw. Werkzeugteilen
- Umfangskapselung
- Teilkapselung
- Ein vollständiger Schutz gegen ganze Werkzeuge, die im Fehlerfall aus einer CNC-Oberfräsmaschine oder einem CNC-Bearbeitungszentrum herausgeschleudert werden können, ist wegen der großen Energie der sich drehenden Werkzeuge durch Schutzeinrichtungen nicht möglich.
Deshalb ist die Befestigung des Werkzeugs in der Werkzeugaufnahme nach der Maßgabe des Werkzeugherstellers durchzuführen.
Besondere Fachkenntnis ist erforderlich, wenn ein Fräswerkzeug gegen axiales Verschieben auf dem Fräserdorn mit einer Fräseranzugsschraube (siehe Bild) gesichert wird.
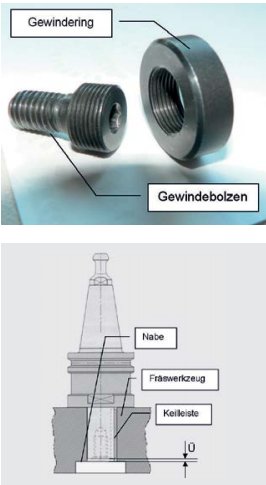
Der überstand "Ü" der Nabe des Fräswerkzeuges zum Fräserdornende richtet sich nach den Herstellerangaben - muss aber mindestens 1 mm betragen. Bevor der Gewindebolzen in der Gewindebohrung des Fräserdorns bzw. auf dem Fräserdornende festsitzen kann (ca. 2 Umdrehungen vorher), muss der Gewindering bereits fest an der Nabe des Fräswerkzeuges anliegen. Unabhängig davon müssen sowohl am Gewindebolzen als auch am Gewindering mindestens 3 Gewindegänge tragen.
- Um das Brechen von Hartmetallschneiden während der Bearbeitung zu vermeiden, müssen die Werkzeuge sorgfältig gewartet und gepflegt werden. Hinweise zur Werkzeugwartung und -pflege gibt die Unterweisungshilfe im Anhang 2.
- Trotz aller Pflege kann insbesondere bei der Massivholzbearbeitung nicht sicher verhindert werden, dass Werkzeugschneiden brechen und wegfliegen. Durch Schutzeinrichtungen wie Teilkapselung mit Lamellenvorhängen oder 4seitige stabile Lamellenvorhänge müssen diese wegfliegenden Teile aufgefgangen werden. Der Maschinenhersteller kann Auskunft geben, ob der Lamellenvorhang an der jeweiligen Maschine hierfür geeignet ist.
- Bei Einsatz von Spindeln mit HSK-Spannsystem ist gemäß der Vorgaben aus der Bedienungsanleitung die Einzugskraft durch autorisiertes Personal zu überprüfen.
Beschaffenheit
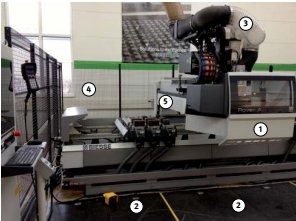
1 Teilkapselung | 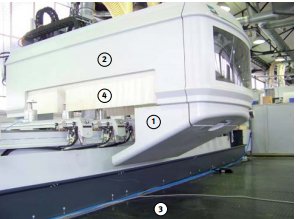
1 Nach unten verlängerte Teilkapsel |
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| CNC-Oberfräsen und -Bearbeitungszentren | |||||||||||
| 1. Ist durch Schalteinrichtungen sichergestellt, dass Personen nicht von verfahrbaren Maschinenteilen eingequetscht werden können (Umzäunungen mit verriegelter Zugangstür und Zuhaltung, Bum per, Trittmatten, Lichtvorhänge)? | O | O | O | O |  | ||||||
| 2. Sind die Mitarbeiter über die Handhabung von Fräswerkzeugen informiert? | O | O | O | O | |||||||
| 3. Ist sichergestellt, dass die Schutz- und Schalteinrichtungen, z.B. Trittmatten, nicht hintertreten werden können? | O | O | O | O | |||||||
| 4. Erfolgt der Austausch verschlissener Lamellenvorhänge durch vom Hersteller empfohlene Lamellenvorhänge? | O | O | O | O | |||||||
4.5.2 Kantenanleimmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Unabhängig von der Art der Sicherheitseinrichtungen, die je nach Baujahr und Hersteller verschieden sein kann, besteht ein Verletzungsrisiko durch Zugriff in die teilweise laufende Maschine, um Einricht-, Entstör- oder Nachstellarbeiten vorzunehmen. Dies hat oft Verletzungen durch Abrutschen in Gefahrstellen oder durch das ungewollte Auslösen von Schnitthüben zur Folge. Typische Risiken sind:
- das Einziehen in die Einzugsstachelwalze beim Einfädeln von Kantenmaterial
- das Schneiden und Quetschen an den Kappsägen durch versehentliches Auslösen des Kappsägenhubs beim Entfernen hängengebliebener Kantenreste
- das Schneiden an den Bündigfräsen beim Kontrollieren der Kantenqualität am durchlaufenden Werkstück
Betrieb
Siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten an Kantenanleimmaschinen" (Anhang 2).
Beschaffenheit

Einseitige Kantenanleimmaschine

1 Elektrisch verriegelte bewegliche Schutzeinrichtung mit Zuhaltefunktion für Kapp- und Bündigfräsaggregate
Stand der Absaugtechnik
Alle abgesaugten Kantenanleimmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeiten u.a.).
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [BGI 53]: 78 dB(A) für teilgekapselte Maschinen, wie sie in Schreinereien/Tischlereien zur Anwendung kommen.
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Handlungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Kantenanleimmaschinen | |||||||||||
| 1. Sind Bündigfräser, Kappaggregate und Stachelwalzen verdeckt? | O | O | O | O | |||||||
4.5.3 Mehrseiten-Hobel- und -Fräsmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Unabhängig von der Art der Sicherheitseinrichtungen, die je nach Baujahr verschieden sein kann, besteht ein geringes Risiko durch spontanen Zugriff in die teilweise laufende Maschine, um Einricht-, Entstör oder Nachstellarbeiten vorzunehmen. Dies hat oft ein Abrutschen in den Schneidbereich der Messerwellen zur Folge.
Baujahrabhängige Einzelheiten sind in der Tabelle 10 des Anhangs 3 zusammengestellt.
Betrieb
- Der Normalbetrieb darf nicht in der Betriebsart "Einrichten" durchgeführt werden.
- Einricht- und Entstörarbeiten dürfen nur von besonders unterwiesenem Personal durchgeführt werden.
- Schneidbereich durch Nachstellen der einstellbaren Schutzeinrichtungen soweit wie möglich eingrenzen.
Beschaffenheit
Werkstückaufgabeseite
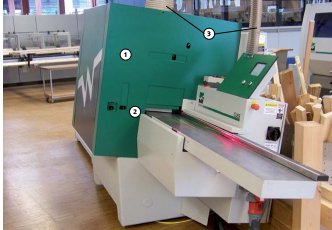
1 Elektrisch verriegelte Schutzhaube (Lärmschutzhaube) mit Zuhaltefunktion
2 Schaltleiste
3 Absauganschluss
Werkstückabnahme
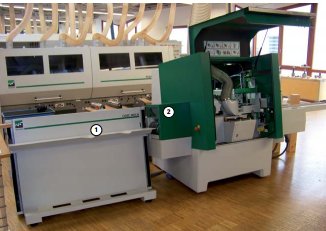
1 Ausgekleideter Abnahmetisch
2 Schallschutztunnel
Stand der Absaugtechnik
Alle abgesaugten Mehrseiten-Hobel und -Fräsmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist (Luftgeschwindigkeiten u.a.).
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [62]: 85-90 dB(A) für teilgekapselte Maschinen, wie sie in Schreinereien/Tischlereien zur Anwendung kommen.
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Mehrseiten-Hobel- und -Fräsmaschinen | |||||||||||
| 1. Ist der Zugriff in laufende Werkzeuge durch Verkleidungen (z.B. Schallschutzkabine elektrisch verriegelt mit Zuhaltung), Verdeckungen verhindert? | O | O | O | O |  | ||||||
4.5.4 Einseitige Zapfenschneid und Schlitzmaschinen mit Schiebetisch
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Risiko durch Schneiden am Werkzeug, insbesondere an der vorderen Ablängsäge.
Betrieb
Maschinen mit Handvorschub des Werkstücks
- bewegliche Schutzhaube für das Ablängsägeblatt bis auf Werkstückhöhe einstellen
- aufsteigenden Zahnkranz des Sägeblattes mit Spaltkeil gegen unbeabsichtigtes Berühren sichern
- von Hand einstellbare Verdeckung des Fräswerkzeuges bis auf Werkstückoberfläche absenken
- nur Fräswerkzeuge für Handvorschub des Werkstücks verwenden
- für die Abschnitte der Ablängsäge einen Behälter benutzen
Maschinen mit mechanischem Vorschub des Werkstücks
- Maschine mit den vom Hersteller vorgesehen Schutzvorrichtungen in Betrieb nehmen. Beispiele für Schutzvorrichtungen: Trittkontaktmatten oder Sicherheitslichtschranken zur Sicherung des Fahrbereiches des Werkstückschlittens, elektrisch verriegelte Verkleidung für die Werkzeuge der Hubspindeln, Verriegelung des Vorschubes einschließlich Zuhaltefunktion für die Umfälzeinheit mit den Werkzeugantrieben
- für den Werkzeugwechsel Handschube benutzen, um ein Schneiden am Werkzeug zu vermeiden
- nur die vom Hersteller frei gegebenen Werkzeugsätze verwenden
- für die Abschnitte der Ablängsäge einen Behälter benutzen
Beschaffenheit
Stand der Absaugtechnik

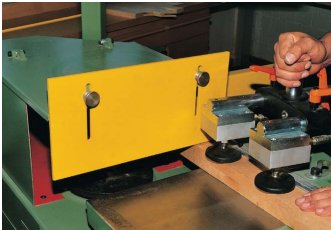
Abgesaugte Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [52]*: 84 dB(A) für Maschinen, wie sie in Schreinereien/Tischlereien zur Anwendung kommen.
Gefahrenbereich des Werkstückschlittens gegen Erreichen sichern, z.B. mit Sicherheitslichtschranken, nicht übersteigbarer Trittkontaktmatte und Einzelgefahrstellensicherung wie z.B. Schaltleiste auf der Innenseite des Werkstückschlittens
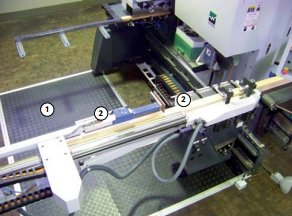
1 Trittkontaktmatte
2 Schaltleiste

1 Verkleidung der Werkzeugaggregate (Abkürzsäge, Hubspindel) in Ausgangsstellung
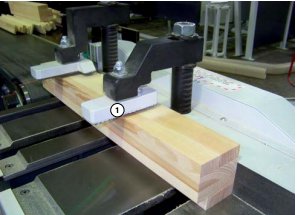
1 Spannzylinder mit begrenztem Hub auf 4 mm.
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Handlungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen | |||||||||||
| 1. Sind insbesondere alle laufenden Werkzeuge gegen Erreichen gesichert? | O | O | O | O |  | ||||||
4.6 Maschinen zur Furnierbearbeitung
4.6.1 Vierwatzen-Leimauftragmaschinen
Risiko
Gefährdungsstufe II. Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko des Eingezogenwerdens beim Reinigen, das sich insbesondere aus der Schwere der Unfälle ergibt.
Betrieb
- Maschine während des Laufes nur reinigen, wenn
- die Walzen zueinander einen Abstand von mehr als 80 mm haben,
- der Abstand zwischen den Walzen und anderen Maschinenteilen mehr als 80 mm beträgt und
- geeignete Hilfsmittel verwendet werden, z.B. Hochdruckreiniger. Lappen, Schwämme o.ä. nicht verwenden.
Beschaffenheit
Regelausführung
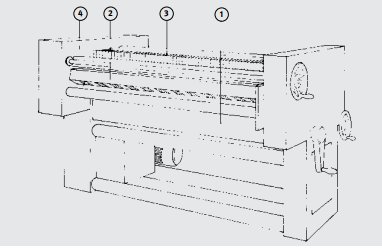
1 Sicherung gegen Zugriff zur unteren Auftragwalze
2 Schalteinrichtung an der Einschubstelle
3 Sicherung des oberen Dosierspalts (mit dem Antrieb verriegelt)
4 Sicherung des unteren Dosierspalts (mit dem Antrieb verriegelt)
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Vierwalzen-Leimauftragmaschinen | |||||||||||
| 1. Sind durchgriffsichere Schutzgitter unterhalb der Aufgabenstelle und im Bereich des Dosierspalts der oberen und unteren Auftragswalze vorhanden? | O | O | O | O | 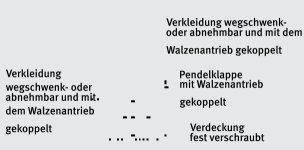 | ||||||
| 2. Sind die Gitter so mit dem Walzenantrieb geschaltet, dass beim Anheben der Antrieb stillgesetzt wird? | O | O | O | O | |||||||
| 3. Gibt es auf der Vorderseite eine Schaltleiste, die bei Betätigung den Walzenantrieb abschaltet? | O | O | O | O | |||||||
| 4. Werden für Reinigungsarbeiten keine Lappen sondern z.B. Hochdruckreiniger verwendet? | O | O | O | O | |||||||
4.6.2 Furnierpaketschneidemaschinen mit Druckbalken
Risiko
Gefährdungsstufe II. In Schreinereien/Tischlereien mit großem Anteil von Furnierbearbeitung, z.B. Möbeltischlereien, Innenausbau, besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Schnitt- und Quetschverletzungen an Messerund Druckbalken.
Betrieb
- An Maschinen ohne Lichtschranken oder zusätzliche Zweihandschaltungen dürfen nicht mehrere Personen beschäftigt werden.
Beschaffenheit
Regelausführung
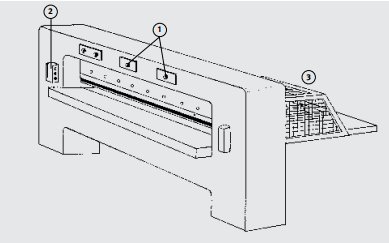
1 Zweihandschaltungen zum Auslösen des Messerbalkens
2 Lichtschrankensicherung, wenn mehrere Personen an der Maschine arbeiten
3 Schutzgitter auf der Rückseite
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Handlungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Furnierpaketschneidemaschinen mit Druckbalken | |||||||||||
| 1. Ist der Schneidbereich gegen Zugriff gesichert (z.B. Zweihandschaltungen, Lichtschranken, seitliche Verdeckungen)? | O | O | O | O | 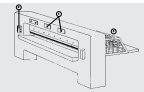 | ||||||
| 2. Werden die Bremsen und die Funktion der Zweihandschaltung und ggf. der Lichtschranken regelmäßig überprüft? | O | O | O | O | |||||||
4.7 Verleimpressen
4.7.1 Rahmenpressen
Risiko
Gefährdungsstufe III. Es besteht ein geringes Verletzungsrisiko durch Quetschen der Hände an den Spannelementen.
Sicherungsmaßnahmen gegen Quetschen:
- Spannzylinder mit begrenztem Hub auf 4 mm oder
- Taster mit selbsttätiger Rückstellung und Begrenzung der Schließgeschwindigkeit auf 25 mm/s oder- Zweistufiger Druckaufbau
Beschaffenheit
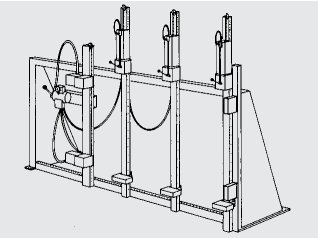
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Rahmenpressen | |||||||||||
| 1. Werden insbesondere die Spannelemente so eingestellt, dass der Abstand zum Werkstück so klein wie möglich gehalten wird? | O | O | O | O | |||||||
4.7.2 Furnierpressen
Risiko
Gefährdungsstufe III. In Schreinereien/ Tischlereien mit großem Anteil von Furnierbearbeitung, z.B. Möbeltischlereien, Innenausbau, besteht ein geringes Verletzungsrisiko durch Quetschen.
Betrieb
- Bei Instandhaltungsarbeiten Pressplatte gegen Absinken sichern, z.B. durch untergesetzte Stempel oder Einlegen der an der Maschine angebrachten Sicherung.
Beschaffenheit
Regelausführung
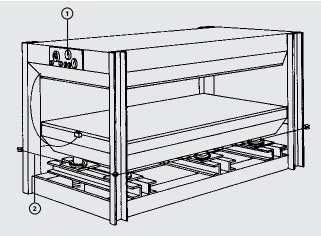
1 Schalter mit selbsttätiger Rückstellung (Tippschalter) für Schließbewegung
2 NOT-AUS-Schaltleine
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Furnierpressen | |||||||||||
| 1. Ist insbesondere der Bedienhebel ohne Selbsthaltung und ist eine umlaufende Not-Aus-Schaltleine vorhanden? | O | O | O | O | |||||||
4.8 Zusätzliche Maschinen, für die sich kein nennenswertes Risiko ergeben hat
4.8.1 Furnierfügekreissägemaschinen
Beschaffenheit
- Sicherung des Stellteils zur Druckbalkenauslösung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Spaltkeil und obere Verdeckung
Stand der Absaugtechnik
An Furnierfügekreissägemaschinen sind aufgrund der geringen Einsatzzeiten dieser Maschinenart in Schreinereien/Tischlereien, selbst ohne Anschluss an eine Absauganlage, keine kritischen Konzentrationen zu erwarten.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61]: 89 dB(A). Die Möglichkeiten des Anwenders zur Lärmminderung beschränken sich auf den Einsatz sogenannter lärmarmer und scharf gehaltener Sägeblätter.
4.8.2 Doppelabkürzkreissägemaschinen
Beschaffenheit
- Spaltkeil mit oberer Verdeckung der Sägeblätter
- Abweisleisten für Abschnitte
- Werkstückanschlag
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Doppelabkürzkreissägemaschinen mit Ausrückeinrichtung entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern sie mit unterer Absaugung an jedem Sägeaggregat und auch mit einer Absaugung an den oberen Schutzhauben (Anschlussdurchmesser mind. 50 mm) ausgerüstet sind.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz: ca.90 dB(A) nach [61]. Die Möglichkeiten des Anwenders zur Lärmminderung beschränken sich auf den Einsatz sogenannter lärmarmer und scharf gehaltener Sägeblätter.
4.8.3 Doppelgehrungskappkreissägemaschinen
Beschaffenheit
- Verkleidung der Sägeblätter in Ausgangsstellung
- Zweihandschaltung für die Auslösung der Spanneinrichtungen und die Kappbewegung der Kreissägeblätter
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Doppelgehrungskappkreissägemaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz nach [61]: ca. 95 dB(A). Die Möglichkeiten des Anwenders zur Lärmminderung beschränken sich auf den Einsatz sogenannter lärmarmer und scharf gehaltener Sägeblätter.
4.8.4 Tisch-Oberfräsmaschinen
Beschaffenheit
- Schutzring mit Absauganschluss
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Tischoberfräsmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61]: ca.95 dB(A). Die Möglichkeiten des Anwenders zur Lärmminderung beschränken sich auf den Einsatz lärmarmer und scharf gehaltener Werkzeuge.
4.8.5 Kettenfräsmaschinen
Beschaffenheit
- Bewegliche Schutzstangen/Schutzhauben
- Rastklinke
Betrieb
- Schutzstangen/Schutzhauben bis auf Werkstück herabstellen
- Schutzstangen/Schutzhauben leichtgängig halten
Stand der Absaugtechnik
Abgesaugte Kettenfräsmaschinen entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik, sofern Anhang 1 von [23] eingehalten ist.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61]: ca. 90 dB(A). Anwenderseitig ergeben sich keine Minderungsmöglichkeiten.
4.8.6 Gehrungsstanzmaschinen
Beschaffenheit
- Verdeckung der Schneidebene
- Bei kraftbetriebenen Gehrungsstanzen ist zusätzlich eine Zweihandschaltung erforderlich.
4.8.7 Zweiwalzen-Leimauftragmaschinen
Beschaffenheit
- Schaltleiste vor der Einschuböffnung
- Maschine nur von der Auslaufseite her reinigen
- Maschine während des Laufes nur reinigen, wenn
- die Walzen zueinander einen Abstand von mehr als 80 mm haben,
- der Abstand zwischen den Walzen und anderen Maschinenteilen mehr als 80 mm beträgt und
- geeignete Hilfsmittel verwendet werden, z.B. Hochdruckreiniger Lappen, Schwämme o.ä. nicht verwenden.
4.8.8 Restholzzerkleinerungsmaschinen
Beschaffenheit
Langsamlaufende Vertikalhacker
- Sicherung gegen Hineingreifen in den Zerkleinerungsbereich durch entsprechende Trichterausbildung
- Endschalter an beweglicher Werkzeugverkleidung
- Bei Unterflureinbau des Hackers Sicherung gegen Absturz gewährleisten, z.B. durch 1 m hohe Geländer oder durch mit dem Antrieb verriegelte Deckel , die nur halb hochgeschwenkt werden können
Schnelllaufende Vertikalhacker
- Trichter so ausgebildet, dass Werkstückteile nicht herausgeschleudert werden können
- Verriegelungsschalter mit Zuhaltung an beweglicher Werkzeugverkleidung
Horizontalhacker mit Zuführeinrichtung
- Verkleidung der Einzugswalzen (Mindestabstand einzugsseitig 850 mm)
- NOT-AUS-Schalteinrichtung für die Zuführeinrichtung, z.B. Abschaltbügel bei Höhe der Zuführöffnung > 135 mm
- Verriegelungsschalter mit Zuhaltung an beweglicher Werkzeugverkleidung
Betrieb
- Beim Messerwechsel, insbesondere im Trichter, Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Funktion der Schalteinrichtungen vor Arbeitsbeginn überprüfen
Stand der Absaugtechnik
Restholzzerkleinerungsmaschinen, an denen das Zerkleinerungsgut abgesaugt wird, entsprechen dem Stand der Staubminderungstechnik. Maschinen ohne Absaugung des Zerkleinerungsgutes nur außerhalb der Arbeitsräume aufstellen.
Stand der Lärmminderungstechnik
Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) nach [61]: < 85 dB(A) für langsamlaufende Maschinen. Schnelllaufende Maschinen weisen Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz (Arbeitsgeräusch) > 100 dB(A) auf und sind deshalb zu kapseln oder aus dem Arbeitsraum zu entfernen.
5. Arbeiten auf Leitern
Risiko
Gefährdungsstufe I. Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko bei der Benutzung von Leitern, insbesondere für Tätigkeiten, bei denen Gegenstände wie Werkstücke, Montageteile oder Werkzeuge transportiert oder in den Händen gehalten werden. Unfallursachen sind Abstürze wegen Gewichtsverlagerungen auf der Leiter oder nicht genügend festem Stand der Leiter.
Hinweis
- Arbeiten auf Leitern ist die gefährlichste Tätigkeit in der Holzwirtschaft.
- Das Risiko, beim Besteigen einer Leiter zu verunglücken, ist fünfmal höher als beim Arbeiten an der Kreissäge.
- Für die Unfälle sind kaum fehlerhafte Leitern, sondern stets sorgloses und deshalb falsches Verhalten ursächlich.
Deshalb:
Arbeiten größeren Umfangs, mit höherem Kraftaufwand oder Schwierigkeitsgrad nicht von Leitern aus durchführen, statt dessen Gabelstapler mit Arbeitsbühne, Hubarbeitsbühnen, Gerüste, Podestleitern einsetzen! Leitern nur zu den Zwecken benutzen, zu denen sie nach ihrer Bauart bestimmt sind.
Weitere Hinweise
- zum Umgang mit Leitern im Betrieb siehe Unterweisungsblatt "Sicheres Arbeiten auf Leitern" (Anhang 2).
- zum Umgang mit Leitern auf Baustellen siehe Abschnitt 10.4
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Arbeiten auf Leitern | |||||||||||
| 1. Sind Leitern, die zu Lagerbühnen führen, befestigt? | O | O | O | O | |||||||
| 2. Werden für Wartungs- und Montagearbeiten Stehleitern, vorzugsweise Podeste, verwendet? | |||||||||||
| 3. Sind die Beschäftigten über die besonderen Risiken beim Arbeiten auf Leitern informiert? | |||||||||||
6. Lagern und Transportieren
Vorbemerkung
Hinweise auf Maßnahmen, richtiges Verhalten und Ausgleichsübungen zur Verringerung von Beschwerden des Skelettapparates sind in dem IKK-Leitfaden [72] sowie in der AOK-Broschüre [71] enthalten.
6.1 Lagern und Stapeln
Risiko
Gefährdungsstufe II. Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko durch
- umfallende Platten oder
- umstürzende oder herabfallende Brettware
Falsche Lagerung
Das Abstützen einzelner Platten oder ganzer Plattenpakete durch Personen ist bei fehlender Anlage verboten, da die erforderlichen Stützkräfte von Personen nur aufgebracht werden können, solange die Platten ganz senkrecht stehen. Die Stützkräfte von Personen reichen nicht annähernd aus, wenn die Platten versehentlich in Schräglage kommen. Selbst bei geringen Schräglagen sind die Platten nicht mehr zu halten.
6.1.1 Senkrechtes Lagern
Zahlreiche Unfälle ereignen sich beim "Blättern" senkrecht angelegter Platten.
Deshalb dürfen Platten und Plattenabschnitte nur in stabilen Gestellen, Magazinen oder Regalen senkrecht gelagert werden.
Bei dieser Art der Lagerung sind allerdings erhebliche seitliche Stützkräfte erforderlich. Beim "Blättern" einzelner Platten in den Regalen treten außerdem zusätzliche Stoßkräfte auf. Diese müssen bei der Konstruktion der Lagereinrichtung berücksichtigt werden.
Hinweis:
- Platten oder größere Plattenabschnitte nie ungesichert anlehnen!
- Neu angelieferte Platten sofort in das Lager einsortieren!
- Ungesicherte Zwischenlagerung unbedingt vermeiden!
Geschlossene Lagergestelle
Die meisten Lagergestelle in Handwerksbetrieben sind oben geschlossen, weil diese Gestelle sehr stabil sind. Die Fächer dürfen höchstens 0,5 m breit sein.
Geschlossenes Lagergestell
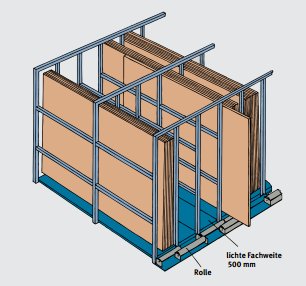
Das Einbringen und Entnehmen von Platten kann durch vorgesetzte Rollen und einen glatten Bodenbelag mit geringem Gleitwiderstand wesentlich erleichtert werden.
Für kleine Lager kann auch eine frei bewegliche Bodenrolle eingesetzt werden, die nach Bedarf unter die Kante einer Platte geschoben wird.
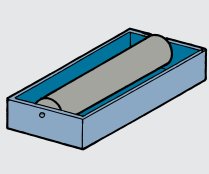
Oben offene Lagergestelle

Beim Einsatz von Krananlagen können dagegen meist nur oben offene Lagergestelle eingesetzt werden, damit die Platten ohne Behinderung direkt vom Greifer erfasst werden können. Oben offene Gestelle benötigen jedoch eine besonders stabile Konstruktion. Die Fächer dürfen auch hier höchstens 0,5 m breit sein.
Lagergestelle, die eine Schräglage vorgeben
Bauelemente, wie Fenster und Türen, können auf solchen Gestellen sicher gelagert werden.
- Die vertikale Lagerung von Platten ist in diesem Fall nur zulässig, wenn die Neigung mindestens 10° beträgt (s. Skizze).
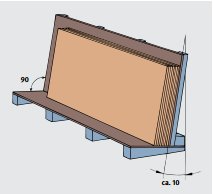
- Jedes Gestell darf nur Platten gleicher Art und Abmessungen enthalten; deshalb sind solche Gestelle in Handwerksbetrieben nur sehr selten anzutreffen.
- Um den Einfluss von Windlasten zu vermeiden, dürfen diese Gestelle zur Lagerung nur in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.
Die Platten dürfen nur einzeln von vorne abgenommen werden. Ein "Blättern" im Paket ist wegen fehlender vorderer Anlage nicht erlaubt.
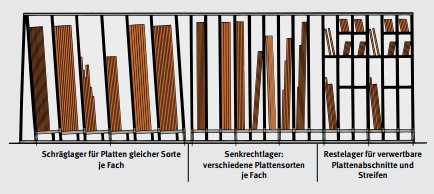
Verfahrbare Lagergestelle (Magazine)
Verfahrbare Gestelle erleichtern die Beschickung und Entnahme. Die Platten können über eine Führungsrolle aus jedem Fach direkt an die Vertikal-Plattenkreissäge gezogen werden. Um die Gestelle leicht und sicher bewegen sowie genau zur Sägemaschine ausrichten zu können, sollten sie motorisch angetrieben sein.
Um Stolperstellen zu vermeiden, müssen die Schienen von verfahrbaren Gestellen in den Boden eingelassen sein.
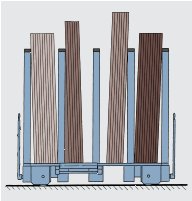
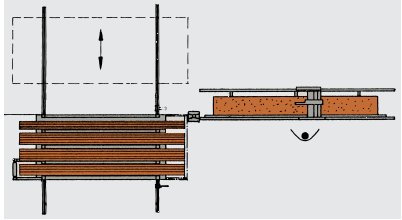
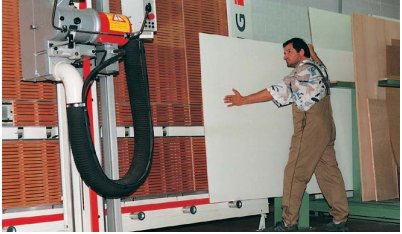
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Plattenlager | |||||||||||
| 1. Sind in ausreichender Zahl Plattenlager vorhanden? | O | O | O | O |  | ||||||
| 2. Sind senkrecht gelagerte Platten gegen Umfallen gesichert (herumstehende Platten in vorhandene Regale einräumen)? | O | O | O | O | |||||||
6.1.2 Lagern und Stapeln von Schnittholz
Maßnahmen zur Verringerung der Umsturzgefahren von Schnittholzstapeln
- Stapel nur auf festem Untergrund errichten! Der Boden muss eben, tragfähig und so angelegt sein, dass Wasser gut abfließen kann. Hierzu ist es im allgemeinen erforderlich, auf den gewachsenen Untergrund Tragschichten aufzubringen, wie z.B. Schotter- oder Kiesschüttungen, Natur- oder Kunststeinpflaster (Verbundpflaster) und Decken aus Beton oder bituminösen Baustoffen.
- Auf standsicheren Stapelaufbau achten! Beispiel für Stapelunterbau: Kanthölzer (12 cm x12 cm), Stapelsteine im Abstand von ca. 1 Meter.
- Zulässige Stapelhöhen einhalten! Stapelhöhe: im Freien max. 3 x Stapelbreite, in geschlossenen Räumen max. 4 x Stapelbreite. Schiefstellung max. 2° (= 10 cm bei 3 m Höhe)
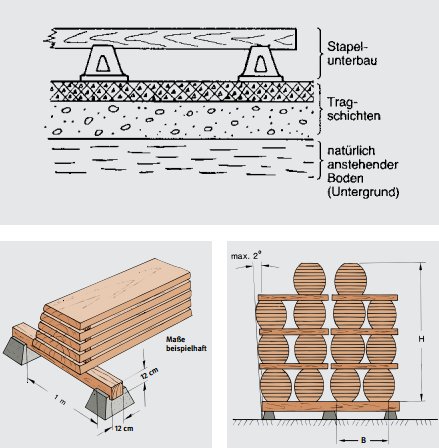

6.1.3 Lagerbühnen
Für den sicheren Betrieb von Lagerbühnen sind erforderlich:
- Absturzsicherungen, z.B. Geländer, an Lagerbühnen, auf denen Schnittholz oder Kleinteile gelagert werden
- Aufstiege als Treppen mit Geländer ausgebildet
- in Ausnahmefällen bei nur seltenem Betreten, Aufstiege in Form fest angebrachter Leitern oder verschiebbarer Einhängeleitern
6.2 Transportieren und Verladen
Unter "Transportieren und Verladen" sind folgende Tätigkeiten zusammengefasst:
- Be- und Entladen, z.B. an Rampen
- Handtransport im Betrieb mit Begehen von Verkehrswegen und Treppen
- Transportieren mit Flurförderzeugen (Gabelstaplern)
Risiko
Gefährdungsstufe I. Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko beim Verladen durch:
- Abstürzen von Rampen
- Getroffenwerden von herabfallendem oder umstürzendem Ladegut
Es besteht weiterhin ein hohes Verletzungsrisiko beim Umgang mit Flurförderzeugen durch:
- herabfallende Lasten
- Umstürzen des Fahrzeuges und
- durch überfahren werden
Gefährdungsstufe II. Es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko beim Gehen mit und ohne Last durch Stürzen, Stolpern und Hängenbleiben. Ein weiteres Verletzungsrisiko ergibt sich durch herabfallende Gegenstände. Es besteht weiterhin ein erhebliches Risiko, beim Heben und Tragen schwerer Lasten (hierunter ist nicht das Ziehen und Schieben von Transportwagen zu verstehen) die Wirbelsäule bleibend zu schädigen, wenn folgende Tätigkeiten ausgeübt werden:
- Ausschließliches Montieren von Fenstern und schweren Türelementen in Verbindung mit Transporttätigkeit. Das Risiko besteht insbesondere beim Transport über größere Entfernungen bei gleichzeitig ungünstiger Körperhaltung, z.B. Transport über mehrere Stockwerke.
- Eine Bauschreiner/-tischlertätigkeit mit überwiegender Montage von Fenstern und schweren Türelementen auf Baustellen sowie mit innerbetrieblichen Verglasungs- und Transporttätigkeiten.
- Ausschließliche Tätigkeit als Maschinenschreiner/-tischler im Massivholz- und/oder Plattenzuschnitt. Die Gefährdung besteht bei manuellem Transport von Bohlen und Platten.
Maßnahmen zur Minimierung der Gefahren beim Transportieren und Verladen
6.2.1 Verkehrswege
Verkehrswege sind sicher, wenn:
- sie ausreichend breit sind, d.h. für ausschließlichen Personenverkehr eine Breite von mindestens 0,875 m aufweisen, für kraftbetriebene Transportmittel einen Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m zu Teilen der Umgebung haben und bei Gegenverkehr ein zusätzlicher Begegnungszuschlag von 0,4 m berücksichtigt wird.
- sie frei von Bodenunebenheiten und Stolperstellen sind. Stolperstellen können entstehen durch herumliegende Kabel, Schläuche und Abfallstücke.
- sie ausreichend rutschfest sind, d. h. bei Neueinrichtung mindestens Rutschfestigkeit nach Bewertungsgruppe R 10 nach [13]. Grundsätzlich sollten die Verkehrswege frei von rutschfördernden Stoffen, wie z.B. Öl, Holzstaub, Eis, Flüssigkeiten, gehalten werden.
- sie ausreichend beleuchtet sind, mindestens 100 Lux für Verkehrswege in Gebäuden für Personen und Fahrzeuge.
- sie bei einer möglichen Absturzhöhe von mehr als 1 m Absturzsicherungen, z.B. Geländer, haben.
6.2.2 Treppen
Um Treppen sicher begehen zu können, sind folgende Maßnahmen notwendig:
- Gleiche Stufenabstände (siehe Skizze)
- Auftrittsflächen mit rutschhemmendem Belag (mindestens Rutschfestigkeit nach Bewertungsgruppe R 10); keine abgenutzten Stufen
- Handläufe angebracht
- Ausreichende Beleuchtung
- Frei von rutschfördernden Stoffen, wie z.B. Öl, Holzstaub, Eis, Flüssigkeiten
- Keine Stolperstellen durch herumliegende Teile (z.B. Kabel, Schläuche und Abfallstücke)
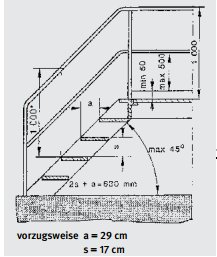
* bei möglichen Absturzhöhen von mehr als 12 m: mind. 1100 mm
6.2.3 Laderampen
Für das sichere Verladen auf Laderampen sind folgende Maßnahmen notwendig:
- Laderampen freihalten und nicht als ständige Lagerfläche verwenden
- Gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesicherte Ladebleche oder Ladebrücken (nutzbare Breite mindestens 1,25 m, rutschhemmend ausgeführt) verwenden
- Um die Gefahr des Umstoßens zwischengelagerter Stapel zu verringern, sollte bei der Neuplanung ein ausreichend großer Verladeraum vorgesehen werden.
Ladebrücke an Koffer des Fahrzeuges anpassen

Ladebrücke betriebsbereit

Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Transportieren | |||||||||||
| 1.Gibt es Stolperstellen, verursacht durch Abfallstücke, herumliegende Kabel, Bodenunebenheiten usw.? | O | O | O | O | |||||||
| 2. Ist genügend Freiraum zum Transportieren vorhanden? | O | O | O | O | |||||||
| 3. Sind die Transportwege gekennzeichnet? | O | O | O | O | |||||||
| 4. Sind die Treppen sicher begehbar (keine abgelaufenen Treppenstufen, Handläufe angebracht, Auftrittsflächen mit rutschhemmendem Belag versehen)? | O | O | O | O |  | ||||||
| 5. Sind alle Verkehrswege und Treppen beleuchtet? | O | O | O | O | |||||||
| 6. Sind die Beschäftigten darüber informiert, dass sie sich im Betrieb umsichtig bewegen, selbst darauf achten, dass Verkehrswege frei bleiben und die Handläufe, z.B. an Treppen benutzen? | O | O | O | O | |||||||
| 7. Werden Sicherheitsschuhe zur Verfügung gestellt? | O | O | O | O |  | ||||||
| 8. Werden die Sicherheitsschuhe von allen Mitarbeitern getragen? | O | O | O | O | |||||||
| 9. Werden für den Plattentransport Tragehilfen, für längere Wegstrecken Plattenroller, Transportwagen o. ä. verwendet? | O | O | O | O |  | ||||||
6.2.4 Sicherer Transport
Um Verletzungen durch umstürzendes Ladegut beim Transport sowie beim Be- und Entladen zu vermeiden sind folgende Maßnahmen notwendig:
- Ladung gegen Verrutschen und Umfallen sichern, z.B. durch Verzurren mit Bändern, Gurten an den Fahrzeugwänden.
- Bauelemente, z.B. Fenster, Türen, einzeln befestigen. Dies gilt auch für den Transport auf Lagergestellen.
- Ladungsteile zur Entnahme einzeln lösen.
- Ladefläche gleichmäßig belasten.
6.2.5 Schweres Heben und Tragen
Zur Reduzierung der körperlichen Belastung beim Heben und Tragen haben sich folgende Maßnahmen als wirksam erwiesen:
Organisation des Transports:
- Fenster und Scheiben sowie Rahmen und Flügel möglichst getrennt zur Baustelle transportieren.
- Anlieferung so abstimmen, dass der vorhandene Baukran zum Transport der Fenster bzw. Scheiben verwendet werden kann.
Verwendung von Hilfsmitteln:
- Durch Verwendung von Tragegurten wird eine günstigere (aufrechte) Körperhaltung erreicht.
- Einzelne Scheiben lassen sich bei Verwendung von Hand-Vakuum-Tragehilfen von mehreren Personen in aufrechter Körperhaltung tragen.
- Schwere Fenster- bzw. Türelemente lassen sich mit Hilfe von U-förmigen Tragehilfen von mehreren Personen in aufrechter Körperhaltung tragen.

- Beim Transport von Bohlen und Platten im Zuschnittbereich lässt sich die Belastung, z.B. durch die Verwendung von Transportwagen und Vakuum-Hebeeinrichtungen, erheblich reduzieren.

Achtung:
Beim Heben und Transportieren von porösen Platten (z.B. MDF-, OSB-, Spanplatten) können wegen des geringeren erzielbaren Unterdrucks nicht immer die gleichen Vakuumhebegeräte eingesetzt werden wie bei "oberflächenverdichteten" Materialien.
Hierfür sind meist spezielle Geräte notwendig (Hersteller befragen).
Prüfen im Betrieb
| Fragen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Handlungsbedarf in | kein Hand- lungs- bedarf | zu erle- digen durch | unter Einbe- ziehung von | zu erle- digen bis | Zeitaufwand [h] für | Lösungsvorschläge/ Bemerkungen | Erledigung und Wirksamkeits- kontrolle durch / am | |||
| Tech- nik | Organi- sation | Ver- halten | Fachkraft für Arbeits- sicherheit | Betriebs- arzt | |||||||
| Transportieren | |||||||||||
| 1. Wurde eine Gefährdungsbeurteilung für das Heben und Tragen von Lasten anhand der Checkliste (s. Anlage) durchgeführt. | O | O | O | O | |||||||
Beurteilung der Belastung der Wirbelsäule beim Heben und Tragen von Lasten
(Gefährdungsbeurteilung im Sinne des § 5 ArbSchG)
Gefährdung
Das manuelle Heben, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen oder Umsetzen von Lasten kann, je nach Größe der Last und Körperhaltung, Schäden insbesondere an der Wirbelsäule verursachen. Deshalb muss der Unternehmer die daraus resultierenden Gefährdungen an jedem Arbeitsplatz ermitteln (§ 5 ArbSchG) und - soweit erforderlich - Maßnahmen zur Verminderung der Lasten oder organisatorische Maßnahmen treffen (LasthandhabV).
Ermittlung
Auf der Grundlage von detaillierten Belastungsanalysen in holzbe- und -verarbeitenden Betrieben sind insbesondere bei Tätigkeiten in den Bereichen
- Fertigung, Transport und Montage von Fenstern und Türen im Betrieb und auf Baustellen,
- Zuschnitt von Vollholz und Plattenmaterial,
- Spritzlackieren von Möbelteilen, Fenstern und Türen,
- Küchenmontage
Belastungen möglich, die eine Gefährdung der Mitarbeiter darstellen können. Für diese Bereiche sind die einzelnen Tätigkeiten und deren Belastungen durch die Lastenhandhabung zu ermitteln.
Eine Checkliste zur orientierenden Beurteilung der Gefährdung bei Belastungen des Muskel- und Skelettsystem ist in der BG-Information BGI 7011 "Gesunder Rücken - Gesunde Gelenke. Noch Fragen?" enthalten. Diese BGI kann bei der BGHM angefordert werden und ist im Internet unter www. bghm.de verfügbar.
Weiterhin werden die BAuA/LASI-Leitmerkmalmethoden "Heben und Tragen" sowie "Ziehen und Schieben" empfohlen. Es werden Art und Ausmaß der körperlichen Belastung einzeln erfasst und gewichtet und daraus eine Risikozahl errechnet, die die Höhe der Wahrscheinlichkeit einer körperlichen Überbeanspruchung abbildet. Es werden auch Gestaltungsmängel und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt (www.baua.de/leitmerkmalmethoden).
 | weiter. |  |
...
X
⍂
↑
↓