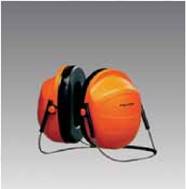Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk; BGI/GUV-I / DGUV-I |  |
BGI/GUV-I 5024 / DGUV Information 212-024 - Gehörschutz-Informationen
Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGI/GUV-I)
(Ausgabe 08/2007; 03/2011)
Informationen enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die praktische Anwendung von Regelungen zu einem bestimmten Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen.
Informationen richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können.Der Unternehmer kann bei Beachtung der in Informationen enthaltenen Empfehlungen, insbesondere den beispielhaften Lösungsmöglichkeiten, davon ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.
Soweit in Informationen verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder aus Unfallverhütungsvorschriften wiedergegeben werden, sind diese durch Fettdruck kenntlich gemacht oder im Anhang zusammengestellt. Erläuterungen, insbesondere beispielhafte Lösungsmöglichkeiten, werden grundsätzlich durch entsprechende Hinweise in Kursivschrift gegeben.
1 Zielgruppe
Diese Information wendet sich an alle, die Gehörschützer verwenden und die für die Benutzung verantwortlich sind.
Dazu zählen:
- Beschäftigte im Lärmbereich,
- deren Vorgesetzte,
- Sicherheitsbeauftragte,
- Betriebs- oder Personalräte.
Sie eignet sich ferner für Personen, die im Rahmen der Beschaffung und Unterweisung unterstützend tätig sind, z.B.:
- Betriebsärzte,
- Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Interessierte Beschäftigte finden Hinweise zum persönlichen Schutz gegenüber Lärm.
2 Zweck dieser Information
Diese Information soll
- über die Folgen der Nichtbenutzung informieren,
- bei der Auswahl geeigneter Gehörschützer helfen,
- zum Tragen von Gehörschützern motivieren.
3 Auswirkungen von Lärm
Lärm am Arbeitsplatz stellt eines der Hauptprobleme des Arbeits- und Gesundheitsschutzes dar. Er kann das Gehör schädigen, wenn keine Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Als Folge kann eine Lärmschwerhörigkeit entstehen.
- Lärmschwerhörigkeit ist nicht heilbar.
- Sie entwickelt sich schleichend und von den Betroffenen anfangs unbemerkt.
- Die Krankheit verschlimmert sich, solange der Lärm auf das Ohr einwirkt.
Durch die entstandene Lärmschwerhörigkeit kann man während der Arbeit nicht mehr
- Maschinengeräusche richtig deuten,
- sich mit dem Kollegen verständigen,
- Warnsignale, z.B. von Gabelstaplern, wahrnehmen
und im privaten Bereich
- sich an Gesprächen in lauter Umgebung beteiligen,
- Musik genießen,
- Umgebungsgeräusche, z.B. Kinderstimmen, Vogelgezwitscher, wahrnehmen,
- Signale im Straßenverkehr, z.B. Hupen, rechtzeitig hören.
Folgen sind Probleme am Arbeitsplatz, soziale Vereinsamung und zusätzliche Gefährdung im Straßenverkehr.
Neben der Schwerhörigkeit kann Lärm auch andere Wirkungen haben, z.B.
- Stress,
- Ärger,
- Nervosität,
- erhöhte Unfallgefahr,
- Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit,
- erschwerte Sprachverständigung,
- Erhöhung der Fehlerhäufigkeit.
Lärm muss deshalb unabhängig von der Lautstärke bekämpft werden!
Dabei steht technische Lärmminderung an erster Stelle. Lässt sich der gehörschädigende Lärm so nicht ausreichend verringern, muss Gehörschutz verwendet werden.
4 Verpflichtung zur Bereitstellung und Benutzung von Gehörschutz
Der Arbeitgeber hat die Pflicht, eine Gefährdungsbeurteilung für die Arbeitsplätze seiner Beschäftigten zu erstellen. Dabei muss er die Belastung am Arbeitsplatz ermitteln und die jeweils notwendigen Schutzmaßnahmen in der Rangfolge:
- Technisch
- Organisatorisch
- Persönlich
festlegen.
Muss Gehörschutz verwendet oder bereitgestellt werden, sind folgende Richtwerte zu beachten:
Abb. 1: Auslösewerte und maximal zulässige Expositionswerte nach der Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung
Auslösewerte- und maximal zulässige Expositionswerte
| Tages- Lärmexpositionspegel (8 Stunden) | Spitzenschalldruckpegel | |
| Untere Auslösewerte | LEX,8h = 80 dB(A) | LpC,peak = 135 dB(c) |
| Obere Auslösewerte | LEX,8h = 85 dB(A) | LpC,peak = 137 dB(c) |
| Maximal zulässige Expositionswerte (unter Berücksichtigung von Gehörschutz) | L'EX,8h = 85 dB(A) | L'pC,peak = 137 dB(c) |
Die Begriffe entsprechen der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung.
Es bedeuten:
- Tages-Lärmexpositionspegel ist der über eine Arbeitsschicht gemittelte Schalldruckpegel.
- Spitzenschalldruckpegel ist der höchste vorkommende Schalldruckpegel.
- Maximal zulässige Expositionswerte sind Schalldruckpegel, die unter Berücksichtigung von Gehörschutz nicht überschritten werden dürfen.
- Untere und obere Auslösewerte verpflichten zu bestimmten Handlungen, z.B. Bereitstellen oder Benutzen von Gehörschutz.
Der auf das Gehör einwirkende Lärm (unter Berücksichtigung des verwendeten Gehörschutzes) darf die maximal zulässigen Expositionswerte nicht überschreiten (L'EX,8h = 85 dB(A), L'pC,peak = 137 dB(c)).
Gehörschutz muss ab Überschreitung der unteren Auslösewerte bereitgestellt werden.
Bei Personen mit besonders empfindlichem Gehör sind lärmbedingte Hörverluste schon unterhalb von 85 dB(A) nicht ausgeschlossen. Deshalb soll auf die Benutzung der bereitgestellten Gehörschützer schon ab Überschreitung der unteren Auslöswerte hingewirkt werden.
Personen mit Hörminderung haben Gehörschutz entsprechend TRLV Lärm ab einem Tages-Lärmexpositionspegel von LEX,8h = 80 dB(A) und einem Spitzenschalldruckpegel von LpC,peak = 135 dB(C) zu benutzen.
Ab einem Tages-Lärmexpositionspegel von 85 dB(A) hat der Arbeitgeber Lärmbereiche zu kennzeichnen. In diesen Bereichen muss Gehörschutz benutzen werden.
Abb. 2: Kennzeichnung von Lärmbereichen

5 Gehörschutzarten
Grundsätzlich werden drei verschiedene Gehörschutzarten unterschieden:
- Kapselgehörschützer,
- Gehörschutzstöpsel,
- Otoplastiken.
Die Liste "Alle dem IFA gemeldeten Gehörschützer mit EG-Baumusterprüfbescheinigung" findet sich in der Regel "Benutzung von Gehörschutz" (BGR/GUV-R 194).
5.1 Kapselgehörschützer
Man unterscheidet:
| Abb. 3: Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
| Abb. 4: Kapselgehörschützer mit Nackenbügel
|
| Abb. 5: Kapselgehörschützer mit Universalbügel kann mit Bügel auf dem Kopf, unter dem Kinn oder im Nacken benutzt werden. | Abb. 6: Kapselgehörschützer, die nur an einem dazu passenden Arbeitsschutzhelm montiert werden dürfen.
|
| Abb. 7: Kapselgehörschützer mit pegelabhängiger Schalldämmung Laute Geräusche werden gedämmt. Leise Geräusche können elektronisch verstärkt werden, wobei die Sprachverständigung verbessert wird | Abb. 8: Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung Es gibt Gehörschützer zur Verständigung z.B. über Sprechfunk. |
| Abb. 9: Kapselgehörschützer mit eingebautem Radiogerät Es werden nur Gehörschützer mit Pegelbegrenzung angeboten. |
5.2 Gehörschutzstöpsel
Man unterscheidet Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch und Gehörschutzstöpsel zum mehrmaligen Gebrauch (wieder verwendbare Gehörschutzstöpsel).*
| Beispiele | ||
| fertig geformte | vor Gebrauch zu formende | |
| Gehörschutzstöpsel zum mehrmaligen Gebrauch |  | |
| Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch |  |  |
| Bügelstöpsel |  | |
| Stöpsel mit Verbindungsschnur |  |  |
* Nähere Angaben und Liste geeigneter Gehörschützer siehe Regel "Benutzung von Gehörschutz" (BGR/GUV-R 194).
5.3 Otoplastiken
Otoplastiken sind im Ohr getragene Gehörschützer, die für den einzelnen Gehörgang individuell angefertigt werden.
Abb. 10 Otoplastiken

6 Vor- und Nachteile der Gehörschutzarten
Tabelle 1: Eignung der einzelnen Gehörschutz-Typen
| Gehörschutz-Typ
Arbeitsbedingungen | Kapselgehör- schützer | Stöpsel zum mehrmaligen Gebrauch | Stöpsel zum einmaligen Gebrauch | Bügel- stöpsel | Otoplastiken | Stöpsel mit Verbindungs- schnur | ||||||||||||
| a) Sehr hohe Temperatur und Feuchtigkeit | - (1) | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| b) Starke Staubbelastung | +/- (3) | - | + | - | +/- | - | ||||||||||||
| c) Wiederholte kurzzeitige Lärmexposition | + | +/- | - | + | - | - | ||||||||||||
| d) Informationshaltige Arbeitsgeräusche | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||||||||||||
| e) Warnsignale, Sprachkommunikation | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||||||||||||
| f) Ortung von Schallquellen | - | + | + | +/- | + | + | ||||||||||||
| g) Vibration und schnelle Kopfbewegungen | +/- | + | + | +/- | + | +/- | ||||||||||||
| h) Arbeitsstoffe, Schmutz und Metallspäne an den Händen | + | +/-(2) | +(2) | +/- | +/-(2) | +/-(2) | ||||||||||||
| i) Bewegte Maschinenteile | + | + | + | +/- | +/- | - | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur können sowohl Stöpsel zum einmaligen oder mehrmaligen Gebrauch als auch Otoplastiken sein.
Zu Kapselgehörschützern ist zu raten,
- wenn häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschützers erforderlich ist, z.B. bei nur kurzem Aufenthalt im Lärmbereich, bei nur kurzzeitig auftretender Lärmeinwirkung,
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden,
- wenn beim Tragen von Stöpseln eine Neigung zu Gehörgangsentzündungen beobachtet wird.
Kapselgehörschützer mit pegelabhängiger Schalldämmung
Diese eignen sich sehr gut an Arbeitsplätzen, an denen Kommunikation erforderlich ist und gelegentlich sehr hohe Schalldruckpegel auftreten. Kapselgehörschützer mit - pegelabhängiger Schalldämmung können für Personen mit Hörminderung die Kommunikationsfähigkeit erhöhen, ohne deren Gehör zu gefährden.
Kapselgehörschützer mit Radio
An Arbeitsplätzen mit monotoner Tätigkeit kann das Tragen eines Kapselgehörschützers mit integriertem UKW-Radio die Motivation der Beschäftigten positiv beeinflussen. Natürlich darf nicht vergessen werden, dass die Sprach- und Signalerkennung beim Radiohören deutlich schlechter wird. Durch das Radiohören darf kein Unfallrisiko entstehen. Der Gehörschützer kann nur an Arbeitsplätzen eingesetzt werden, an denen man akustisch "abschalten" kann.
Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung
Durch den Sprechfunk darf keine zusätzliche Gefährdung des Gehörs entstehen. Der Arbeitgeber soll den Gehörschützer so auswählen, dass der Pegel am Ohr durch eindringenden Lärm und gleichzeitige Gespräche per Funk nicht zu laut werden kann. Gut geeignet sind Komplettgeräte, weil Funkeinrichtung und Gehörschutz vom Hersteller aufeinander abgestimmt sind.
Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen:
- für Arbeitsplätze mit andauernder Lärmeinwirkung,
- bei zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern,
- bei gleichzeitigem Tragen von Brille und Gehörschützern,
- wenn andere persönliche Schutzausrüstungen (Kopfschutz, Schutzbrille, Atemschutz, Visier, Strahlerhelm) getragen werden müssen.
Bügelstöpsel verursachen beim Anschlagen einen lauten Impuls am Ohr des Trägers und sind nicht geeignet für Arbeitsplätze, wo mit dem Anschlagen des Bügels gerechnet werden muss, z.B. Schweißerarbeitsplätze.
Es werden auch Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur angeboten; sie sind für Tätigkeiten, bei denen die Gefahr des Einzugs der Verbindungsschnur besteht, nicht geeignet.
Otoplastiken sind zu empfehlen, wenn
- Kapselgehörschützer ungeeignet sind und andere Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden
- auf Grund arbeitsmedizinischer Befunde und bei schon vorhandenen Hörverlusten ein besonders sicherer Schutz notwendig wird,
- hohe Trageakzeptanz erforderlich ist.
Da es für Otoplastiken eine vorgegebene Position im Gehörgang gibt, werden sie zwangsläufig richtig getragen, sofern sie korrekt eingesetzt werden. Bei fachgerechter Herstellung und Anpassung und mit Funktionskontrolle bei der Übergabe und danach regelmäßig mindestens alle zwei Jahre erreichen sie somit die beabsichtigte Schutzwirkung.
Alle anderen Gehörschutzstöpsel können hingegen mehr oder weniger tief in den Gehörgang eingesetzt werden. Nicht ausreichend tiefes Einsetzen der Stöpsel beeinträchtigt die Schutzwirkung jedoch erheblich.
Gehörschutzstöpsel mit elektronischen Zusatzeinrichtungen sind ebenfalls erhältlich und haben prinzipiell dieselbe Funktionsweise wie Kapselgehörschützer.
7 Zum Lärm passender Gehörschützer
7.1 Verzerrung der Geräusche (Frequenzgang)
Der richtig ausgewählte Gehörschützer schwächt den Lärm so weit ab, dass das Ohr keinen Schaden mehr nimmt, aber nur so weit, dass wichtige akustische Informationen, z.B. Warnsignale, Sprache und Maschinengeräusche noch erkannt werden können.
Die Schalldämmung des Gehörschützers darf also nicht zu klein, aber auch nicht zu groß sein. Sie muss passen!
Die meisten Gehörschützer dämmen hohe und tiefe Töne unterschiedlich stark. Das führt zu einer Verfälschung des Klangeindrucks, was die Erkennung von Signalen und Sprache erschwert. Deshalb sollte an Arbeitsplätzen, an denen Kommunikation oder Signalerkennung erforderlich ist, der Gehörschützer einen möglichst flachen Frequenzgang haben.
Abb. 11: Schalldämmkurven typischer Gehörschützer

Kapselgehörschützer haben im Allgemeinen bei tiefen Frequenzen eine geringere Schalldämmung als Gehörschutzstöpsel. Die ungleiche Dämmung von tiefen und hohen Frequenzen führt meist zur schlechteren Sprach- und Signalverständlichkeit.
Gehörschützer mit gleichmäßiger Dämmung über alle Frequenzbereiche (= flache Schalldämmkurve) sind daher zu empfehlen. Dies betrifft insbesondere Personen mit Hörminderung.
7.2 Schalldämmung
Ziel der Auswahl ist das Erreichen eines Restschallpegels (Schalldruckpegel unter dem Gehörschutz) von 70 bis 80 dB(A), bzw. < 135 dB(Cpeak) unter dem Gehörschutz.
Restschallpegel unter 70 dB(A) stellen eine Überprotektion dar und führen leicht zur Ablehnung durch den Benutzer. Pegel ab 80 dB(A) sind nicht empfehlenswert.
Restschallpegel unter dem Gehörschutz L'EX,8h von mehr als 85 dB(A) sind nicht zulässig.
Tabelle zur Auswahl von Gehörschutz nach der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung und der BGR/GUV-R 194:
Tabelle 2: Beurteilung der Schutzwirkung von Gehörschutz
| Am Ohr wirksamer Restschallpegel in dB(A) | Am Ohr wirksamer Restspitzenschallpegel in dB(Cpeak) | Beurteilung der Schutzwirkung |
| > 85 | > 137 | nicht zulässig |
| > 80 | > 35 | nicht empfehlenswert |
| < 80 | < 135 | empfehlenswert |
| < 70 | - | * |
| * Verständigung und Isolationsgefühl prüfen | ||
Verfahren zur rechnerischen Prüfung auf Einhaltung der maximal zulässigen Expositionswerte und der entsprechenden Auswahl von Gehörschutz werden in den Anhängen 1 und 2 beschrieben.
8 Hinweise zur Auswahl von Gehörschutz
Zunächst werden Angaben zum Lärm und zum Gehörschützer gebraucht, dann kann der Restschallpegel ermittelt werden.
In den Zeiten, in denen mit Sicherheit keine Gehörgefährdung vorliegt, ist das Tragen von Gehörschutz nicht erforderlich.
8.1 Benötigte Angaben zum Lärm
- Lärmexpositionspegel, falls erforderlich auch Spitzenschalldruckpegel
- Geräuschklasse (HM oder L, siehe nachstehend)
Der Lärmexpositionspegel LEX,8h ist ein Maß für die mittlere Lärmbelastung über die Arbeitsschicht und wird in dB(A) angegeben. Der Spitzenschalldruckpegel ist ein Maß für den lautesten Lärmpegel am Arbeitsplatz und wird in dB(Cpeak) gemessen. Der Lärmexpositionspegel und der Spitzenschalldruckpegel sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung vom Arbeitgeber zu ermitteln.
Etwa 85 % aller Geräusche am Arbeitsplatz sind mittel- bis hochfrequent (Geräuschklasse HM), etwa 15 % aller Geräusche sind im tieffrequenten Bereich angesiedelt (Geräuschklasse L).
Beispiele zur Geräuschklasse HM:
Druckluftdüsen, Kreissägen, Schleifmaschinen, Spritzgießmaschinen, Zentrifugen
Beispiel zur Geräuschklasse L:
Bagger, Feuerungen, Kollergänge, Kolbenkompressoren
Die Zuordnung zu einer der beiden Geräuschklassen kann nach dem subjektiven Klangeindruck (siehe Beispiele) oder nach Bestimmung der Schallpegeldifferenz LC- LA erfolgen.
| LC - LA < 5dB | Geräuschklasse HM |
| LC - LA > 5dB | Geräuschklasse L |
Dabei ist:
- LC der Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung C
- LA der Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung A
Der Schalldruckpegel kann der Tages-Lärmexpositionspegel oder der mit der Tätigkeit verbundene äquivalente Dauerschalldruckpegel sein. Wenn die Geräuschklassen im Laufe einer Arbeitsschicht wechseln, sollte der Tages-Lärmexpositionspegel zur Beurteilung verwendet werden.
Siehe Anhang 2 der Regel "Benutzung von Gehörschutz" (BGR/GUV-R 194).
8.2 Angaben zum Gehörschützer
Aus der Kennzeichnung des Gehörschützers sind unter anderem folgende Dämmwerte zu entnehmen:
| H-Wert | (High = Dämmwert für hohe Frequenzen) |
| M-Wert | (Medium = Dämmwert für mittlere Frequenzen) |
| L-Wert | (Low = Dämmwert für tiefe Frequenzen) |
| SNR-Wert | (Single Number Rating = Einzahlschalldämmwert) |
Zur Auswahl von Gehörschutz werden üblicherweise die M- und L-Werte herangezogen.
8.3 Geringere Schalldämmung von Gehörschützern in der Praxis
Kontrollen der tatsächlichen Schutzwirkung von Gehörschützern haben ergeben, dass die bei der Baumusterprüfung erzielten Dämmwerte in der Praxis meist nicht erreicht werden.
Als Korrekturwerte Ks für die Benutzung von Gehörschutz in der Praxis werden verwendet:
- Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel Ks = 9 dB
- Fertig geformte Gehörschutzstöpsel Ks = 5 dB
- Bügelstöpsel Ks = 5 dB
- Kapselgehörschutz Ks = 5 dB
- Otoplastiken mit Funktionskontrolle* Ks = 3 dB
* Funktionskontrolle bei der Auslieferung und danach regelmäßig im Abstand von maximal zwei Jahren.
Bei Extremsituationen mit Verwendung von Kombinationen aus Stöpseln und Kapseln ist je nach Stöpselart ein Wert von Ks = 9 dB bzw. von 5 dB anzunehmen.
Der Einsatz von Otoplastiken ohne Funktionskontrolle mit einem Abschlag von 6 dB ist entsprechend TRLV Lärm Teil 3 (Lärmminderungsmaßnahmen) nicht mehr zulässig. An diesen Produkten ist kurzfristig eine Funktionskontrolle durchzuführen.
Für tieffrequente Spitzenschalldruckpegel sind entsprechend der Regel "Benutzung von Gehörschutz" (BGR/GUV-R 194) besondere Regeln zu beachten. Die Schalldämmung wird durch dabei entstehende Leckagen weiter verringert. Es ist ein zusätzlicher Praxisabschlag von 5 dB erforderlich.
Brillenbügel können die Schutzwirkung von Kapselgehörschützern erheblich reduzieren.
8.4 Ermittlung des Restschallpegels
Geräuschklasse HM:
Restschallpegel in dB(A) = Lärmexpositionspegel - (M-Wert - Ks)
Geräuschklasse L:
Restschallpegel in dB(A) = Lärmexpositionspegel - (L-Wert - Ks)
8.5 Ein praktisches Beispiel:
Schweißnähte an Blechen werden mit einer Winkelschleifmaschine nachbearbeitet.
1. Angaben zum Lärm:
- Lärmexpositionspegel 97 dB(A), Spitzenschalldruckpegel 125dB(Cpeak)
- Hochfrequentes Geräusch (Geräuschklasse HM nach Abschnitt 8.1)
2. Angaben zum Gehörschützer:
Im Betrieb bereits vorhanden ist ein Kapselgehörschützer mit einem M-Wert von 25 dB und einem L-Wert von 19 dB.
3. Ermittlung der Restschallpegel
| Restschallpegel in dB(A) | = Lärmexpositionspegel - (M-Wert - Ks) |
| = 97 - (25 - 5) | |
| = 77 dB(A) |
Folgerung:
Die Restschallpegel unter dem Gehörschützer liegen in dem empfohlenen Pegelbereich. Der Gehörschützer ist für den Beschäftigten an diesem Arbeitsplatz geeignet.
Es gibt noch andere Auswahlverfahren (siehe Regel "Benutzung von Gehörschutz" [BGR/GUV-R 194]).
8.6 Einfluss der Tragezeit im Lärm
Das konsequente Tragen von Gehörschutz ist für den Restschallpegel am Ohr des Benutzers entscheidend, denn bei einem Gehörschützer mit 30 dB Schalldämmung reduziert sich die Schutzwirkung bei 5 Minuten Nichttragen im Lärm auf weniger als 20 dB.
Abb. 12: Effektive Schalldämmung von Gehörschutz

9 Geprüfte Gehörschützer
Gehörschützer unterliegen dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz. Sie müssen die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN EN 352 "Gehörschützer; Allgemeine Anforderungen" erfüllen. Die Prüfung erstreckt sich unter anderem auf die Funktionssicherheit und ein Mindestmaß an Tragekomfort. Geprüfte Gehörschützer sind am CE-Zeichen zuerkennen.
Abb. 13: CE- Zeichen

10 Unterweisung
Der § 31 "Besondere Unterweisungen" der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV/GUV-V A1) gilt auch für Gehörschützer, da Lärmschwerhörigkeit ein bleibender Gesundheitsschaden ist. Daher sind für Gehörschutzbenutzer Unterweisungen mit Übungen durchzuführen. Während der Übung ist insbesondere das Einsetzen von Gehörschutzstöpseln in den Gehörgang zu üben, um Leckagen durch unvollständig oder falsch eingesetzte Gehörschutzstöpsel zu vermeiden.
Werden diese Unterweisungen mit Übungen mehrmals jährlich durchgeführt und dokumentiert, spricht man von qualifizierter Benutzung. Eine dauerhaft qualifizierte Benutzung von Gehörschutz ist notwendige Voraussetzung, um die bei der Baumusterprüfung erzielte Schalldämmung auch in der Praxis zu erreichen.
Entsprechend TRLV Lärm ist die qualifizierte Benutzung ab einem Tages-Lärmexpositionspegel von 110 dB(A) vorgeschrieben.
11 Korrektes Benutzen von Gehörschutz
Einsetzen von Gehörschutzstöpseln
Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff müssen vor dem Einsetzen in den Gehörgang durch Drehen zwischen den Fingerspitzen zu einer dünnen Rolle geformt werden.
Abb. 14 Einsetzen von Gehörschutzstöpseln (Quelle: nach 3M)

Der gerollte Gehörschutzstöpsel muss sofort in den Ohrkanal eingesetzt werden. Nur so kann man ihn mit reduziertem Durchmesser richtig positionieren.

Gehörschutzstöpsel lassen sich besser in den Ohrkanal einführen, wenn dieser durch Ziehen am Ohr begradigt wird.

Nach dem Einsetzen in den Gehörgang ist der Stöpsel so lange mit dem Finger zu fixieren, bis er sich vollständig an den Gehörgang angelegt hat (mindestens 10 Sekunden bzw. nach Herstellerangaben).

Nur bei richtigem Sitz lassen sich die vom Hersteller angegebenen Dämmwerte erreichen.
12 Pflege und Hygiene
12.1 Pflege
Zum mehrfachen Gebrauch bestimmte Gehörschützer müssen regelmäßig gewartet und gereinigt werden, um Hautreizungen und andere Ohrprobleme zu vermeiden. Es sollten die Reinigungsvorschriften entsprechend der Benutzerinformation des Herstellers genau befolgt werden. Beschädigte Dichtungskissen dürfen nicht weiter verwendet werden.
12.2 Hygiene
Gehörschutzstöpsel sollen nicht mit verschmutzten Fingern eingesetzt werden.
An Schmutzarbeitsplätzen empfiehlt sich daher der Einsatz von Gehörschutzstöpseln zur einmaligen Verwendung.
An staubigen Arbeitsplätzen kann sich zwischen den Dichtungskissen eines Kapselgehörschützers und der Haut eine Schmutzlage bilden, die zu Hautreizungen führen kann (Hinweis: Zwischenlage für Kapselgehörschutz verwenden).
Abb. 15: Zwischenlage auf einer Gehörschutzkapsel

Hier ist von Kapselgehörschützern abzuraten, geeignet sind Gehörschutzstöpsel.
Bei Neigung zu Gehörgangsentzündungen sind Kapselgehörschützer zu empfehlen (bei Problemen den Betriebsarzt fragen). Verschmutzte Absorptionseinlagen sind auszutauschen (siehe Angaben des Herstellers).
13 Tragekomfort
Gehörschützer, die schmerzen, sind falsch ausgewählt oder eingesetzt!
Der Tragekomfort wird individuell empfunden und beurteilt. Deshalb gibt es nicht den für jeden Mitarbeiter geeigneten Gehörschützer. Aber es gibt allgemein gültige Ratschläge:
- An Hitzearbeitsplätzen möglichst keine Kapselgehörschützer einsetzen,
- bei Kapselgehörschützern auf geringes Gewicht achten,
- Gehörschutzstöpsel entsprechend der Gehörgangsgröße auswählen,
- die Benutzer in die richtige Handhabung einweisen, die Benutzerinformation beachten,
- hochwertige und geeignete Otoplastiken bieten einen hohen Tragekomfort,
- harte Otoplastiken können bei Verformung des Gehörgangs, z.B. durch starke Drehungen des Kopfes, Druckgefühle erzeugen,
- Otoplastiken seitenrichtig einsetzen (rechts/links-Verwechslung möglich),
- vor dem Einkauf größerer Stückzahlen Trageversuche mit wenigen Mitarbeitern im Betrieb durchführen.
So ausgewählte Gehörschützer können im Lärm sogar als angenehm empfunden werden.
14 Mit Gehörschutz richtig hören
Mit Gehörschutz hört man anders. Je nach Konstruktion des Gehörschützers wird der Klangeindruck verändert. Daran kann man sich meist gewöhnen. Falls nicht oder bei besonderen Anforderungen (Gespräche im Lärm, Hören von Signalen oder Maschinengeräuschen) und bei Personen mit Hörminderung empfiehlt es sich, Gehörschützer mit einer flachen Dämmkurve zu verwenden. Zu hohe Schalldämmung (Überprotektion) ist zu vermeiden.
Einige Gehörschutzhersteller geben an, dass Ihr Gehörschutz (ohne elektronische Einbauten) nur schädlichen Lärm zurückhält und für Sprache durchlässig ist. Dies ist aus technischen Gründen gar nicht möglich. Gehörschützer mit einer flachen Dämmkurve (siehe Abbildung 11) bieten die besten Voraussetzungen für eine gute Sprachverständlichkeit. Diese Gehörschützer werden in der Liste "Alle dem IFA gemeldeten Gehörschützer mit EG-Baumusterprüfbescheinigung" aus der IFA-Datenbank (Positivliste) (siehe auch Anhang 3 der Regel "Benutzung von Gehörschutz" [BGR/GUV-R 194]) entsprechend gekennzeichnet.
Kapselgehörschützer mit elektronischer pegelabhängiger Dämmung ermöglichen in Lärmpausen ein fast "normales Hören". Bei starkem Lärm wirken sie wie herkömmliche Kapselgehörschützer.
An Arbeitsplätzen mit hohem Kommunikationsbedarf kann der Einsatz von Gehörschutz mit Kommunikationseinrichtung sinnvoll sein (Grenzwerte beachten).
15 Kosten von Gehörschutz
Keinen Gehörschutz zu benutzen, ist die teuerste Lösung!
Als Kostenfaktoren für Kapselgehörschützer sind zu beachten:
- Anschaffungspreis (Gebrauchsdauer etwa zwei Jahre),
- Kosten für Austauschset, z.B. Dichtungskissen, absorbierende Zwischenlage,
- Lagerhaltung,
- Reinigung (Arbeitszeit, Material).
Für Gehörschutzstöpsel ist an folgendes zu denken:
- Anschaffungspreis (Gebrauchsdauer 0,5 Tage bis 1/2 Jahr),
- Lagerhaltung,
- Reinigung (entfällt bei einmaliger Verwendung)
Für Otoplastiken ist an folgendes zu denken:
- Anschaffungspreis (Gebrauchsdauer ca. 3 bis 5 Jahre),
- Anfertigen des Ohrabdrucks, Einpassen (Arbeitszeit),
- Reinigung (Arbeitszeit, Material),
- Funktionskontrollen bei der Abnahme und Wiederholungsprüfungen mindestens alle zwei Jahre.
Alle Kosten für den Gehörschutz müssen entsprechend Arbeitsschutzgesetz vom Arbeitgeber getragen werden.
16 Motivation zum Tragen von Gehörschutz
Ob Gehörschützer getragen werden, hängt ganz entscheidend vom Verhalten und der Einstellung der Vorgesetzten ab:
- Der Vorgesetzte muss mit gutem Beispiel vorangehen und immer den Gehörschützer benutzen, wenn er einen Lärmbereich betritt.
- Er sollte regelmäßig kontrollieren, ob der vorgeschriebene Gehörschützer auch getragen wird. Auch gegenüber Betriebsfremden hat er durchzusetzen, dass Gehörschützer benutzt werden.
- Er muss selbst davon überzeugt sein, dass Gehörschützer wichtig sind. Nur dann kann er auch seine Mitarbeiter entsprechend motivieren.
- Er führt Unterweisungen zu Gesundheitsrisiken durch Lärm durch.
- Falls Argumente und Vorbild nicht fruchten, muss notfalls mit disziplinarischen Maßnahmen vorgegangen werden.
17 Gewöhnung an Gehörschutz
Wer erstmals Gehörschützer benutzt, könnte bezweifeln, dass man sich an sie gewöhnen kann.
Vielleicht aus folgenden Gründen:
- Weil der Gehörschützer drückt, knistert, juckt,
- weil man alles anders hört,
- weil man darunter schwitzt.
Diese Klagen treten besonders dann auf, wenn nicht der richtige Gehörschützer ausgewählt wurde. Millionen Benutzer beweisen aber, dass man sich an Gehörschützer gewöhnen kann.
"Mit Gehörschutz höre ich ja nichts mehr!"
Viele befürchten, mit Gehörschutz nichts oder nicht mehr richtig zu hören. Mit Gehörschutz hört man natürlich alles leiser und etwas anders, aber daran kann man sich gewöhnen.
"An Gehörschutz kann ich mich einfach nicht gewöhnen!"
Meist ist ein falsch ausgewählter Gehörschutz daran schuld. Machen Sie Trageversuche mit anderen Gehörschutzarten. Beginnen Sie mit kurzen Tragezeiten. Täglich bei Arbeitsbeginn im Lärmbereich anfangen und so lange Gehörschutz tragen, wie es eben geht. In einer Woche müsste es geschafft sein.
"Ich bekomme immer Entzündungen im Gehörgang!"
Gehörschützer müssen sauber sein. Vor allem wenn sie im Ohr getragen werden. Deshalb sollte man z.B. Gehörschutzstöpsel nur mit sauberen Fingern einsetzen oder herausnehmen. Muss man öfter den Gehörschutz herausnehmen und wieder einsetzen, z.B. als Meister und Vorgesetzter, oder hat man mit Schmutz, z.B. als Schlosser, oder aggressiven Medien zu tun, eignen sich besonders Bügelstöpsel oder Stöpsel mit Griff und Kapselgehörschützer.
Bei Kapselgehörschützern müssen die Dichtungskissen nach Angaben des Herstellers erneuert werden.
An Gehörschutz kann sich jeder gewöhnen, an ein geschädigtes Gehör niemand!
Kein Gehörschutz zu benutzen ist die schlechteste Lösung.
18 Weitere Informationen
Weitergehende Informationen sind in der Regel "Benutzung von Gehörschutz" (BGR/GUV-R 194) enthalten.
Außerdem kann man in der Information "Gehörschutz-Kurzinformation für Personen mit Hörverlust" (BGI 686) und der Information "Empfehlungen zur Benutzung von Gehörschützern durch Fahrzeugführer bei der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr" (BGI 673) nachlesen oder das PC-Programm zur Auswahl von Gehörschutz
www.dguv.de Webcode: d4785
Weitere Fragen kann man mit den ausgebildeten Ansprechpartnern in der Firma besprechen.
Das sind im Allgemeinen:
- der Betriebsarzt,
- die Sicherheitsfachkraft,
- der Sicherheitsbeauftragte.
Zusätzliche Informationen erhält man über den zuständigen Unfallversicherungsträger.
| Rechnerisches Verfahren zur Prüfung auf Einhaltung der maximal zulässigen Expositionswerte | Anhang 1 |
Überprüfung des Tages-Lärmexpositionspegels
Der am Ohr wirksame Pegel L'EX,8h (unter dem Gehörschutz) darf den maximal zulässigen Expositionswert nicht überschreiten. Die Einhaltung kann nach folgendem Verfahren (modifiziertem HML-Check) überprüft werden (siehe Regel "Benutzung von Gehörschutz" [BGR/GUV-R 194]):
L'EX,8h = LEX,8h - (M - Ks) (hoch-/mittelfrequenter Lärm)L'EX,8h = LEX,8h - (L - Ks) (tieffrequenter Lärm)
(Praxisabschlag als Korrekturwert (Ks))
Die maximal zulässige Exposition ist dann eingehalten, wenn der nach dieser Methode errechnete Wert (am Ohr wirksamer Pegel L'EX,8h) kleiner oder gleich dem Wert von L'EX,8h = 85 dB(A) ist.
Überprüfung des Spitzenschalldruckpegels
Der am Ohr wirksame Pegel L'pC,peak darf den Wert des Spitzenschalldruckpegels in Höhe von L'pC,peak = 137 dB(C) nicht überschreiten.
L'pC,peak = LpC,peak - (M - Ks) (hoch-/mittelfrequenter Lärm)L'pC,peak = LpC,peak - (L - Ks- 5) (tieffrequenter Lärm)
- Praxisabschlag als Korrekturwert (Ks),
- gemessener C- bewerteter Spitzenschalldruckpegel LpC,peak
- am Ohr wirksamer Spitzenschalldruckpegel L'pC,peak
Die maximal zulässige Exposition ist dann eingehalten, wenn der nach dieser Methode errechnete Wert (am Ohr wirksamer Spitzenschalldruckpegel L'pC,peak) kleiner oder gleich dem Wert von 137 dB(C) ist.
| Auswahl nach dem Tages-Lärmexpositionspegel | Anhang 2 |
Bei der Auswahl von Gehörschutz sind neben akustischen Eigenschaften die unteren Auslösewerte in der Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung, ergonomische Faktoren und die Arbeitsumgebung zu berücksichtigen (siehe PSA-Benutzungsverordnug und Regel "Benutzung von Gehörschutz" [BGR 194]).
Ziel der Auswahl ist das Erreichen eines am Ohr des Benutzers wirksamen Restschallpegels von 70 bis 80 dB(A) unter dem Gehörschutz. Zu hohe Schalldämmung (Überprotektion) kann zu Verständigungsproblemen und zu Isolationsgefühl führen. Um die daraus resultierende Ablehnung der Benutzung zu vermeiden, sollte dies ab einem am Ohr wirksamen Restschallpegel von L'EX,8h < 70 dB(A) überprüft werden.
Bei der Auswahl ist folgendes Verfahren anzuwenden:
- L'EX,8h = LEX,8h - (M - Ks) (hoch-/mittelfrequenter Lärm)
- L'EX,8h = LEX,8h - (L - Ks) (tieffrequenter Lärm)
(Praxisabschlag als Korrekturwert (Ks).
Der Gehörschutz wird als "empfehlenswert" eingestuft, wenn der Restschallpegel 80 dB(A) nicht übersteigt. Restschallpegel größer 80 dB(A) sind zulässig, aber nicht zu empfehlen. Kleinere Werte als 70 dB(A) können zu Überprotektion führen. Werden Schallpegel kleiner 70 dB(A) als angenehm empfunden und sind Probleme durch Verschlechterung der Kommunikation, des Hörens informationshaltiger Arbeitsgeräusche und der Erkennung von Warnsignalen auszuschließen, können niedrigere Restschallpegel akzeptiert werden. Dabei kann es erforderlich sein, Hörproben durchzuführen.
Zusätzlich sind die Umgebungsfaktoren mit Hilfe der Tabelle 1 (Eignung der einzelnen Gehörschutztypen) zu berücksichtigen.
 | ENDE |  |
...
X
⍂
↑
↓