 Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ▢ Regelwerk, Naturschutz |  |
NatSchAG - Naturschutzausführungsgesetz
Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
- Mecklenburg-Vorpommern-
Vom 23. Februar 2010
(GVBl. Nr. 4 vom 26.02.2010 S. 66)
▾ Änderungen
(ersetzt das LNatG-Landesnaturschutzgesetz vom 22.10.2002)
Kapitel 1
Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, Zusammenarbeit der Behörden
(zu § 3 BNatSchG)
(1) Dieses Gesetz, das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen oder fortgeltenden Rechtsvorschriften (naturschutzrechtliche Vorschriften) werden, soweit nichts Anderes bestimmt ist, durch die Naturschutzbehörden ausgeführt.
(2) Die Naturschutzbehörden sind als Ordnungsbehörden zuständig.
(3) Naturschutzbehörden sind
- das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (oberste Naturschutzbehörde),
- das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (obere Naturschutzbehörde),
- die Nationalparkämter und die Ämter für die Biosphärenreservate (Großschutzgebietsverwaltung),
- die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt (Fachbehörden für Naturschutz),
- die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte (untere Naturschutzbehörden),
- die Amtsvorsteher der Ämter und die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden.
(4) Die Pflichten zur gegenseitigen behördlichen Unterstützung nach § 2 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und zur Unterrichtung und Information nach § 3 Absatz 5 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten auch für kommunale Behörden.
(5) Die Träger der landwirtschaftlichen Beratung sollen die Inhalte und Voraussetzungen einer umweltschonenden Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft im Rahmen ihrer Tätigkeit vermitteln.
§ 2 Zuständigkeiten der obersten Naturschutzbehörde
Soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, ist die oberste Naturschutzbehörde zuständig für
- die Ausübung der Fachaufsicht über die Naturschutzbehörden,
- die Erarbeitung und Veröffentlichung des Gutachtlichen Landschaftsprogramms,
- die Entscheidung über die Verwendung der Ersatzzahlung,
- die Festsetzung von Naturschutzgebieten und Nationalen Naturmonumenten,
- die Festsetzung von Landschaftsschutzgebieten in gemeindefreien Gebieten.
§ 3 Zuständigkeiten der oberen Naturschutzbehörde 10 16
Soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, ist die obere Naturschutzbehörde zuständig für
- die Erarbeitung und Veröffentlichung der Gutachtlichen Landschaftsrahmenpläne,
- die Führung des Ökokontoverzeichnisses und des Kompensationsverzeichnisses,
- die Erfassung der geschützten und einstweilig gesicherten Flächen und Landschaftsbestandteile,
- die Erarbeitung der Schutz-, Pflege-, Wiederherstellungs- und Entwicklungskonzeptionen der Naturparke (Naturparkpläne) im Einvernehmen mit der in ihrem Gebiet jeweils berührten unteren Naturschutzbehörde,
- den Vollzug der § § 37 bis 55 des Bundesnaturschutzgesetzes einschließlich der auf diesen Vorschriften beruhenden Rechtsverordnungen, soweit der Vollzug Landesbehörden zugewiesen ist; dies gilt nicht für § 39 Absatz 5 und 6 sowie § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes,
- den Vollzug von § 23 Absatz 4 und 6,
- die Erarbeitung von
- Grundlagen für den Flächen- und Objektschutz,
- Planungs- und Entscheidungshilfen für die Naturschutzbehörden,
- Fachbeiträgen für die Planung anderer Behörden und Stellen nach deren Anforderung,
- die Erfassung des Zustandes von Natur und Landschaft und von Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt und deren Lebensräumen,
- die Schulung und fachliche Betreuung der im Naturschutz tätigen Bediensteten und ehrenamtlichen Mitarbeiter,
- die Vergabe und Kontrolle der Verwendung von Fördermitteln und Zuwendungen des Landes, die für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit landesweiter Bedeutung zur Verfügung gestellt werden.
Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass für die Erteilung von Ausnahmen oder Befreiungen von den Verboten des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes für bestimmte Arten die obere Naturschutzbehörde zuständig ist.
§ 4 Zuständigkeiten der Großschutzgebietsverwaltung
Soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, sind die Nationalparkämter und die Ämter für die Biosphärenreservate zuständig für alle Aufgaben und Entscheidungen der unteren Naturschutzbehörden sowie der Fachbehörden für Naturschutz, sofern jene den räumlichen Geltungsbereich eines festgesetzten Nationalparks oder Biosphärenreservats betreffen.
§ 5 Zuständigkeiten der Fachbehörden für Naturschutz 10 23
Soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, sind die Fachbehörden für Naturschutz zuständig für
- die naturschutzrechtlichen Entscheidungen im Bereich der Küstengewässer sowie sonstiger gemeindefreier Flächen, sofern nicht nach den § § 2 bis 4 eine andere Behörde zuständig ist,
- die Vergabe und Kontrolle der Verwendung von Fördermitteln und Zuwendungen des Landes, die für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit regionaler Bedeutung zur Verfügung gestellt werden,
- das Management einschließlich der Managementplanung in den Gebieten des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000",
- die naturschutzrechtlichen Entscheidungen und Mitwirkungshandlungen im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Nutzung von Windenergie gemäß Anhang 1 Nummer 1.6 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV - sowie die naturschutzrechtlichen Entscheidungen beim Vollzug dieser Genehmigungen.
§ 6 Zuständigkeiten der unteren Naturschutzbehörden
Soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, sind die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte für den Vollzug der naturschutzrechtlichen Rechtsvorschriften zuständig. Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr.
§ 7 Zuständigkeiten der Amtsvorsteher der Ämter und der Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden
Soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, sind die Amtsvorsteher der Ämter und die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden zuständig für den Vollzug
Sie nehmen die Aufgaben nach Satz 1 Nummer 1 im übertragenen Wirkungskreis wahr.
(1) Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden überwachen die Erfüllung der nach den naturschutzrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen. Soweit Behörden nach diesem Gesetz zuständig sind, sind sie auch befugt, nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Zuwiderhandlungen gegen die Verpflichtungen und zur Abwehr von Gefahren für Natur und Landschaft zu treffen; § 40 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.
(2) Sind Teile von Natur und Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden, ordnet die zuständige Behörde die nach § 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes vorgesehenen Maßnahmen an. Eine Anordnung, die ein Grundstück betrifft und sich an den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten richtet, ist auch für dessen Rechtsnachfolger verbindlich.
(3) Die örtlichen Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Naturschutzbehörden von allen Vorgängen zu unterrichten, die deren Eingreifen erfordern oder für deren Entscheidung von Bedeutung sein können. Diese Verpflichtung gilt im Verhältnis der Naturschutzbehörden zueinander entsprechend.
(4) Die Befugnisse der örtlichen Ordnungsbehörden und der Polizei, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlichen unaufschiebbaren Maßnahmen zu treffen, bleiben unberührt.
§ 9 Betreten von Grundstücken, Untersuchungen
(zu § 65 Absatz 3 BNatSchG)
(1) Bedienstete und Beauftragte der Naturschutzbehörden und der Gemeinden dürfen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Grundstücke, mit Ausnahme von Wohngebäuden, betreten und dort nach rechtzeitiger Ankündigung Vermessungen, Bestandserhebungen, Bodenuntersuchungen, Bodenproben oder ähnliche Arbeiten durchführen sowie Fotografien anfertigen,
- Aufnahme- und Auslieferungsbücher, Aufbewahrungsorte, Ver- und Bearbeitungsstätten und Tiergehege an Ort und Stelle daraufhin überprüfen, ob die Vorschriften zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen eingehalten werden.
(2) Vor dem Betreten eines nicht jeder Person zugänglichen Grundstückes sollen der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte benachrichtigt werden, sofern dem kein wichtiger Grund entgegensteht. In geeigneten Fällen kann die Benachrichtigung auch durch ortsübliche Bekanntmachung erfolgen.
(3) Bei Betrieben, die der Bergaufsicht unterstehen, haben Untersuchungen und Kontrollen im Einvernehmen mit der Bergbehörde zu erfolgen.
§ 10 Einschränkung von Grundrechten
Für Maßnahmen, die nach diesem Gesetz getroffen werden können, werden das Recht auf Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und das Recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt.
Kapitel 2
Landschaftsplanung, Eingriffsregelung
§ 11 Landschaftsplanung
(zu den § § 8 bis 12 BNatSchG)
(1) Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist für das gesamte Land ein Gutachtliches Landschaftsprogramm und für die Regionen nach § 12 Absatz 1 des Landesplanungsgesetzes jeweils ein Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan zu erstellen.
(2) Die Landschaftspläne sind von den Gemeinden zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Sie sind der unteren Naturschutzbehörde vor der Beschlussfassung zur Stellungnahme vorzulegen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne zur Genehmigung sind die Landschaftspläne beizufügen. Die Aufgabe wird von den Gemeinden im eigenen Wirkungskreis wahrgenommen.
(3) Die Inhalte der Gutachtlichen Landschaftsplanung sind in den Maßnahmen, Planungen und Verwaltungsverfahren anderer Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen, soweit sich deren Entscheidungen auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken können, nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften des Rechts der Raumordnung und Landesplanung zu beachten, wenn sie als Ziele der Raumordnung und Landesplanung in die Raumentwicklungsprogramme eingefügt sind. Sie sind zu berücksichtigen, wenn sie als Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung in die Raumentwicklungsprogramme eingefügt sind oder wenn sie als in der Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung als sonstige Erfordernisse der Raumordnung gelten. Im Übrigen sind die raumbedeutsamen Inhalte der Gutachtlichen Landschaftsplanung angemessen zu berücksichtigen.
§ 12 Eingriffe in Natur und Landschaft 16 18
(zu den § § 13 bis 18 BNatSchG)
(1) Eingriffe gemäß § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sind insbesondere
- die Gewinnung von Bodenschätzen, namentlich Kies, Sand, Ton, Torf, Kreide, Steinen oder anderen selbstständig verwertbaren Bodenbestandteilen (oberflächennahe Bodenschätze), wenn die abzubauende Fläche größer als 300 Quadratmeter ist,
- Abgrabungen, Aufschüttungen, Ausfüllungen, Auf- oder Abspülungen von mehr als zwei Metern Höhe oder Tiefe oder mit einer Grundfläche von mehr als 300 Quadratmetern im Außenbereich,
- die Einrichtung oder wesentliche Änderung von Lager-, Ausstellungs-, Sport-, Zelt- und Campingplätzen, Golfplätzen sowie Park- und Stellplätzen von mehr als-300 Quadratmetern im Außenbereich,
- die Errichtung oder wesentliche Änderung von Hafen-, Küsten- und Uferschutzanlagen, Seebrücken, Stegen, Sportboothäfen, Bootsliegeplätzen und Bootsschuppen sowie von Offshore-Anlagen, insbesondere solchen zur Gewinnung von Windenergie,
- die Errichtung oder wesentliche Änderung von Abfallentsorgungsanlagen,
- die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung von Gewässern oder ihren Ufern sowie die Benutzung von Gewässern, die den Wasserstand oder den Abfluss wesentlich verändert,
- die Entwässerung oder sonstige nachhaltige Beeinträchtigung von Mooren, Sümpfen, Brüchen, Söllen oder sonstigen Feuchtgebieten,
- die Beseitigung oder nachhaltige oder erhebliche Schädigung von Parkanlagen, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Feldgehölzen und Feldhecken,
- die nachhaltige Beeinträchtigung von Ufervegetationen, Heiden, Dünen, Osern, Trocken- und Magerrasen sowie Salzgrünland,
- die Errichtung oder wesentliche Erweiterung von Gartenanlagen im Außenbereich,
- der Bau und die wesentliche Änderung von Straßen, Wegen, Bahnanlagen, Flugplätzen, Motor- und Flugsportflächen, Modellflugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen im Außenbereich,
- die Errichtung baulicher Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstücken und die wesentliche Änderung baulicher Anlagen im Außenbereich sowie die Versiegelung von Flächen von mehr als 300 Quadratmetern, ausgenommen die Errichtung von Unterstellplätzen bis 150 Quadratmeter Grundfläche für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen,
- die Errichtung und die wesentliche Änderung von Sende- und Leitungsmasten sowie das Verlegen oberirdischer und unterirdischer Leitungen außerhalb des Straßenkörpers im Außenbereich, ausgenommen Zuleitungen zu Viehtränken und elektrischen Weidezäunen,
- die Errichtung von Einfriedungen und Einzäunungen, ausgenommen die Einfriedung von Hof-, Garten- und Gebäudeflächen und die übliche Einzäunung für landwirtschaftliche Weidetierhaltung und Wildtierhaltung, soweit diese ohne Fundament errichtet werden soll, für forstliche und einjährige landwirtschaftliche Kulturen sowie für Küstenschutzanlagen,
- die Errichtung und der Betrieb von Tiergehegen einschließlich in und auf Gewässern,
- die Änderung der Nutzungsart von Dauergrünland auf Niedermoorstandorten,
- die Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung,
- die Einrichtung oder wesentliche Änderung von Skipisten,
- die Errichtung oder Änderung von Werbeanlagen im Außenbereich, sofern sie baurechtlich genehmigungspflichtig sind.
(2) Absatz 1 gilt nicht für
- Maßnahmen, die unmittelbar der Verwaltung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete dienen oder Bestandteil der Maßnahmenprogramme oder Bewirtschaftungspläne gemäß den §§ 82 und 83 des Wasserhaushaltsgesetzes sind,
- behördlich durchgeführte oder angeordnete Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von geschützten Gebieten und Gegenständen,
- die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und Parkanlagen entsprechend dem Denkmalschutzrecht.
Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einvernehmen mit der für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde durch Rechtsverordnung regeln, dass bestimmte Maßnahmen und Vorhaben, die im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung erforderlich sind und keiner anderen fachgesetzlichen Genehmigung bedürfen, keinen Eingriff nach § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellen. Die oberste Naturschutzbehörde bestimmt ferner im Einvernehmen mit der obersten Wasserbehörde durch Rechtsverordnung die öffentlichen Maßnahmen zur Ordnung des Wasserhaushalts, des Gewässerschutzes sowie des Hochwasser- und Küstenschutzes, die keinen Eingriff nach § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellen. In den Rechtsverordnungen können Mindestanforderungen an den Standort sowie die Durchführung und die Anlage der Maßnahmen und Vorhaben festgelegt werden.
(3) Bei UVP-pflichtigen Vorhaben muss zudem sichergestellt sein, dass
- Gefahren für die in § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 des Landes-UVP-Gesetzes genannten Schutzgüter nicht hervorgerufen werden können und
- Vorsorge gegen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter, insbesondere durch Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, getroffen wird.
(4) Die Ersatzzahlung nach § 15 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes ist an das Land zu leisten und wird an die Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern weitergeleitet.
(5) Maßnahmen gemäß § 16 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sind auf Antrag von der örtlich zuständigen Naturschutzbehörde als zur Kompensation geeignet anzuerkennen und in das Ökokontoverzeichnis einzutragen, wenn sie vor Durchführung der Maßnahme
- schriftlich zugestimmt und
- Umfang, Art und naturschutzfachlichen Wert der dauerhaft günstigen Wirkungen verbindlich festgestellt hat.
§ 17 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes findet entsprechende Anwendung. Nach Satz 1 anerkannte Maßnahmen sind handelbar. Für die Anerkennung nach § 16 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ist die Bewertung nach Satz 1 Nummer 2 bindend, soweit die Maßnahme plangemäß durchgeführt worden ist.
(6) Abweichend von § 17 Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes bedürfen Eingriffe der Genehmigung. Die Genehmigung wird als Bestandteil der Naturschutzgenehmigung nach den Bestimmungen der § § 40 bis 42 erteilt.
(7) Die oberste Naturschutzbehörde kann im Benehmen mit dem Innenministerium, dem für Raumordnung, Baurecht und Infrastruktur sowie dem für Land- und Forstwirtschaft zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung nähere Regelungen zu den §§ 13 bis 18 des Bundesnaturschutzgesetzes und den Absätzen 1 und 3 bis 5 treffen, insbesondere über
- das Führen von Ökokonten und den Handel mit anerkannten Maßnahmen,
- die Bewertung von Eingriffen, die Eignung und Bewertung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die Berechnung der Ersatzzahlung sowie Maßnahmen der Erfolgskontrolle,
- das Führen von behördlichen Katastern, die Maßnahmen nach § 16 des Bundesnaturschutzgesetzes, andere Kompensationsmaßnahmen sowie dafür geeignete oder bereits für die Kompensation von Eingriffen in Anspruch genommene Flächen verzeichnen, und
- die Voraussetzungen, unter denen Verpflichtungen des Eingriffsverursachers nach § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes mit befreiender Wirkung auf andere übertragen werden können.
Die Verordnung kann bestimmen, dass Maßnahmen nach § 16 des Bundesnaturschutzgesetzes vorrangig auf bestimmten Flächen vorgenommen werden sollen. In der Verordnung kann auch bestimmt werden, dass Maßnahmen nach § 135a Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuchs nachrichtlich im Ökokontoverzeichnis geführt werden können.
§ 13 Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen, Abgrabungen und Aufschüttungen, Landgewinnung am Meer
(1) Einer Genehmigung bedürfen
- die Gewinnung von nicht dem Bergrecht unterliegenden oberflächennahen Bodenschätzen gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 1,
- Abgrabungen, Aufschüttungen, Ausfüllungen, Auf- oder Abspülungen gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 2 oder
- die Landgewinnung am Meer.
Die Genehmigung schließt die Baugenehmigung ein. Sie ist nicht erforderlich für Sandvorspülungen, die dem Küstenschutz dienen, sowie für Baugruben, die unmittelbar zur Aufnahme von Baukörpern dienen.
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
- dem Verfahren öffentlich-rechtliche Rechtsvorschriften oder Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung entgegenstehen oder
- das Vorhaben andere öffentliche Belange beeinträchtigt, insbesondere eine sparsame und planmäßige Gewinnung von Bodenschätzen gefährdet wird.
(3) Dem Antrag auf Genehmigung nach Absatz 1 sind auf Verlangen der Behörde ein fachgerecht erarbeiteter Nutzungsplan, ein landschaftspflegerischer Begleitplan und eine schriftliche Erklärung des Eigentümers, der dinglich Berechtigten und des Besitzers beizufügen, dass sie mit dem Vorhaben sowie den vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und der Nutzung nach Beendigung des Vorhabens einverstanden sind. Im Übrigen finden die Vorschriften des § 17 des Bundesnaturschutzgesetzes und des § 41 Absatz 2 bis 4 entsprechende Anwendung.
(4) Auf Antrag kann ein vorzeitiger Beginn des Vorhabens zugelassen werden; § 17 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt sinngemäß.
(5) UVP-pflichtige Vorhaben nach Absatz 1 bedürfen der Planfeststellung.
Kapitel 3
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft
(zu den § § 20 bis 36 BNatSchG)
§ 14 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
(1) Die Erklärung zum Nationalpark oder zum Biosphärenreservat erfolgt durch Gesetz.
(2) Die Erklärung zum Naturpark erfolgt durch Rechtsverordnung der Landesregierung. Naturparke werden in gemeinsamer Trägerschaft durch das Land Mecklenburg-Vorpommern und die betroffenen Landkreise errichtet. Die Landkreise und das Land wirken zusammen, um eine einheitliche und nachhaltige Entwicklung der Naturparke zu gewährleisten. Das Zusammenwirken wird in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt.
(3) Die Erklärung zum geschützten Landschaftsbestandteil erfolgt durch Satzung der Gemeinde, sofern und soweit sie nicht zur Umsetzung des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" oder für den Biotopverbund durch Rechtsverordnung der unteren Naturschutzbehörde erfolgt.
(4) Im Übrigen erfolgt die Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft durch Rechtsverordnung.
(5) Grundstücke in geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie in Gebieten des Netzes "Natura 2000" können in ein Verzeichnis eingetragen werden. Die Verzeichnisse werden von den Naturschutzbehörden geführt. In ihnen können Vorname, Name und Anschrift von Eigentümern, Erbbau- und Nutzungsberechtigten gespeichert werden, soweit dies zur Erfüllung von Aufgaben des Naturschutzes erforderlich ist.
(6) Geschützte Teile von Natur und Landschaft sollen von der zuständigen Naturschutzbehörde in der Natur durch Tafeln mit Anl. 1 dem Symbol der Waldohreule, wie in der Anlage 1 zu diesem Gesetz abgebildet, kenntlich gemacht werden. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken haben die Aufstellung der Tafeln zu dulden. Bei der Aufstellung ist auf die Grundstücksnutzung Rücksicht zu nehmen.
(7) Die Bezeichnungen der geschützten Teile von Natur und Landschaft sowie die nach Absatz 6 vorgeschriebene Kennzeichnung dürfen nur für die festgesetzten Gebiete und Gegenstände verwendet werden, die Bezeichnung "Biosphärenreservat" und die Kennzeichnung auch für solche Gebiete, die von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt worden sind. Bezeichnungen und Kennzeichnungen, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen für Bestandteile von Natur und Landschaft nicht benutzt werden.
(8) Festsetzungen von geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie Maßnahmen nach § 17 Absatz 1 werden in das durch die Katasterbehörden fortzuführende Liegenschaftskataster aufgenommen. Dies erfolgt durch einen entsprechenden Hinweis zu allen betroffenen Flurstücken in dem automatisiert geführten Liegenschaftsbuch.
(9) Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einzelfall Handlungen außerhalb eines Naturschutzgebietes untersagen, die keiner öffentlich-rechtlichen Zulassung bedürfen, soweit diese Handlungen geeignet sind, den Bestand des Gebietes, seines Naturhaushalts oder seine Bestandteile zu gefährden. Ferner bleiben in Naturschutzgebieten Regelungen zur Bekämpfung des Bisams unberührt.
(10) Bei Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Bäumen sind Eigentümer und Nutzungsberechtigte verpflichtet, Schäden und Gefahren, die von diesen ausgehen, unverzüglich der unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. Die Unterschutzstellung entbindet den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten nicht von der Verkehrssicherungspflicht und den üblichen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen.
(11) Sofern eine Beeinträchtigung geschützter Teile von Natur und Landschaft behördlich zugelassen wird, gilt § 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes entsprechend.
(12) Für Entscheidungen über behördliche Gestattungen werden Kosten nicht erhoben, soweit sie nach Regelungen dieses Kapitels oder aufgrund dieses Kapitels erlassener oder fortgeltender Rechtsvorschriften entweder für Schutz- und Pflegemaßnahmen oder für eine ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung erforderlich werden.
(13) Amtshandlungen, die dem Erlass einer Rechtsverordnung oder Satzung nach diesem Kapitel dienen, sind frei von auf Landesrecht beruhenden Gebühren und Auslagen.
§ 15 Erlass von Rechtsverordnungen und Satzungen 16
(1) Vor dem Erlass einer Rechtsverordnung zur Festsetzung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft sind die Gemeinden, die im voraussichtlichen Geltungsbereich der Rechtsverordnung liegen, sowie die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt werden, zu hören. Den Beteiligten soll für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine angemessene, mindestens jedoch vierwöchige Frist gesetzt werden; äußern sie sich nicht fristgemäß, kann die zuständige Naturschutzbehörde davon ausgehen, dass die von ihnen wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch die Rechtsverordnung nicht berührt werden.
(2) Der Entwurf der Rechtsverordnung ist mit den dazugehörenden Karten für die Dauer eines Monats in den kreisfreien Städten, amtsfreien Gemeinden und Ämtern, die im voraussichtlichen Geltungsbereich der Rechtsverordnung liegen, öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung haben die genannten Körperschaften mindestens eine Woche vorher mit dem Hinweis darauf ortsüblich bekannt zu machen, dass bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungszeit bei ihnen oder bei der Naturschutzbehörde, die die Rechtsverordnung erlässt, Bedenken und Anregungen vorgebracht werden können.
(3) Die Beteiligung nach Absatz 1 kann gleichzeitig mit dem Verfahren nach Absatz 2 durchgeführt werden.
(4) Die zuständige Naturschutzbehörde prüft die fristgerecht vorgebrachten Bedenken und Anregungen und führt einen Erörterungstermin durch oder teilt das Ergebnis den Betroffenen mit.
(5) Wird der Entwurf der Rechtsverordnung räumlich oder sachlich erheblich erweitert, so ist das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4 zu wiederholen.
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden, wenn eine Rechtsverordnung nach § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erlassen werden soll. Sie sind ferner nicht anzuwenden, wenn
- eine Rechtsverordnung nur unwesentlich geändert oder nur dem geltenden Recht angepasst werden soll,
- 2 eine Rechtsverordnung erlassen werden soll, die sich ausschließlich auf Flächen erstreckt, die zu Zwecken des Naturschutzes und der Landschaftspflege erworben oder bereitgestellt worden sind,
- eine Rechtsverordnung über ein Naturdenkmal oder einzelne geschützte Landschaftsbestandteile erlassen oder eine Rechtsverordnung nur auf Grundstücke weniger Eigentümer erstreckt werden soll und die Eigentümer bekannt sind; vor Erlass der Rechtsverordnung sind die betroffenen Eigentümer, Nutzungsberechtigten und Gemeinden zu hören.
(7) Die Abgrenzung eines Schutzgebietes ist in der Rechtsverordnung
- im Einzelnen zu beschreiben oder
- zeichnerisch in Karten darzustellen, die
- als Bestandteil der Rechtsverordnung im Verkündungsblatt abgedruckt werden,
- bei Behörden eingesehen werden können; die Behörden, die in der Rechtsverordnung zu benennen sind, haben Ausfertigungen der Karten aufzubewahren, oder
- bei den in der Rechtsverordnung zu benennenden Behörden in unveränderlicher digitaler Form archivmäßig geordnet zur öffentlichen Einsichtnahme während der Dienststunden bereit gehalten werden.
Die Karten und die Beschreibung müssen in hinreichender Klarheit erkennen lassen, welche Grundstücke zum Schutzgebiet gehören; bei Zweifeln gelten die Flächen als nicht betroffen.
(8) Rechtsverordnungen der unteren Naturschutzbehörde sind örtlich in der für Satzungen bestimmten Weise zu verkünden.
(9) Auf den Erlass gemeindlicher Satzungen zur Festsetzung von geschützten Landschaftsbestandteilen finden die Absätze 1 bis 7 entsprechende Anwendung.
§ 16 Unbeachtlichkeit von Mängeln, Behebung von Fehlern
(1) Die ein Naturdenkmal festsetzende Rechtsverordnung ist nicht allein deshalb nichtig, weil ein geschützter Landschaftsbestandteil hätte festgesetzt werden müssen, soweit seine Festsetzung unter Berücksichtigung des Schutzzwecks zu dem gleichen Schutz hätte führen müssen. Das Gleiche gilt, wenn eine Einzelschöpfung der Natur nicht als Naturdenkmal, sondern als geschützter Landschaftsbestandteil festgesetzt wurde.
(2) Eine Verletzung der in § 15 genannten Verfahrensvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der Rechtsvorschrift gegenüber der Naturschutzbehörde oder der Gemeinde geltend gemacht worden ist, die die Rechtsvorschrift erlassen hat. Das Gleiche gilt für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit der Festsetzung oder einzelnen Anordnungen, wenn die Voraussetzungen für die Festsetzung im Übrigen beim Inkrafttreten der Rechtsverordnung vorgelegen haben. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
(3) Im Erörterungstermin oder durch besondere Nachricht ist auf die Frist nach Absatz 2 und auf die Rechtsfolgen aufmerksam zu machen.
(4) Eine Rechtsvorschrift kann mit rückwirkender Kraft erlassen werden, wenn sie eine Regelung ersetzt, die auf einem Verfahrens- oder Formfehler beruht.
§ 17 Einstweilige Sicherstellung, Veränderungssperre
(1) Für Zuständigkeit und Form der einstweiligen Sicherstellung nach § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes finden die für die beabsichtigte Festsetzung geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.
(2) In geplanten Naturschutzgebieten sind von der Bekanntmachung der Auslegung (§ 15 Absatz 2 Satz 2) an bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung, längstens für zwei Jahre, alle Veränderungen verboten, soweit nicht durch einstweilige Sicherstellung abweichende Regelungen getroffen werden (Veränderungssperre). Die im Zeitpunkt der Bekanntmachung ausgeübte rechtmäßige Bodennutzung und Gewässernutzung bleiben unberührt. In der Bekanntmachung ist auf diese Wirkung hinzuweisen.
§ 18 Gesetzlich geschützte Bäume
(1) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, sind gesetzlich geschützt. Dies gilt nicht für
- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,
- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie,
- Pappeln im Innenbereich,
- Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts,
- Wald im Sinne des Forstrechts,
- Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Naturschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestands erstellt wurde.
(2) Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben oder Sachen von bedeutendem Wert.
(3) Die Naturschutzbehörde hat von den Verboten des Absatzes 2 Ausnahmen zuzulassen, wenn
- ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben sonst nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann,
- von dem Baum Gefahren oder unzumutbare Nachteile ausgehen, die nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können oder
- Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung anderer gesetzlich geschützter Bäume entfernt werden müssen.
§ 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend.
§ 19 Schutz der Alleen
(zu § 29 Absatz 3 BNatSchG)
(1) Alleen und einseitige Baumreihen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und Feldwegen sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind verboten. Dies gilt nicht für die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und Parkanlagen entsprechend dem Denkmalschutzrecht.
(2) Die Naturschutzbehörde kann Befreiungen unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen aus Gründen der Verkehrssicherheit liegen Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses in der Regel erst dann vor, wenn die Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich ist und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise verbessert werden kann. Der Träger der Straßenbaulast hat die notwendige Unterhaltung in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde vorzunehmen.
(3) Um den Alleenbestand nachhaltig zu sichern, hat die zuständige Behörde, insbesondere im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, rechtzeitig und in ausreichendem Umfang Neuanpflanzungen vorzunehmen oder für deren Durchführung zu sorgen. Dabei sind bevorzugt standortgerechte und einheimische Baumarten einschließlich einheimischer Wildobstbaumarten zu verwenden. Die Neuanpflanzungen sind dem Landschaftsbild anzupassen und sollen gleichzeitig einen Bezug zur örtlichen Landeskultur haben.
§ 20 Gesetzlich geschützte Biotope und Geotope 16
(abweichende Vorschrift zu § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4, Satz 2 und Absatz 3 BNatSchG)
(1) Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope in der in der Anlage 2 zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung führen können, sind unzulässig:
- naturnahe Moore und Sümpfe, Sölle, Röhrichtbestände und Riede, seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
- naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, Quellbereiche, Altwässer, Torfstiche und stehende Kleingewässer jeweils einschließlich der Ufervegetation, Verlandungsbereiche stehender Gewässer,
- Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Trocken- und Magerrasen sowie aufgelassene Kreidebrüche,
- naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte, Feldgehölze und Feldhecken.
Soweit es sich bei den Biotopen um Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder um nach § 21 Absatz 1 ausgewählte oder festgesetzte Europäische Vogelschutzgebiete handelt, gilt ferner § 21 Absatz 2 Satz 2.
(2) Absatz 1 gilt auch für die folgenden Geotope in der in der Anlage 3 zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung:
- Findlinge, Blockpackungen, Gesteinsschollen und Oser,
- Trockentäler und Kalktuff-Vorkommen,
- offene Binnendünen und Kliffranddünen,
- Kliffs und Haken.
(3) Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope oder Geotope ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Soweit es sich bei den Biotopen oder Geotopen um Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder um nach § 21 Absatz 1 ausgewählte oder festgesetzte Europäische Vogelschutzgebiete handelt, sind Ausnahmen nur zulässig, wenn auch die Anforderungen von § 34 Absatz 1 bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes erfüllt sind. Bei Ausnahmen, die aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Anwendung.
(4) Die Biotope nach Absatz 1 und die Geotope nach Absatz 2 sind in ein Verzeichnis einzutragen, das von der oberen Naturschutzbehörde geführt wird. Das Verzeichnis liegt bei der oberen sowie der örtlich zuständigen unteren Naturschutzbehörde zur Einsicht für jedermann aus. Die Verbote der Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von der Aufnahme in das Verzeichnis.
(5) Die Eintragung in die Verzeichnisse wird den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten der Grundstücke, auf denen sich die Biotope oder Geotope befinden, schriftlich und unter Hinweis auf die Verbote des Absatzes 1 bekannt gegeben. An die Stelle der Bekanntgabe nach Satz 1 kann die ortsübliche Bekanntmachung in der betreffenden Gemeinde treten. Die Biotope und Geotope können in der Örtlichkeit entsprechend § 14 Absatz 6 kenntlich gemacht werden.
§ 21 Netz "Natura 2000" 16
(zu den § § 32 bis 34 BNatSchG)
(1) Die Auswahl der Gebiete nach § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes erfolgt durch die Landesregierung. Die oberste Naturschutzbehörde stellt das Benehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach § 32 Absatz 1 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes her.
(2) Die Landesregierung kann die Gebiete nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2009/147/EG durch Rechtsverordnung zu besonderen Schutzgebieten erklären. In den Gebieten nach Satz 1 sind alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Gebietes des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig und können durch die zuständige Naturschutzbehörde untersagt werden, sofern sie nicht nach § 34 Absatz 1 bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes zugelassen sind.
(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt die Namen der Gebiete, die Gebietsgrenzen in den Maßstäben 1 : 250.000 (Übersichtskarte) und 1 : 25.000 (Detailkarten), die zu schützenden Arten und Biotope von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie den Schutzzweck und die Erhaltungsziele. Sie kann darüber hinaus Ge- und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen enthalten, sofern diese zur Erfüllung der Pflichten aus den in Absatz 2 genannten Richtlinien erforderlich sind. Die Übersichtskarte ist im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. Die Detailkarten sind bei der obersten Naturschutzbehörde archivmäßig zu verwahren. Ausfertigungen der Detailkarten werden bei den in § 1 Absatz 3 Nummer 3 bis 5 genannten Naturschutzbehörden in unveränderlicher digitaler Form archivmäßig geordnet zur öffentlichen Einsichtnahme während der Dienststunden und darüber hinaus auf der Webseite der oberen Naturschutzbehörde bereit gehalten. Für das Verfahren zum Erlass und zur Änderung der Rechtsverordnung gilt § 15 Absatz 1 bis 5 mit der Maßgabe, dass die Mitteilung des Ergebnisses durch Verkündung der Rechtsverordnung im Gesetz- und Verordnungsblatt erfolgt.
(4) Bei bereits zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft erklärten Gebieten und Objekten gilt als jeweiliger Schutzzweck auch der in der Rechtsverordnung nach den Absätzen 2 und 3 genannte Schutzzweck, soweit es sich um Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete handelt.
(5) Abweichend von § 34 Absatz 1 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit auch aus der Rechtsverordnung nach Absatz 2 und 3.
(6) Das Einholen der Stellungnahme der Kommission nach § 34 Absatz 4 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und die Unterrichtung der Kommission nach § 34 Absatz 5 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes erfolgen durch die für die Genehmigung des Projektes zuständige Genehmigungsbehörde über die fachlich zuständige oberste Landesbehörde.
§ 22 Fortgeltung von Unterschutzstellungen
(1) Verordnungen, Anordnungen, Beschlüsse, Behandlungsrichtlinien und Landschaftspflegepläne, die aufgrund des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821), des Naturschutzgesetzes vom 4. August 1954 (GBl. I Nr. 71 S. 695), des Landeskulturgesetzes vom 14. Mai 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67) und der Naturschutzverordnung vom 18. Mai 1989 (GBl. I Nr. 12 S. 159) sowie des Umweltrahmengesetzes vom 29. Juni 1990 (GBl. 1 Nr. 42 S. 649) zum Schutz oder zur einstweiligen Sicherstellung von Nationalparken, Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Biosphärenreservaten, Naturparken, Naturdenkmalen, Flächennaturdenkmalen, geschützten Feuchtgebieten, Schongebieten und geschützten Parks erlassen oder gefasst worden sind, bleiben in Kraft, sofern sie nicht ausdrücklich aufgehoben werden oder ihre Geltungsdauer abläuft. Für ihre Aufhebung und Änderung gelten die Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes entsprechend. Die aufgrund von Artikel 3 Nummer 30 Buchstabe a, b, c, f und 1 der Vereinbarung vom 18. September 1990 zum Einigungsvertrag vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 889, 1239) übergeleiteten Verordnungen können durch Verordnung der obersten Naturschutzbehörde geändert werden.
(2) Die aufgrund des § 3 des Ersten Gesetzes zum Naturschutz im Land Mecklenburg-Vorpommern und aufgrund des Landesnaturschutzgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung erlassenen oder fortgeltenden Unterschutzstellungen und einstweiligen Sicherstellungen bleiben in Kraft, sofern sie nicht ausdrücklich aufgehoben oder geändert werden oder ihre Geltungsdauer abläuft. § 26 Absatz 1 Satz 4 des Landesnaturschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2002 (GVOBl. M-V 2003 S. 1) gilt entsprechend.
(3) Soweit in den nach den Absätzen 1 und 2 fortgeltenden Regelungen über den Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft auf außer Kraft getretene oder tretende Rechtsvorschriften verwiesen wird, treten die entsprechenden Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und dieses Gesetzes oder die entsprechenden aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften an deren Stelle.
Kapitel 4
Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope
(zu den § § 37 bis 55 BNatSchG)
§ 23 Artenschutz
(1) Die Ermächtigungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 39 Absatz 5 Satz 3, § 45 Absatz 7 Satz 4 und § 54 Absatz 10 des Bundesnaturschutzgesetzes werden auf die oberste Naturschutzbehörde übertragen.
(2) Gemäß § 42 Absatz 5 des Bundesnaturschutzgesetzes wird bestimmt, dass die Genehmigung nach § 42 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes die Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a und 3 Buchstabe d des Tierschutzgesetzes einschließt. Die Genehmigung nach § 42 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ergeht ferner gemeinsam mit folgenden anlagenbezogenen Entscheidungen:
- der Baugenehmigung,
- sonstigen naturschutzrechtlichen Entscheidungen, soweit sie nicht durch Behörden des Bundes zu treffen sind,
- sonstigen tierschutzrechtlichen und tierseuchenrechtlichen Entscheidungen sowie
- der Entscheidung über die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 4 Nummer 20 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes.
Zuständig für alle Entscheidungen sind die in § 6 genannten Behörden. Soweit die Genehmigung nach § 42 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes die Haltung von Tieren wild lebender Arten gestattet, die Menschen lebensgefährlich werden können, insbesondere von Tieren aller großen Katzen- und Bärenarten, Wölfen, Elefanten, Nashörnern, Krokodilen, Riesen- und Giftschlangen und giftigen Gliederfüßern, ergeht sie im Einvernehmen mit der zuständigen Kreisordnungsbehörde.
(3) Die Anforderungen des § 43 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten gemäß § 43 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht in den dort genannten Fällen.
Hierzu gehören insbesondere die folgenden Anlagen:
- Anlagen der Teichwirtschaft und Fischzucht,
- Wildgatter,
- Anlagen, in denen Tiere wild lebender Arten zur Wiedereinbürgerung im Rahmen eines von der zuständigen Naturschutzbehörde durchgeführten oder genehmigten Artenhilfsprogramms gehalten werden,
- Anlagen, die für Zwecke eines wissenschaftlichen Instituts auf dem Grundstück des Instituts errichtet werden,
- Anlagen, die zum Zwecke des Handels eines zoologischen Fachgeschäfts auf dem Grundstück des Fachgeschäfts errichtet werden,
- Anlagen auf zum engeren Wohnbereich gehörenden Flächen, in denen ausschließlich für private Zwecke und in geringer Anzahl wild lebende Tiere der Arten gehalten werden, die verhaltensgerecht auch innerhalb von Wohnungen gehalten werden können,
- Anlagen der landwirtschaftlichen Haltung von Dam- oder Rotwild auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.
(4) Gemäß § 54 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist es zum Schutz der Horst- und Neststandorte der Adler, Baum- und Wanderfalken, Weihen, Schwarzstörche und Kraniche verboten,
- im Umkreis von 100 Metern um den Standort (Horstschutzzone I) Bestockungen zu entfernen oder den Charakter des Gebietes sonst zu verändern,
- in der Horstschutzzone 1 und im Umkreis ab 100 bis 300 Meter um den Standort (Horstschutzzone II) in der Zeit vom 1. März bis zum 31. August land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Maßnahmen durchzuführen,
- in den Horstschutzzonen I und II in der Zeit vom 1. März bis zum 31. August die Jagd auszuüben,
- in den Horstschutzzonen I und II stationäre jagdliche Einrichtungen zu errichten; in der für die Jagdausübung freien Zeit ist die Benutzung mobiler jagdlicher Einrichtungen zulässig.
Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt nicht für Fischadler, deren Horste sich auf Masten in der bewirtschafteten freien Landschaft befinden. Für Rohrweihen, die in der bewirtschafteten freien Landschaft nisten, gilt der Brutplatz als Horstschutzzone I und der Umkreis von 200 Metern um den Brutplatz als Horstschutzzone II; für sie gilt das Verbot nach Satz 1 Nummer 2 nicht. Für Kraniche gelten die Verbote nach Satz 1 Nummer 2 und 3 in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai. Für Kraniche, die in der bewirtschafteten freien Landschaft nisten, gilt der Brutplatz als Horstschutzzone I und der Umkreis von 200 Metern um den Brutplatz als Horstschutzzone II; für sie gilt das Verbot nach Satz 1 Nummer 2 nicht. Für Seeadler gelten die Verbote nach Satz 1 Nummer 2 und 3 in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Juli.
(5) Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Einzelheiten des Schutzes nach Absatz 4 zu regeln. Dabei kann sie, soweit erforderlich, weitere Schutzbestimmungen für die Horstschutzzonen treffen und die Regelungen in Absatz 4 sowie in der Rechtsverordnung auf den Schutz der Horststandorte anderer in ihrem Bestand gefährdeter Vogelarten ausdehnen.
(6) Von den Verboten nach den Absätzen 4 und 5 können auf Antrag Ausnahmen zugelassen werden, wenn
- die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen geringfügig sind oder
- die Standortverhältnisse dies erlauben.
Kapitel 5
Meeresnaturschutz
(zu den § § 56 bis 58 BNatSchG)
§ 24 Meeresnaturschutz
(1) Natur und Landschaft der Ostsee stehen unter dem besonderen Schutz des Landes. Hierzu gehören insbesondere die marinen Lebensräume, Tiere und Pflanzen im gesamten Bereich der Küstengewässer einschließlich der Sund- und Boddengewässer sowie der Haffe und Wieke. Aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit kommt der Natur und Landschaft der Ostsee eine herausragende Bedeutung für den Erhalt der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und für den Schutz des Landschaftsbildes in Mecklenburg-Vorpommern zu.
(2) Jeder ist verpflichtet, der besonderen Empfindlichkeit mariner Ökosysteme Rechnung zu tragen. Nutzungsansprüche sind am Grundsatz der Nachhaltigkeit auszurichten.
(3) Die Naturschutzbehörden sind verpflichtet, einen wirksamen Schutz von Natur und Landschaft der Ostsee einschließlich der Sund- und Boddengewässer sowie der Haffe und Wieke sicherzustellen. Hierzu sind insbesondere die Maßnahmen der ökologischen Umweltbeobachtung, der Landschaftsplanung und der Kapitel 3 und 4 des Bundesnaturschutzgesetzes zu ergreifen. Im Rahmen der ökologischen Umweltbeobachtung sind die Veränderungen und Einwirkungen auf Natur und Landschaft der Ostsee zu ermitteln, auszuwerten und zu bewerten. Bei der Erfüllung der Aufgaben der Landschaftsplanung ist der besonderen Empfindlichkeit mariner Ökosysteme Rechnung zu tragen. Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft der Ostsee sollen vorrangig dort ergriffen werden. Ersatzzahlungen gemäß § 15 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes sollen vorrangig für Maßnahmen im marinen Bereich verwendet werden.
(4) Das Land kommt seiner Verantwortung für den marinen Naturschutz auch durch die Umsetzung internationaler Verpflichtungen, insbesondere der Meldung von marinen Schutzgebieten entsprechend den Empfehlungen der Helsinki-Kommission, nach.
Kapitel 6
Erholung in Natur und Landschaft
(zu den § § 59 bis 62 BNatSchG)
§ 25 Betreten der freien Landschaft 16
(1) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts Anderes geregelt ist, darf jede Person in der freien Landschaft auf eigene Gefahr Privatwege (private Straßen und Wege aller Art) sowie Wegeränder und Feldraine zum Zwecke der naturverträglichen Erholung betreten und mit einem Fahrrad befahren. Das Fahren mit Rollstühlen steht dem Betreten gleich. Reiter dürfen Privatwege nur benutzen, wenn sie trittfest oder als Reitweg ausgewiesen sind.
(2) Absatz 1 gilt nicht innerhalb eingefriedeter Grundstücke, auf denen Tiere weiden, Gartenbau, Teichwirtschaft oder Fischzucht betrieben wird, sowie für Hof- und Gebäudeflächen. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung darf durch das Betreten gemäß Absatz 1 nicht beeinträchtigt werden. Gegenstände dürfen nicht in Natur und Landschaft zurückgelassen werden. Die Erholung Anderer in Natur und Landschaft darf nicht gestört werden.
(3) Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte darf Flächen und Wege nach Absatz 1 nur mit Genehmigung sperren. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn dies
- zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten, insbesondere aus wichtigen Gründen des Feldschutzes, der Bewirtschaftung oder zur Vermeidung erheblicher Schäden, oder
- zur Wahrung überwiegender Interessen der Allgemeinheit, insbesondere aus wichtigen Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, oder zum Schutze der Erholungssuchenden
erforderlich ist. Die Genehmigung ist zu befristen.
(4) Aus Gründen des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 2 kann die Behörde die Sperrung der bezeichneten Flächen und Wege auch von Amts wegen anordnen.
(5) Für gesperrte Privatwege gilt § 26 Absatz 2 entsprechend.
§ 26 Einrichtung von Wander- und Reitwegen
(1) Gemeinden und Landkreise richten geeignete und zusammenhängende Wander- und Reitwege im Verbund mit sonstigen Straßen, Wegen und Flächen, die betreten werden dürfen oder auf denen das Reiten zulässig ist, ein oder wirken auf ihre Einrichtung hin. Hierbei sind die Leistungsfähigkeit der Gemeinden und Landkreise, der Bedarf der Allgemeinheit an Erholung in Natur und Landschaft und das Schutzbedürfnis empfindlicher Landschaftsteile und Arten zu berücksichtigen.
(2) Die Wege sind zu kennzeichnen. Der Eigentümer oder sonstige Berechtigte haben die Markierungen zu dulden. Wander- und Radwege, Sport- und Lehrpfade sollen nicht als Reitweg gekennzeichnet werden.
§ 27 Benutzung und Schutz des Strandes
(1) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts Anderes geregelt ist, darf jede Person den Ostseestrand sowie den Strand an Boddengewässern auf eigene Gefahr betreten und sich dort aufhalten sowie Muschelschalen und Steine für den eigenen Bedarf in geringen Mengen sammeln. Das Anlanden und Auflegen von Booten der Küstenfischerei, von motorlosen Sportbooten und von Sportbooten, die mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet sind, deren größte Nutzleistung weniger als 3,69 kW beträgt, ist gestattet. Dabei ist auf den Gemeingebrauch, insbesondere die Badenutzung, und die Belange des Naturschutzes Rücksicht zu nehmen. § 25 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 gilt entsprechend.
(2) Es ist verboten, in Küstendünen oder auf Strandwällen Feuer zu entzünden oder außerhalb der gekennzeichneten Wege zu fahren, zu zelten sowie Wohnwagen, Wohnmobile oder andere Fahrzeuge aufzustellen.
(3) Die Gemeinden haben das Recht, einen zum Gemeindegebiet oder, mit Zustimmung der betroffenen Nachbargemeinde, zu deren Gebiet gehörenden Teil des Strandes für den Badebetrieb oder zu anderen Zwecken zu nutzen, soweit nicht überwiegende Gründe des Naturschutzes und der Landschaftspflege, andere Belange des Gemeinwohls oder Rechtsvorschriften entgegenstehen.
(4) Die Gemeinden regeln das Nähere durch Satzung. Dabei sind sie befugt, den nach Absatz 1 eingeräumten Gemeingebrauch einzuschränken und auch Dritten die Sondernutzung zu gestatten. Das Wandern entlang des Strandes darf nicht gehindert oder abgabepflichtig gemacht werden; im Übrigen ist ein angemessenes Verhältnis zwischen abgabepflichtigem und abgabefreiem Strand zu gewährleisten.
§ 28 Zelten und Aufstellen von beweglichen Unterkünften
(1) Zelte oder sonstige bewegliche Unterkünfte (Wohnwagen, Wohnmobile) dürfen nur auf hierfür zugelassenen Plätzen aufgestellt und benutzt werden.
(2) Nichtmotorisierte Wanderer dürfen außer in Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten und Naturschutzgebieten abseits von Zelt- und Campingplätzen in der freien Landschaft für eine Nacht zelten, wenn sie privatrechtlich dazu befugt sind und keine anderen Rechtsvorschriften entgegenstehen. Auf Grundstücken, die zum engeren Wohnbereich gehören, dürfen Zelte und sonstige bewegliche Unterkünfte für den persönlichen Gebrauch aufgestellt werden, wenn die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleistet sind.
(3) Auf Antrag kann im Einzelfall außerhalb von Zelt- und Campingplätzen die Aufstellung und Benutzung von insgesamt nicht mehr als fünf Zelten oder nach dem Straßenverkehrsrecht zugelassenen Wohnwagen und Wohnmobilen bis zu sechs Monaten genehmigt werden, wenn
- Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege und andere Belange des allgemeinen Wohls nicht beeinträchtigt werden,
- die genutzte Stelle und ihre Umgebung sauber gehalten und vor dem Verlassen wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden und
- ordnungsgemäße sanitäre Verhältnisse und sonstige Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleistet sind.
Satz 1 gilt auch für Zeltlager mit mehr als fünf Zelten, die im Rahmen einer zeitlich begrenzten Jugend-, Sport- oder ähnlichen Veranstaltung für deren Dauer aufgeschlagen werden sollen.
§ 29 Küsten- und Gewässerschutzstreifen
(abweichende Vorschrift zu § 61 BNatSchG)
(1) An Gewässern erster Ordnung sowie Seen und Teichen mit einer Größe von einem Hektar und mehr dürfen bauliche Anlagen in einem Abstand von bis zu 50 Metern land- und gewässerwärts von der Mittelwasserlinie an gerechnet nicht errichtet oder wesentlich geändert werden. An Küstengewässern ist abweichend von Satz 1 ein Abstand von 150 Metern land- und seewärts von der Mittelwasserlinie einzuhalten.
(2) Absatz 1 gilt nicht für
- Fischereihäfen, auch soweit diese nicht öffentlich sind, und öffentliche Häfen,
- bauliche Anlagen, die aufgrund eines Planfeststellungsverfahrens in Ausübung wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewilligungen oder zum Zwecke des Küsten- und Hochwasserschutzes errichtet oder wesentlich geändert werden,
- bauliche Anlagen, die aufgrund eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes errichtet oder wesentlich geändert werden oder für die im Bereich von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen nach § 34 des Baugesetzbuches ein Anspruch auf Bebauung besteht,
- die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebes, wenn die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen ist,
- bauliche Anlagen des Rettungswesens, der Landesverteidigung, des fließenden öffentlichen Verkehrs, der Schifffahrt, der Versorgung und Entsorgung, der Windenergienutzung im Offshore-Bereich oder von sonstigen öffentlichen oder privaten Wirtschaftsbetrieben, wenn sie auf einen Standort dieser Art angewiesen sind, oder
- Viehtränken sowie Einfriedungen zur landwirtschaftlichen Weidetierhaltung.
(3) Ausnahmen von Absatz 1 können zugelassen werden für
- bauliche Anlagen, die allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägen oder von städtebaulicher Bedeutung sind,
- notwendige bauliche Anlagen, die ausschließlich dem Badebetrieb, dem Wassersport oder der berufsmäßigen Fischerei dienen, sowie für räumlich damit verbundene Dienstwohnungen, wenn ständige Aufsicht oder Wartung erforderlich ist,
- bauliche Anlagen, die dem Naturschutz oder der Versorgung von Badegästen und Wassersportlern dienen, sowie für Bootsschuppen und Stege, vorrangig als Gemeinschaftsanlagen,
- die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen oder einer Satzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches sowie für bauliche Anlagen innerhalb des zukünftigen Plangeltungsbereiches, wenn der Plan den Stand nach § 33 des Baugesetzbuches erreicht hat, oder
- jagdliche Ansitze.
Kapitel 7
Ehrenamtlicher Naturschutz
§ 30 Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen 16
(zu den § § 63 und 64 BNatSchG)
(1) Gemäß § 63 Absatz 2 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes findet eine Mitwirkung ferner statt bei der Erteilung von Ausnahmen nach § 20 Absatz 3 und Befreiungen von den Verboten des § 19 Absatz 1 und des § 23 Absatz 4 und 5, soweit die Naturschutzvereinigung durch das Vorhaben in ihrem für die Anerkennung maßgebenden satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt wird.
(2) Anerkannte Naturschutzvereinigungen sind über Vorhaben, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Sie werden am Verfahren beteiligt, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis mitteilen, sich am Verfahren beteiligen zu wollen. Der zu beteiligenden Naturschutzvereinigung ist innerhalb einer angemessenen, mindestens jedoch vierwöchigen Frist nach Übersendung der Unterlagen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Naturschutzvereinigung hat Anspruch auf Übersendung aller für das Vorhaben bedeutsamer Unterlagen, soweit sie nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten.
(3) Endet das Verfahren durch einen Verwaltungsakt oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, so ist den Verbänden, die im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben haben, die Entscheidung bekannt zu geben, es sei denn, der Verband hat von seinem Mitwirkungsrecht nicht innerhalb der Frist nach Absatz 2 Gebrauch gemacht.
(4) Durch schriftliche Erklärung kann ein Verband gegenüber der zuständigen Naturschutzbehörde auf die Mitwirkung in bestimmten Verfahren verzichten. Die Verfahren sind unter Angabe der für sie maßgeblichen Rechtsvorschriften zu bezeichnen.
(5) Gemäß § 64 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes können Rechtsbehelfe ferner eingelegt werden gegen
- Befreiungen von dem Verbot des § 19 Absatz 1, wenn mehr als zehn Bäume betroffen sind, sowie
- Befreiungen von den Verboten des § 23 Absatz 4 und 5,
sofern die Entscheidungen Vorhaben betreffen, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind.
§ 31 Beiräte für Naturschutz und Landschaftspflege, Kreisnaturschutzbeauftragte
(1) Bei der obersten Naturschutzbehörde kann ein Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege gebildet werden. Die Mitglieder des Beirates werden befristet und auf Widerruf bestellt; sie dürfen nicht Bedienstete von Naturschutzbehörden sein.
(2) In den Beirat sind Personen zu berufen, die im Naturschutz und in der Landschaftspflege besonders fachkundig oder erfahren sind. Die Beiratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig und an Weisungen nicht gebunden. Sie haben Anspruch auf Erstattung von Reisekosten.
(3) Der Beirat hat die oberste Naturschutzbehörde in wichtigen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege in ihrem Aufgabenbereich zu unterstützen und fachlich zu beraten. Dazu ist der Beirat rechtzeitig zu unterrichten. Er kann Maßnahmen des Naturschutzes anregen und ist auf Verlangen zu hören.
(4) Bei den unteren Naturschutzbehörden können Beiräte für Naturschutz und Landschaftspflege gebildet sowie aus deren Mitgliedern ein Kreisnaturschutzbeauftragter bestellt werden. Der Beauftragte vertritt den Beirat, insbesondere in allen laufenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten. Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß.
§ 32 Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft
(1) Die Naturschutzbehörden können im Rahmen ihrer Zuständigkeit natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts, die sich nach ihrer Zweckbestimmung überwiegend dem Naturschutz und der Landschaftspflege widmen, auf Antrag in bestimmtem Umfange mit der Betreuung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft beauftragen. Voraussetzung ist, dass sie die Gewähr für eine sachgerechte Förderung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege bieten. § 34 Satz 2 Nummer 7 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt. Die Beauftragung soll befristet werden; sie kann widerrufen werden. Ein Anspruch auf Erstattung von Kosten wird durch sie nicht begründet. Die Naturschutzbehörde beteiligt sich an den notwendigen Aufwendungen nach Maßgabe des Haushalts.
(2) Die Schutzgebietsbeauftragten' sollen vor einer Änderung oder Aufhebung der Schutzvorschriften und vor allen Entscheidungen gehört werden, welche die geschützten Teile von Natur und Landschaft erheblich beeinträchtigen können.
(3) Die Betreuung beinhaltet,
- die Entwicklung des Schutzgegenstandes und der Tier- und Pflanzenwelt sowie ihrer Lebensräume zu beobachten und schriftlich festzuhalten,
- Vorschläge zur Verbesserung der Wirksamkeit der getroffenen Regelungen und Maßnahmen zu unterbreiten,
- pflegerische Maßnahmen des Naturschutzes durchzuführen,
- die Öffentlichkeit über das Schutzgebiet und naturschutzgerechtes Verhalten zu informieren.
§ 33 Naturschutzwarte
(1) Zur Unterstützung der Naturschutzbehörden werden für ein bestimmtes Gebiet durch die unteren Naturschutzbehörden sowie die Großschutzgebietsverwaltung Naturschutzwarte bestellt. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich.
(2) Die unteren Forstbehörden nehmen die Aufgaben der Naturschutzwarte für den Geltungsbereich des Landeswaldgesetzes unter Einbeziehung der nach Absatz 1 bestellten Personen wahr.
(3) Die Naturschutzwarte haben die sie bestellende Naturschutzbehörde über alle nachteiligen Veränderungen in Natur und Landschaft zu informieren und durch Aufklärung darauf hinzuwirken, dass Schäden von Natur und Landschaft abgewendet werden. Sie haben ferner die Aufgabe, Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften, die dem Schutz und der Pflege von Natur und Landschaft dienen oder die Erholung in der freien Natur regeln und deren Übertretung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, festzustellen, abzuwehren sowie bei der Verfolgung solcher Zuwiderhandlungen mitzuwirken.
(4) Soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 3 erforderlich ist, sind die Naturschutzwarte berechtigt,
- Grundstücke, mit Ausnahme von Wohngebäuden, zu betreten,
- eine Person anzuhalten und ihre Identität festzustellen; § 29 Absatz 2 und 3 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes gilt entsprechend,
- eine Person vorübergehend von einem Platz zu verweisen und ihr vorübergehend das Betreten eines Platzes zu verbieten und
- unberechtigt entnommene Gegenstände, gehaltene oder erworbene Pflanzen und Tiere sowie solche Gegenstände sicherzustellen, die bei Zuwiderhandlungen nach Absatz 3 verwendet wurden oder verwendet werden sollen.
(5) Die ehrenamtlichen Naturschutzwarte müssen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einen Dienstausweis mit sich führen, der bei Vornahme einer Amtshandlung auf Verlangen vorzuzeigen ist.
(6) Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einvernehmen mit dem Innenministerium durch Rechtsverordnung die Voraussetzungen für die Eignung der bestellten Personen, die Begründung und die Ausgestaltung des Dienstverhältnisses, die Abberufung, den Aufwendungsersatz sowie die Aus- und Fortbildung regeln und Vorschriften über den Dienstausweis und das Dienstabzeichen treffen.
Kapitel 8
Eigentumsbindung, Ausnahmen
§ 34 Vorkaufsrecht
(zu § 66 BNatSchG)
(1) Abweichend von § 66 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes steht dem Land im Fall des § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes kein Vorkaufsrecht zu.
(2) Abweichend von § 66 Absatz 3 Satz 5 des Bundesnaturschutzgesetzes ist das Vorkaufsrecht ferner ausgeschlossen, wenn das Grundstück zusammen mit einem landwirtschaftlichen Betrieb veräußert wird, mit dem es eine Einheit bildet.
(3) Veräußerer und Erwerber haben den Inhalt des geschlossenen Vertrages der obersten Naturschutzbehörde unverzüglich mitzuteilen. Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zweier Monate nach Mitteilung des Kaufvertrages ausgeübt werden.
(4) Das Vorkaufsrecht des Landes wird durch Verwaltungsakt der obersten Naturschutzbehörde gegenüber dem Veräußerer ausgeübt. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts ist der Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben.
(5) Abweichend von § 66 Absatz 4 kann das Land sein Vorkaufsrecht auch zu Gunsten der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern oder anderer Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts ausüben, wenn der Begünstigte zustimmt. In diesem Fall tritt der Begünstigte an die Stelle des Landes. Für die Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag haftet das Land neben dem Begünstigten.
§ 35 Ausnahmen
(1) Soweit es in fortgeltenden Rechtsvorschriften vorgesehen ist, ohne dass hierfür die Voraussetzungen näher festgelegt sind, kann die zuständige Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, wenn sich dies mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbaren lässt und auch keine sonstigen öffentlichen Belange entgegenstehen. Bei Unterschutzstellungen nach § 22 Absatz 1 gilt dies auch dann, wenn die Erteilung von Ausnahmen nicht vorgesehen ist.
(2) § 67 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend.
§ 36 Enteignung und Ausgleich, öffentliche Förderung 16
(zu § 68 BNatSchG)
(1) Soweit eine Verwaltungsentscheidung, insbesondere die Ablehnung einer Ausnahme oder Befreiung, zu einer unzumutbaren Belastung führt, ist mit ihr zumindest dem Grunde nach zugleich über die zu gewährende Entschädigung zu entscheiden. Abweichend von § 68 Absatz 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes kann von dem Eigentümer auch die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit oder Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt verlangt werden, dass die Nutzung, für die Entschädigung gezahlt werden soll, auf dem Grundstück nicht mehr ausgeübt werden kann.
(2) Das Eigentum und andere Rechte an Grundstücken können zum Wohle der Allgemeinheit und zu Gunsten des Landes oder einer anderen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, der Landkreise und kreisfreien Städte auf Antrag der obersten Naturschutzbehörde enteignet werden, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, einschließlich der Vorsorge für die Erholung in Natur und Landschaft, sowie der Erfordernisse und Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist. Enteignet werden können insbesondere das Eigentum oder andere Rechte an Grundstücken, auf denen in einem Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen festgesetzt werden. Gleiches gilt für das Eigentum oder andere Rechte an Grundstücken, wenn deren Inanspruchnahme für die Einrichtung des zusammenhängenden Wander- und Reitwegenetzes nach § 26 Absatz 1 erforderlich ist. In den Fällen des Satzes 2 tritt die zuständige Planfeststellungsbehörde an die Stelle der obersten Naturschutzbehörde.
(3) Die oberste Naturschutzbehörde oder die Planfeststellungsbehörde ist auch für die Aufstellung des für die Enteignung erforderlichen Planes zuständig. Im Übrigen gilt das Enteignungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern.
(4) Wird durch Maßnahmen des Naturschutzes oder der Landschaftspflege dem Eigentümer oder einem anderen Nutzungsberechtigten ein wirtschaftlicher Nachteil zugefügt, der für den Betroffenen in seinen persönlichen Lebensumständen, insbesondere im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, eine besondere Härte bedeutet, ohne dass nach § 68 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ein Ausgleich zu leisten ist, so kann dem Betroffenen auf Antrag nach Maßgabe des Haushalts ein Härteausgleich in Geld gewährt werden, soweit dies zur Vermeidung oder zum Ausgleich der besonderen Härte geboten erscheint. Zur Leistung des Ausgleichs ist der Träger der öffentlichen Verwaltung verpflichtet, dessen Behörde die Rechtsvorschrift erlassen oder die Maßnahme getroffen hat. Absatz 1 gilt entsprechend.
(5) Das Land hat sich nach Maßgabe des Haushalts an Aufwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, für die Schaffung oder Unterhaltung von Informationseinrichtungen sowie von Wegen und Zugängen zu beteiligen, die gleichermaßen der Förderung der Erholung in Natur und Landschaft als auch dem Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft dienen.
Kapitel 9
Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern
§ 37 Aufgaben der Stiftung
(1) Unter dem Namen "Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern" besteht eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts.
(2) Das Gebiet der Stiftung erstreckt sich auf das Land Mecklenburg-Vorpommern. Der Sitz der Stiftung ist Schwerin. Die Stiftung führt das kleine Landessiegel.
(3) Die Stiftung verfolgt insbesondere im Rahmen der Naturschutzprogramme des Landes den Zweck,
- für den Naturschutz und die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts besonders geeignete Grundstücke in Mecklenburg-Vorpommern zu erwerben, anzupachten oder den Erwerb oder die Anpachtung durch Dritte durchführen zu lassen,
- den Erwerb oder die Anpachtung solcher Grundstücke durch geeignete Träger zu fördern,
- die Grundstücke nach Nummer 1 zu pflegen und zu entwickeln oder die Pflege und Entwicklung durch Dritte oder Naturschutzbehörden durchführen zu lassen,
- Maßnahmen zur Aufklärung, Ausbildung und Fortbildung zu unterstützen und zu fördern,
- die Forschung, insbesondere die integrative Umweltforschung, sowie modellhafte Untersuchungen auf dem Gebiet der natürlichen Umwelt anzuregen und zu fördern,
- sonstige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durchzuführen oder zu ihrer Durchführung beizutragen.
Die Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden bleiben unberührt. Das Nähere regelt die Satzung.
(4) Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom Kuratorium mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen wird. Die Satzung nach Satz 1 sowie ihre Änderung bedürfen der Genehmigung der obersten Naturschutzbehörde.
(5) Stiftungsbehörde ist die oberste Naturschutzbehörde.
§ 38 Stiftungsvermögen, Erlöschen der Stiftung
(1) Das Vermögen der Stiftung besteht insbesondere aus Grundbesitz.
(2) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke gemäß den §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung.
(3) Die Stiftung erfüllt ihren Zweck insbesondere durch Verwendung
- der Erträge des Stiftungsvermögens,
- von Zuwendungen des Landes nach Maßgabe des Haushaltsplanes,
- von Zuwendungen Dritter,
- von Ersatzzahlungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, sofern die Stiftung Maßnahmen im Sinne des § 15 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes durchführt oder durchführen lässt,
- von Geldbußen,
- von Erträgen aus öffentlichen Lotterien und Ausspielungen, Ausstellungen, Veranstaltungen oder Sammlungen.
(4) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie für die Rechnungslegung der Stiftung finden die für die Landesverwaltung geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung. Der Landesrechnungshof hat ein Prüfungsrecht.
(5) Im Falle des Erlöschens der Stiftung hat das Land Mecklenburg-Vorpommern das ihm zufallende Vermögen im Sinne des Stiftungszwecks zu verwenden.
§ 39 Stiftungsorgane
(1) Die Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand.
(2) Das Kuratorium besteht aus elf Mitgliedern. Ihm gehören ein Beauftragter der obersten Naturschutzbehörde und ein vom Umweltausschuss des Landtages aus seiner Mitte zu wählender Vertreter an. Ferner werden auf Vorschlag der nachstehenden Institutionen zwei vom Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege bei der obersten Naturschutzbehörde aus seiner Mitte zu wählende Vertreter sowie ein von den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern, ein von den kommunalen Spitzenverbänden, ein von den Unternehmerverbänden, ein vom Bauernverband, ein von den Landschaftspflegeverbänden und je ein von den Universitäten Greifswald und Rostock zu bestimmender Vertreter durch die oberste Naturschutzbehörde berufen.
(3) Die Mitglieder des Kuratoriums werden für die Dauer einer Legislaturperiode entsandt. Eine erneute Berufung ist zulässig.
(4) Das Kuratorium beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der Stiftung gehören. Es überwacht die Tätigkeit des Vorstandes.
(5) Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen.
(6) Der Vorstand der Stiftung besteht aus dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter. Sie werden auf Vorschlag des Kuratoriums von der obersten Naturschutzbehörde berufen.
(7) Der Vorstand hat die Beschlüsse des Kuratoriums vorzubereiten und deren Durchführung zu gewährleisten. Er führt die Geschäfte der Stiftung. Er vertritt die Stiftung; die Mitglieder des Vorstandes sind dabei alleinvertretungsberechtigt.
(8) Der Vorstand bedient sich für die Führung der Geschäfte der Stiftung der Unterstützung durch Arbeitnehmer. Auf die Arbeitnehmer der Stiftung sind die für die Arbeitnehmer des Landes geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen anzuwenden.
(9) Der Stiftung wird die Dienstherreneigenschaft verliehen. Die oberste Naturschutzbehörde ist berechtigt, Bedienstete vorübergehend an die Stiftung abzuordnen.
(10) Das Nähere regelt die Satzung.
Kapitel 10
Verfahren
§ 40 Naturschutzgenehmigung
(1) Alle für eine Maßnahme erforderlichen Entscheidungen der gemäß den §§ 4 bis 6 zuständigen Naturschutzbehörden nach dem Bundesnaturschutzgesetz, diesem Gesetz und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen oder fortgeltenden Rechtsvorschriften werden in einer einheitlichen behördlichen Genehmigung zusammengefasst (Naturschutzgenehmigung). Satz 1 gilt nicht für Entscheidungen nach § 42 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 13 Satz 1 gilt auch für Entscheidungen der in § 7 genannten Behörden, sofern sie mit Entscheidungen zusammentreffen, die gemäß Satz 1 in einer Naturschutzgenehmigung zusammengefasst werden.
(2) Die Naturschutzgenehmigung wird erteilt
- durch die Großschutzgebietsverwaltung im Rahmen ihrer Zuständigkeit gemäß § 4,
- durch die Fachbehörde für Naturschutz im Rahmen ihrer Zuständigkeit gemäß § 5,
- durch die untere Naturschutzbehörde in allen übrigen Fällen.
(3) Wären nach Absatz 2 mehrere Naturschutzgenehmigungen zu erteilen, so werden diese zusammengefasst und erteilt
- durch die Großschutzgebietsverwaltung, sofern sie nach Absatz 2 Nummer 1 zuständig ist,
- durch die Fachbehörde für Naturschutz in den übrigen Fällen, sofern sie nach Absatz 2 Nummer 2 zuständig ist.
Im Übrigen bestimmt sich die Zuständigkeit nach dem Schwerpunkt der Maßnahme; in Zweifelsfällen entscheidet die oberste Naturschutzbehörde nach Absatz 4.
(4) Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einzelfall die Zuständigkeit ergänzend oder abweichend von Absatz 3 nach dem Schwerpunkt der Maßnahme bestimmen.
§ 41 Verfahrensvorschriften für die Naturschutzgenehmigung
(1) Die Naturschutzgenehmigung wird auf Antrag erteilt.
(2) Die Naturschutzgenehmigung verpflichtet auch die Rechtsnachfolger des Verursachers. Erfüllt der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger die ihm auferlegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht und führen Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung nicht zum Erfolg, so kann die Genehmigungsbehörde für die Erfüllung dieser Verpflichtungen auch den Eigentümer des betroffenen Grundstücks in Anspruch nehmen, sofern er mit dem Eingriff einverstanden war oder ein Einverständnis nach den Umständen des Falles anzunehmen ist.
(3) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften etwas Anderes bestimmt ist, erlischt die Naturschutzgenehmigung, wenn mit der Maßnahme nicht innerhalb von drei Jahren nach Erteilung begonnen oder eine begonnene Maßnahme länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Frist kann in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag bis zu zwei Jahre verlängert werden.
(4) Betrifft die Naturschutzgenehmigung ein UVP-pflichtiges Vorhaben, so muss das Verfahren den Anforderungen der Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen.
§ 42 Konzentrationswirkung
(1) Die Naturschutzgenehmigung wird durch die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde erteilt, wenn es sich bei dem Vorhaben um eine bauliche Anlage handelt, die einer Baugenehmigung bedarf. Die zuständige Naturschutzbehörde hat das Mitwirkungsverfahren nach § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 30 durchzuführen. Über die Erteilung des Einvernehmens entscheidet die zuständige Naturschutzbehörde innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Bauaufsichtsbehörde. Sofern ein Beteiligungsverfahren nach Satz 2 durchzuführen ist, finden Satz 3 sowie § 69 Absatz 1 Satz 2 der Landesbauordnung keine Anwendung.
(2) Die Naturschutzgenehmigung wird durch die untere Forstbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde erteilt, wenn das Vorhaben einer Genehmigung nach § 15 oder § 25 des Landeswaldgesetzes bedarf. Die zuständige Naturschutzbehörde hat das Beteiligungsverfahren nach § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 30 durchzuführen.
(3) Die Naturschutzgenehmigung wird durch die Bergbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde erteilt, wenn es sich um ein Vorhaben handelt, das einer Genehmigung nach den §§ 51, 52 Absatz 1 bis 5, den §§ 53 bis 57, 126 und 127 des Bundesberggesetzes bedarf. Die zuständige Naturschutzbehörde hat das Beteiligungsverfahren nach § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 30 durchzuführen.
(4) Sofern nach den Absätzen 1 bis 3 verschiedene Behörden für die Erteilung der Naturschutzgenehmigung zuständig wären, entscheidet die oberste Naturschutzbehörde, welche Behörde für die Erteilung der Naturschutzgenehmigung zuständig ist.
(5) In allen übrigen Fällen wird die Naturschutzgenehmigung durch die in § 40 Absatz 2 bis 4 bestimmte Behörde erteilt. Das gilt nicht für andere behördliche Entscheidungen mit Konzentrationswirkung.
Kapitel 11
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, ohne dass ihm eine Ausnahme oder Befreiung erteilt wurde,
- entgegen § 13 Absatz 1 und 5 ohne Genehmigung oder Planfeststellung oberflächennahe Bodenschätze gewinnt, Abgrabungen, Aufschüttungen, Ausfüllungen, Auf- oder Abspülungen durchführt oder eine Landgewinnung am Meer vornimmt,
- entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 geschützte Bäume beseitigt oder Handlungen vornimmt, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können,
- entgegen § 19 Absatz 1 Satz 2 Alleen oder einseitige Baumreihen beseitigt oder Handlungen vornimmt, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können,
- entgegen § 20 Absatz 1 einen geschützten Biotop zerstört, beschädigt, seinen charakteristischen Zustand verändert oder ihn sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt, wenn dieser Biotop in einem gemäß § 20 Absatz 4 Satz 2 ausliegenden Verzeichnis eingetragen oder in anderer Weise dem Verantwortlichen schriftlich bekannt gegeben oder entsprechend § 20 Absatz 5 in der betreffenden Gemeinde bekannt gegeben oder gekennzeichnet worden war,
- entgegen § 20 Absatz 2 einen geschützten Geotop zerstört, beschädigt, seinen charakteristischen Zustand verändert oder ihn sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt, wenn dieser Geotop in einem gemäß § 20 Absatz 4 Satz 2 ausliegenden Verzeichnis eingetragen oder in anderer Weise dem Verantwortlichen schriftlich bekannt gegeben oder entsprechend § 20 Absatz 5 in der betreffenden Gemeinde bekannt gegeben oder gekennzeichnet worden war,
- entgegen § 23 Absatz 4 dem Schutz der Horst- und Neststandorte der Adler, Baum- und Wanderfalken, Weihen, Schwarzstörche und Kraniche zuwiderhandelt, indem er
- in der Horstschutzzone I Bestockungen entfernt oder den Charakter des Gebietes sonst verändert,
- in den Horstschutzzonen I und II in der Zeit vom 1. März bis zum 31. August land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Maßnahmen durchführt,
- in den Horstschutzzonen I und II in der Zeit vom 1. März bis zum 31. August die Jagd ausübt,
- in den Horstschutzzonen I und II stationäre jagdliche Einrichtungen errichtet oder in der Zeit vom 1. März bis zum 31. August mobile jagdliche Einrichtungen aufstellt oder benutzt; bei den Horsten des Seeadlers gelten die genannten Zuwiderhandlungen jeweils für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Juli,
- als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter anderen entgegen § 25 Absatz 3 ohne Genehmigung das Betreten der freien Landschaft nach § 25 Absatz 1 durch Sperrungen verwehrt oder wesentlich einschränkt,
- nach § 25 Absatz 3 und 4 sowie § 27 Absatz 1 Satz 4 gesperrte Flächen oder Wege betritt oder sich dort aufhält,
- entgegen § 27 Absatz 2 in Küstendünen oder auf Strandwällen Feuer entzündet oder außerhalb der gekennzeichneten Wege fährt, zeltet oder Wohnwagen, Wohnmobile oder andere Fahrzeuge aufstellt,
- entgegen § 28 Absatz 1 Zelte oder sonstige bewegliche Unterkünfte außerhalb von hierfür zugelassenen Plätzen aufstellt oder benutzt,
- entgegen § 28 Absatz 2 Satz 1 in der freien Landschaft zeltet,
- entgegen § 29 Absatz 1 an Gewässern erster Ordnung, Seen und Teichen mit einer Größe von einem Hektar und mehr sowie Küstengewässern bauliche Anlagen innerhalb des Schutzstreifens errichtet oder wesentlich ändert.
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- einer aufgrund der § 12 Absatz 2 und 7, § 14 Absatz 2 bis 4, § 17 Absatz 1, § 21 Absatz 2 und 3, § 23 Absatz 1 und 5 sowie § 27 Absatz 4 erlassenen Rechtsverordnung oder Satzung zuwiderhandelt, soweit sie für bestimmte Tatbestände auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
- unbefugt Zeichen oder Vorrichtungen, die zur Sperrung, zur Kennzeichnung von kennzeichnungsbedürftigen Flächen oder Gegenständen dienen, entfernt, beschädigt, zerstört oder auf andere Weise unbrauchbar macht.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden
- in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5, 6 Buchstabe a und Nummer 12 sowie in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro,
- in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 6 Buchstabe b bis d mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro,
- in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro.
(4) Die Bußgelder sollen Zwecken des Naturschutzes und der Landschaftspflege zugeführt werden.
(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die jeweils für die Aufgabe zuständige Behörde. Dies gilt auch für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes.
(6) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz begangen worden, so können
- Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit bezieht, und
- Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,
eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.
| Symbol der Waldoreule | Anlage 1 (zu § 14 Abs. 6) |
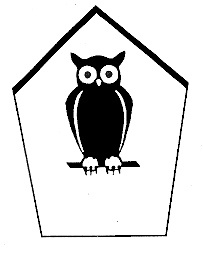
| Definitionen der gesetzlich geschützten Biotope | Anlage 2 16 (zu § 20 Abs. 1) |
Vorbemerkungen
- Die nach § 20 Absatz 1 besonders geschützten Biotope 1 werden gekennzeichnet durch
- die prägenden Standortverhältnisse einschließlich der traditionellen und aktuellen Nutzungseinflüsse,
- die charakteristische aktuelle Vegetation,
- sonstige typische geomorphologische Eigenschaften.
- Für die Biotoptypen 2 werden charakteristische Pflanzenarten genannt, wobei die "Vergesellschaftung", also das regelmäßige gemeinsame Auftreten mehrerer Arten, kennzeichnend für den Biotoptyp ist.
Neben "optimal" ausgebildeten Biotopen finden sich, durch verschiedene Einflüsse verursacht, häufiger "Degenerations- und Regenerationsstadien".Diese sind nur insoweit besonders geschützt, als noch Kennarten den Biotoptyp eindeutig charakterisieren.
- Mindestgrößen werden, sofern aus funktionalen Gründen erforderlich, jeweils bei den einzelnen Biotoptypen genannt.
Ist keine Mindestgröße angegeben, so ist der Biotoptyp auch ohne Angabe einer Mindestgröße hinreichend definiert (z.B. aufgelassene Kreidebrüche), bereits in kleinster Ausprägung geschützt (z.B. Quellen) oder er tritt so großflächig auf, dass eine Mindestflächenangabe unnötig ist (z.B. Boddengewässer). Die in den Einzelbeschreibungen der Biotoptypen genannten Mindestgrößen sind unter folgenden Voraussetzungen nicht anzuwenden:
- In dem Biotop kommt/kommen eine oder mehrere Tier- oder Pflanzenart(en) der Kategorien 0 oder 1 3 der Roten Listen Mecklenburg-Vorpommerns vor.
- In dem Biotop kommen zahlreiche Individuen einer oder mehrerer Tier- und Pflanzenart(en) der Kategorien 2 oder 3 der Roten Listen Mecklenburg-Vorpommerns vor.
Liegen mehrere geschützte Biotope in einem Komplex vor, genügt es, wenn ein Biotop die Mindestgröße erreicht.
- Geschützte Biotope, die in der Vergangenheit infolge oder trotz einer z.B. extensiven land- oder forstwirtschaftlichen Bodennutzung entstanden sind und damit ihre besonderen Eigenschaften entwickelt haben, dürfen generell in diesem zulässigen Rahmen weiter genutzt werden.
1 Feuchtbiotope
1.1 Naturnahe Moore
Als naturnahe Moore werden die von einem Überschuss an Regen- oder Mineralbodenwasser abhängigen, weitgehend unbewaldeten Biotope bezeichnet, die in ungestörtem Zustand eine torfbildende Vegetation besitzen. Je nach Naturnähe bzw. Entwässerungseinfluss können die Standorte überwässert (ungestörtes Moor) bis feucht (mäßig entwässert) sein. Die Torfmächtigkeit beträgt mindestens 30 cm. In den gesetzlichen Schutz sind auch die Degenerations- und Regenerationsstadien einbezogen, sofern diese noch von typischen Moorpflanzen geprägt werden.
Zu unterscheiden sind die hier beschriebenen "offenen" Moore von den "bewaldeten" Mooren (vgl. 4.1).
Nach der Hydrologie und Entwicklungsgeschichte können hydrologische Moortypen unterschieden werden: In den jungeiszeitlich überformten Grundmoränenlandschaften Mecklenburg-Vorpommerns treten insbesondere Überflutungs-, Durchströmungs- und Quellmoore, im Küstenbereich auch Regenmoore auf. Die Endmoränenbereiche sind besonders durch Verlandungs- und Kesselmoore charakterisiert, die Altmoränenlandschaft Südwest-Mecklenburgs durch Versumpfungsmoore.
Nach dem Nährstoffgehalt und den hydrochemischen Verhältnissen sind folgende ökologische Moortypen zu unterscheiden: Armmoore (oligotrophsauer), Sauer-Zwischenmoore (mesotrophsauer), Basen-Zwischenmoore (mesotrophsubneutral), Kalk-Zwischenmoore (mesotrophkalkhaltig) und Reichmoore (eutroph).
Mindestgrößen:
Basen- und Kalk-Zwischenmoore: 25 m2
Kessel- und Quellmoore: 100 m2
Übrige Moortypen: 1.000 m2
Regenerierte Flach-Abtorfungsbereiche: 1.000 m2 (vgl. 2.4)
Typische Merkmale der Vegetation:
Armmoore (Regenmoore): Der Boden ist weitgehend von Torfmoosen bedeckt. Dazwischen können Wollgräser, Glocken-Heide, Sumpf-Porst, Sonnentau, Moosbeere u. a. Arten eingestreut sein. Im zentralen Moorbereich ist ein baumfreies Bülten (20-50 cm erhöhte Moospolster) - Schlenkenmosaik (Wasserlachen) typisch.
Bei Störungen des Wasserhaushalts (frühere Entwässerung, Torfabbau) bilden sich auf den grundwasserbeherrschten Moorböden Zwergstrauchheiden mit Heidekraut, Rausch-, Blau- und Preiselbeere oder Pfeifengrasbestände heraus.
Bei bereits längere Zeit bestehender Austrocknung des Moores und tieferen Grundwasserständen ist der Baumwuchs stark ausgebildet und besteht überwiegend aus Moorbirken und Kiefern (vgl. 4.1).
Großflächige Flachabtorfungen von Armmooren unterliegen dem gesetzlichen Schutz, wenn sie sich regeneriert haben und typische Moorvegetation dominiert (vgl. 2.4).
Sauer-Zwischenmoore (Kesselmoore, Verlandungsmoore): In den Sauer-Zwischenmooren herrschen ebenfalls Torfmoosrasen sowie Kleinseggenriede vor. Die Wollgräser werden weitgehend durch Riedgräser (Faden-Binse, Zwiebel-Binse, GrauSegge, Faden-Segge, Schnabel-Segge) ersetzt. Typische Pflanzen sind u. a. Blutauge, Fieberklee, Sumpffarn, Schnabelried, Sumpf-Calla.
Häufig auftretende Waldgesellschaften auf schwach entwässerten Moorböden mit moortypischer Krautvegetation sind Schnabelseggen-Kiefern-Birken-Bruchwälder, Torfmoos-BirkenErlen-Bruchwälder und Weidengebüsche (vgl. 4.1).
Basen-Zwischenmoore (Durchströmungsmoore, Verlandungsmoore): Dieser Moortyp ist in weiten Teilen der vermoorten Flusstäler dominierend. Bei ungestörtem Wasserhaushalt herrschen laubmoosreiche Seggenriede mit einer großen Vielfalt an Blütenpflanzen vor. Bei mäßiger Entwässerung und extensiver landwirtschaftlicher Nutzung ohne Düngung sind artenreiche Feuchtwiesen (Pfeifengraswiesen) entstanden.
Bei Zufuhr von Stickstoffdünger entstehen Honiggraswiesen bzw. Kohldistelwiesen (siehe auch 1.5).
Typische Pflanzenarten sind z.B.: Kuckucks-Lichtnelke, Wiesen-Knöterich, Trauben-Trespe, Kohldistel, Echtes Mädesüß, Pfeifengras, Sumpf-Schafgarbe, Nordisches Labkraut, Färber-Scharte, Teufelsabbiss.
Durch ausbleibende landwirtschaftliche Nutzung verläuft die Entwicklung über Weiden- und Faulbaumgebüsche hin zu Erlenbruchwäldern (vgl. 4.1).
Kalk-Zwischenmoore (Verlandungsmoore, Quellmoore, Durchströmungsmoore): Sie sind meist durch Verlandung an Seeufern bzw. in den Flusstalmooren entstanden. Schwach entwässerte Standorte wurden auch extensiv landwirtschaftlich ohne Düngung genutzt.
Kalk-Zwischenmoore werden z.B. durch Braunmoos-Schneidenriede mit der Dominanz der Binsen-Schneide, durch das Mehlprimel-Kopfbinsenried (Mehl-Primel, Echtes Fettkraut, Rostrotes Kopfried, Sumpf-Sitter u. a.) und das BraunmoosKalkbinsenried (Blauer Tarant, Stumpfblütige Binse) charakterisiert (vgl. 1.4).
Nach Auflassung genutzter, schwach entwässerter Standorte entstehen Bruchwälder (vgl. 4.1).
Reichmoore (Quellmoore, Überflutungsmoore, Versumpfungsmoore, Verlandungsmoore): Diese Moorformen sind aufgrund ihrer Abstufungen im Säure-Basenverhalten sehr vielgestaltig. Die ursprüngliche Vegetation setzt sich aus Großseggenrieden, Weidengebüschen und Erlenbruchwäldern zusammen.
Heute weisen die meisten dieser Moore als Ergebnis ihrer Nutzungsgeschichte Bruchwälder und -gebüsche, Feuchtwiesen, Röhrichte und Hochstaudenfluren auf.. Typische Pflanzenarten der Feuchtwiesen sind z.B. Sumpf-Dotterblume, Sumpf-Kratzdistel, Schlank- und Sumpf-Segge, Wiesen-Schaumkraut, Sumpf-Schachtelhalm, Wald-Engelwurz, Sumpf-Hornklee, Echtes Mädesüß, Gemeines Helmkraut, Wasser-Schwaden und Echter Baldrian (vgl. 1.2, 1.4, 1.5, 4.1).
1.2 Naturnahe Sümpfe
Naturnahe Sümpfe sind überwiegend gehölzarme Lebensräume auf mineralischen oder flachgründig torfigen (bis 40 cm Mächtigkeit) oder anmoorigen Böden, die aufgrund von Oberflächen-, Quell- oder hoch anstehendem Grundwasser überwässert bis feucht (mäßig entwässert) sind.
Man kann sie teilweise als frühe Entwicklungsstadien von Mooren (Versumpfungsmooren) ansehen, die erst wenig Torf akkumuliert haben. In anderen Sümpfen hat sich durch wechselnde Wasserführung über längere Zeit ein Gleichgewicht von Torfbildung und Torfzersetzung eingestellt.
Solche Biotope liegen z.B. auf extensiv landwirtschaftlich genutzten anmoorigen Standorten oder an flachen Seeufern mit schwankenden Wasserständen, die eine normale Verlandung unterbrechen. Ein sumpfartiges Entwicklungsstadium kann auch bei der Renaturierung von Mooren auftreten.
Mindestgröße: 100 m2
Typische Merkmale der Vegetation:
Abhängig vom Nährstoffgehalt, der Nutzung und vom Bodenwasserhaushalt können sich unterschiedliche Vegetationstypen herausbilden, die in den meisten Fällen Übergänge zu anderen geschützten Biotopen darstellen.
Sümpfe können Seggenriede, Sumpfreitgras-, Mädesüß-, Hundsstraußgras-, Binsen-, Sumpfsimsen-, Sumpfschachtelhalmfluren, Weidengebüsche (insbesondere Grau-Weiden), Röhrichte und Vegetationstypen der Verlandungszonen aufweisen. Es kommen auch z.B. Überschneidungen mit Quellbereichen und Übergänge zu Bruch- und Sumpfwäldern vor (vgl. 1.4, 1.5, 2.2, 2.6, 4.1).
1.3 Sölle
Sölle sind Hohlformen verschiedener Größe und Formen, die mindestens zeitweilig Wasser führen und dementsprechend meist eine Wasser- oder Sumpfvegetation sowie oft einen Gehölzsaum aufweisen.
In der Regel weisen sie einen umlaufenden Steilrand oder eine schwache Umwallung auf. In der geowissenschaftlichen Fachterminologie sind Sölle Hohlformen, die durch Ausschmelzen von Toteis oder andere späteiszeitliche Prozesse entstanden sind. Neben diesen Söllen im engeren Sinn sind auch andere Geländehohlformen, die o. a. Merkmale aufweisen und die durch menschliche Einflüsse entstanden sind, besonders geschützte Biotope.
Mindestgröße: 25 m2
Typische Merkmale der Vegetation:
Oft ist eine Unterwasser-, Schwimmblatt- oder Röhrichtvegetation ausgebildet (vgl. 1.4, 2.5). Für Sölle mit starken Wasserspiegelschwankungen sind Pflanzengesellschaften zeitweilig trockenfallender Teichböden (Zweizahnfluren) sowie das Weiße Straußgras charakteristisch (vgl. 2.6).
Bedingt durch Nährstoffeinträge aus den umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen haben sich häufig ruderale, nitrophile Staudenfluren ausgebildet. Der Gehölzsaum besteht meist aus Weiden und Erlen (vgl. 4.1).
1.4 Röhrichtbestände und Riede
In diesen Pflanzengesellschaften dominieren röhricht- bzw. riedbildende Arten.
Unterschieden werden Wasser- und Landröhrichte. Süßwasserröhrichte treten an Fließ- und Stillgewässerufern des Binnenlandes auf; Brackwasserröhrichte, die durch andere Begleitarten charakterisiert werden, kommen an den Ufern der Boddengewässer und im Mündungsbereich von Fließgewässern vor (vgl. 5.6). Landröhrichte entstehen oberhalb der Mittelwasserlinie im Überflutungsbereich der Binnen- und Küstengewässer sowie in vernässten Bereichen (Röhrichtbestände auf Acker- und Wiesenbrachen).
Riede werden weitgehend von Sauergräsern gebildet. Unterschieden werden Groß- und Kleinseggenriede. Sie kommen insbesondere im Verlandungsbereich von Stand- und Fließgewässern sowie auf Zwischenmoorstandorten vor (vgl. 1.1, 1.2, 2.1).
Röhrichtbestände und Riede sind häufig Bestandteil anderer geschützter Biotope.
Mindestgröße: 100 m2 (bei linearer Ausprägung Mindestbreite: 5 m)
Typische Merkmale der Vegetation:
Neben dem Gemeinen Schilf bilden insbesondere Rohr-Glanzgras, Rohrkolben- und Schwadenarten sowie großwüchsige Simsen hohe Röhrichte. Kleinröhrichte bestehen vor allem aus krautigen Pflanzen unter 70 cm Wuchshöhe (z.B. Froschlöffel, Schwanenblume, Brunnenkresse, Kalmus, Schachtelhalm- und Igelkolbenarten).
Großseggenriede werden durch hochwüchsige Seggenarten, wie z.B. Schlank-Segge, Schwarzschopf-Segge, Steif-Segge, Ufer-Segge, Rispen-Segge und Sumpf-Segge sowie weitere Sauergräser (u. a. Gemeine Strandsimse, Binsen-Schneide) dominiert, während Kleinseggenriede durch kleinwüchsige Seggenarten charakterisiert werden.
1.5 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen
Der Biotoptyp umfasst durch extensive landwirtschaftliche Nutzungen (vorwiegend Mand) auf Moor- oder anmoorigen, grundwasserbeherrschten Böden sowie auf wechselfeuchten, oft überfluteten Böden entwickelte meist artenreiche Wiesen, in deren Pflanzengesellschaften Seggen und Binsen stets vertreten sind.
Verfalls- und Brachestadien von Saatgrasland, die insbesondere durch Binsenhorste gekennzeichnet sind, unterliegen nicht dem besonderen Schutz. Dies gilt auch für intensiv beweidete Grünländer, auf denen nur die Flatter-Binse als Verdichtungs- und Weidezeiger vorkommt.
Mindestgröße: 200 m2
Typische Merkmale der Vegetation:
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen können je nach der Nutzung und den Standortverhältnissen als Sumpfdotterblumen-, Kohldistel-, Honiggras-, Kalkbinsen-, Sumpfherzblatt-, Wassergreiskraut-, Wiesenknopf-Silgen-, Rasenschmielen-, Wiesenknöterich-, Trollblumen-, Waldsimsen- oder Pfeifengraswiesen ausgebildet sein.
Bei ausbleibender oder unregelmäßiger landwirtschaftlicher Nutzung können sich hochstaudenreiche Ausbildungsformen entwickeln (z.B. mit Sumpf-Kratzdistel, Kohldistel, Mädesüß, Gilbweiderich, Wald-Simse, Engelwurz- und Pestwurzarten, Echter Baldrian, Blutweiderich, Wasserdost, Wolfstrapp usw.).
2 Gewässerbiotope
2.1 Naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte einschließlich der Ufervegetation
Bäche sind Fließgewässer geringer Breite, Flüsse sind mehr als 5 m breit. Sie gelten als naturnah, wenn sie durch einen unregelmäßig wechselnden Lauf (z.B. Ausbildung von Mäandern, Gleit- und Prallhängen, Altwässern und Verzweigungen), durch Variabilität des Gewässerbettes (z.B. Bänke, Fließrinnen, Kolke), durch naturraumtypisches Bodensubstrat (z.B. Schlick, Sand, Kies, Geröll, Torf) sowie durch naturraumtypischen Bewuchs der Ufer gekennzeichnet sind.
Im Mündungsbereich der Flüsse sind natürliche Rückstauerscheinungen typisch. Eine Besonderheit der Bäche und Flüsse im Endmoränengebiet ist das häufige Durchfließen von Seen und die Ausbildung von Durchbruchstälern.
Naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte sind nicht durch Sohl- bzw. Uferbefestigungen sowie durch technische Querbauwerke (Wanderbarrieren z.B. für Fische) in ihrer Entwicklung und Besiedlung beeinträchtigt.
Als geschützter Uferbereich gilt in den durch das Gewässer geprägten Auen jeweils ein Uferstreifen in einer Breite von 7 m ab Böschungsoberkante, sofern nicht weitere geschützte Biotope angrenzen (vgl. 1.4, 1.5, 4.1).
Mindestlänge: 50 m
Typische Merkmale der Vegetation:
Schnellfließende sowie beschattete naturnahe Bäche weisen nur eine spärliche Wasservegetation auf.
In unbeschatteten, langsam fließenden Bachläufen entwickelt sich eine üppige Vegetation, u. a. mit Flutendem Wasserhahnenfuß, Pfeilkraut, Laichkraut-, Wasserstern-, Igelkolben- und Röhrichtarten (vgl. 1.4). In Stillwasserzonen von Flussläufen können auch Schwimmblattgesellschaften vorkommen.
Als bachbegleitende Uferpflanzen treten u. a. Pestwurzarten, Berle, Echter Baldrian und Echte Engelwurz auf. Die Gehölze bestehen aus Erlen-Eschen-Säumen, Erlen-Eschen-(Bruch-)Wäldern und Weidengebüschen.
2.2 Quellbereiche einschließlich der Ufervegetation
Quellen sind natürliche, örtlich begrenzte, dauerhafte oder zeitweilige Grundwasseraustritte an der Erdoberfläche. Sie können als Wasseraustritte mit Quelltopf oder in einem Tümpel, aus denen ein Bach abfließt, als Sturzquelle oder als Sicker- oder Sumpfquelle, die Quellsümpfe oder Moore ausbilden, in Erscheinung treten.
Quellbereiche sind oft über die Umgebung aufgewölbt (Quellkuppen). Eine in Mecklenburg-Vorpommern seltene Quellenform sind die Kalktuffquellen, an deren Austritt sich biogene Quellkalke gebildet haben bzw. bilden, sie sind gleichzeitig gesetzlich geschützte Geotope (vgl. Anlage 3 zu § 20 Absatz 2).
Gefasste Quellen, die durch Baumaßnahmen befestigt wurden und keine typische Vegetation aufweisen, unterliegen nicht dem gesetzlichen Schutz.
Typische Merkmale der Vegetation:
Die Vegetation von Quellen ist stark von der Beschattung sowie von den Wasserabflussverhältnissen und den Wasserinhaltsstoffen abhängig. Quellen können völlig vegetationsfrei sein oder unter anderem folgende Biotope aufweisen: quellige Erlen-Eschenwälder, Moorbirkenwälder, Grauweidengebüsche, Quellfluren, Röhrichte, die bei entsprechender extensiver landwirtschaftlicher Nutzung in Quellwiesen (Trollblumen-, Waldsimsen- oder Kalkbinsenwiese) überführt werden können (vgl. 1.4, 1.5, 4.1).
Für Quellfluren sind z.B. Bitteres und Wald-Schaumkraut, Milzkrautarten, Rispen-Segge und Riesen-Schachtelhalm typisch. Kalktuffquellen werden durch Tuffmoose geprägt.
2.3 Altwässer einschließlich der Ufervegetation
Altwässer sind natürlich oder künstlich abgetrennte ehemalige Flussstrecken, die als dauernd oder regelmäßig über längere Zeit wasserführende Gewässer unmittelbar oder mittelbar mit dem Abflussregime eines Flusses (z.B. bei Hochwasser) verbunden sind.
Altarme stehen als ehemalige Flussstrecken dauernd einseitig (oder beidseitig, dann jedoch nicht dauernd durchströmt) mit dem Fließgewässer in Verbindung.
Typische Merkmale der Vegetation:
Durch Auflandungen (Geschiebe- und Schwebstoffablagerungen bei Überschwemmungen) und Verlandungen (Ablagerungen abgestorbener organischer Substanzen, die im Altwasser erzeugt wurden) entsteht eine deutliche Zonierung der Vegetation, die von Unterwasserrasen, Laichkraut- und Schwimmblattpflanzen, Röhrichten und Seggenrieden bis zu Bruchwäldern reicht (vgl. 1.4, 2.6, 4.1).
2.4 Torfstiche einschließlich der Ufervegetation
Torfstiche sind ständig oder zeitweilig wasserführende, unbewaldete Torfentnahmestellen mit gewöhnlich regelmäßigen Formen, die auf menschliche Tätigkeiten in verschiedenen Zeiträumen zurückzuführen sind. Zu unterscheiden sind:
- Handtorfstiche, die über mehrere Jahrhunderte angelegt wurden und kleine flache Abgrabungen hinterließen, die sich heute in einem fortgeschrittenen Verlandungsstadium befinden,
- weitaus größere und tiefere Maschinentorfstiche, die insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach den beiden Weltkriegen sowie örtlich in den siebziger Jahren erschlossen wurden und
- maschinelle Flachabtorfungen insbesondere in den Regenmooren, die u. a. für gärtnerische Zwecke bis in die Gegenwart betrieben werden.
Torfstiche unterliegen dem gesetzlichen Schutz, wenn eine moor- oder kleingewässertypische Vegetation dominiert (vgl. 1.1, 2.5).
Mindestgrößen:
Regenerierte Torfstiche: 25 m2 (vgl. 2.5)
Regenerierte Flachabtorfungsbereiche: 1.000 m2 (vgl. 1.1)
Typische Merkmale der Vegetation:
Handtorfstiche weisen in ihren verschiedenen Verlandungsstadien alle Übergänge von Schwingrasengesellschaften über Großseggenriede, Weidengebüsche bis zu Erlenbruchwäldern auf (vgl. 1.1, 1.4, 4.1).
Aufgelassene Maschinentorfstiche, die häufig auch mit einem Fließgewässer in Verbindung stehen, sind meist von einem schmalen Erlen-Birkensaum umgeben. Je nach Tiefe ist die Unterwasservegetation unterschiedlich ausgeprägt. Bei etwas flacheren Torfstichen sind z.B. Krebsscheren- und Seerosenbestände typisch (vgl. 2.6).
Aufgelassene, flach abgetorfte Flächen der Regenmoore sind, eine entsprechende Wasserführung vorausgesetzt, nur bei einer flächenhaften Wiederbesiedlung mit typischen Moorpflanzen, wie z.B. Torfmoosen und Wollgras, besonders geschützt (vgl. 1.1).
2.5 Stehende Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation
Hierunter fallen Stillgewässer bis zu 1 ha Wasserfläche, die natürlich (Weiher) oder aufgrund der Tätigkeit des Menschen (Teiche, Abgrabungsgewässer) entstanden sind. Auch zeitweilig trockenfallende Kleingewässer (Tümpel) sind besonders geschützt. Künstlich entstandene Stillgewässer sind geschützte Biotope, wenn sie sich aufgrund von Nutzungsaufgabe oder nur extensiver Nutzung naturnah entwickelt haben. Der gewerblichen Fischerei dienende Teiche sind keine geschützten Biotope, es sei denn, sie wurden über 30 Jahre nicht mehr zu diesem Zweck genutzt und haben sich naturnah entwickelt.
Kennzeichen für den naturnahen Zustand sind naturnahe Uferstrukturen, in der Regel mit typischer Verlandungsvegetation. Darüber hinaus kann auch eine artenreiche Fauna, z.B. von Amphibien und Libellen, als Kriterium für die Naturnähe herangezogen werden.
Es ergeben sich Überschneidungen mit Söllen, Torfstichen und Altwässern (vgl. 1.3, 2.3, 2.4).
Mindestgröße: 25 m2
Typische Merkmale der Vegetation:
Naturnahe stehende Kleingewässer sind meist durch artenreiche Röhricht-, Schwimmblatt- oder Unterwasservegetation gekennzeichnet, können aber auch durch Nährstoffarmut oder Beschattung bedingt vegetationsarm sein.
Besonders verbreitet sind Schwimmblattgesellschaften mit Wasserlinsen-, Wasserstern- und Laichkrautarten.
2.6 Verlandungsbereiche stehender Gewässer
Der Begriff umfasst den Lebensraum der Randzonen von Stillgewässern, in denen natürliche Verlandungsprozesse ablaufen, einschließlich ihrer Anfangs- und Endstadien. Ihre Begrenzung ist landwärts die Grenze der grundwassernahen organischen Bodenbildung oder, soweit diese nicht oder noch nicht ausgebildet ist, das Ende der ufertypischen Pflanzengesellschaften.
Wasserwärts kann der Verlandungsbereich abhängig von der submersen Vegetation bis in mehrere Meter Wassertiefe reichen; bei flacheren Gewässern umfasst er den gesamten Wasserkörper.
Typische Merkmale der Vegetation:
Im Verlandungsbereich sind insbesondere Unterwasserrasen, Laichkrautgesellschaften, Wasserlinsen- und Seerosengesellschaften, Schwingrasen, Röhrichte, Seggenriede, Hochstaudenfluren, Gebüsche und Bruchwälder typisch (vgl. 1.2, 1.4, 4.1).
Bei entsprechender extensiver landwirtschaftlicher Nutzung der Uferzonen treten z.B. Kohldistel-, Pfeifengras- und Sumpfdotterblumenwiesen auf (vgl. 1.5).
3 Trockenbiotope
3.1 Zwergstrauch- und Wacholderheiden
Von Zwergsträuchern, namentlich Heidekrautgewächsen, dominierte mehrjährige Pflanzenformationen, zum Teil mit eingestreuten Wacholderbüschen, meist auf bodensauren, kalk- und nährstoffarmen Sandstandorten. Gehölze können bis zu einem Deckungsgrad von 30 Prozent vorhanden sein.
In Mecklenburg-Vorpommern kommen nur im Küstenbereich natürliche Heiden vor. In anderen Gebieten entstehen sie sekundär durch menschliche Nutzung (Abholzung, Beweidung, Brände, militärische Nutzung). Auch vergraste Alterungs- und Degenerationsstadien der Zwergstrauchheide sind eingeschlossen.
Nicht dem gesetzlichen Schutz unterliegen kurzlebige Heiden auf Schlagflächen im Wald.
Mindestgröße: 100 m2 (bei linearer Ausprägung Mindestbreite: 5 m)
Typische Merkmale der Vegetation:
Trockenheiden: Vom Heidekraut (Besenheide) geprägter Heidetyp auf trockenen, sandigen Standorten, teilweise mit flächenhaftem Bewuchs von Besenginster oder Wacholder ("Wacholderheide"). Weitere charakteristische Arten sind z.B. Pillen-Segge, Dreizahn, Habichtskrautarten und Erdflechten sowie Englischer Ginster und Haar-Ginster.
Bei Alterungsstadien kann es auch zur Dominanz von Gräsern (vor allem Drahtschmiele, Schaf-Schwingei) kommen.
Feuchtheiden: Auf anmoorigen, grundwasserbeherrschten Böden, aber auch auf austrocknenden Armmooren, kommen Glocken-Heide, Pfeifengras, Sparrige Binse sowie oft auch Torfmoose herrschend vor.
Krähenbeeren-Heiden: Von Krähenbeere, Besenheide sowie der Kriech-Weide geprägte Pflanzengesellschaft der festgelegten Küstendünen (Grau- bzw. Braundünen) sowie einiger Binnendünenstandorte. Weitere typische Arten sind z.B. Berg-Jasione, Sand-Segge und Habichtskräuter.
3.2 Trocken- und Magerrasen
Trocken- und Magerrasen sind geprägt durch niederwüchsige, ausläufer- und horstbildende Gräser und eine oft artenreiche, buntblühende Krautflora; Gehölze können bis zu einem Deckungsgrad von 30 Prozent eingestreut sein. Magerrasen sind durch Nährstoffarmut oder geringe Nährstoffverfügbarkeit gekennzeichnet. Trockenrasen bilden sich auf wasserdurchlässigen oder flachgründigen und somit trockenen Standorten. Das Substrat kann sehr unterschiedlich sein (Sand, Kies, Lehm, Kreidefelsen). Mager- und Trockenrasen bilden sich ohne Nutzung z.B. an der Küste oder auf in Bewegung befindlichen Binnendünen. Überwiegend entstanden oder entstehen sie aufgrund extensiver Nutzungen (Beweidung oder Mand ohne Nährstoffzufuhr, militärische Nutzung auf Truppenübungsplätzen) und bedürfen zu ihrer Erhaltung einer Fortführung dieser Nutzungen.
Mindestgröße: 200 m2 (bei linearer Ausprägung Mindestbreite: 5 m)
Auch Mager- und Trockenrasen, die sich nicht eindeutig einem der unten genannten Typen zuordnen lassen, z.B. ruderalisierte Magerrasen oder Fragmentgesellschaften wie die Straußgrasflur sind besonders geschützte Biotope, wenn sie noch das typische Arteninventar aufweisen und nicht nur kurzlebige Entwicklungsstadien z.B. in Kahlschlagfluren darstellen.
Typische Merkmale der Vegetation:
Silbergrasfluren: Diese Pioniergesellschaft wird geprägt durch Silbergras, Sand-Segge sowie die Charakterarten Bauernsenf und Frühlings-Spergel. Fortgeschrittenere Sukzessionsstadien werden zuweilen durch Erdflechten und Moose geprägt.
Kleinschmielenrasen entwickeln sich häufig in Kontakt zu Silbergrasfluren. Sie können als Nelkenhafer-Gesellschaften, Thymian-Schafschwinge]-Gesellschaften oder als Gesellschaft des Schmalblättrigen Rispengrases ausgebildet sein. Typische Pflanzenarten sind z.B.: Nelken-Haferschmiele, Schaf-Schwingel, Sand-Thymian, Schmalrispiges Straußgras und Berg-Jasione.
Grasnelkenfluren: Weitgehend geschlossene, niedrige, blütenreiche Rasen auf verfestigten, etwas humosen Sandböden, vor allem auf Terrassensanden und Binnendünen. Charakteristische Pflanzenarten sind z.B. Grasnelke, Heide-Nelke, Silber-Fingerkraut, Hasen-Klee, Strohblume, Knolliger Hahnenfuß, Ferkelkraut, Echtes Labkraut und Feld-Beifuß.
Für die subkontinental geprägten Fluren sind Rauhblatt-Schwingel, Steppen-Lieschgras und Kartäuser-Nelke typisch.
Borstgrasrasen wachsen auf nährstoffarmen, bodensauren, sandigen bis lehmigen, z. T. auch torfigen Böden mäßig trockener bis wechselfeuchter Standorte. Sie werden geprägt durch das Borstgras.
Für trockene Borstgrasrasen sind z.B. Gemeine Kreuzblume, Hunds-Veilchen, Tüpfel-Hartheu, Habichtskräuter und Blutwurz typisch (Kreuzblumen-Borstgrasrasen).
Die auf sauren Anmoorböden wachsenden, feuchten Borstgrasrasen werden durch Nässezeiger wie Sparrige Binse, Teufelsabbiss, Wiesen-Segge und Sumpf-Veilchen geprägt und kommen häufig im Kontakt zu Feuchtheiden vor (Seggen-Binsen-Borstgrasrasen).
Blauschillergrasfluren sind lockere, niedrige Sandtrockenrasen des subkontinentalen Klimabereiches auf warmen, trockenen, humusarmen, relativ kalkreichen Sandstandorten. Sie werden geprägt durch Blaugrünes Schillergras sowie SandSchwingel, Dünen-Schwingel, Leimkraut und Habichtskrautarten. In verarmten Ausbildungen kommt auch der Feld-Beifuß vor.
Kalk-Halbtrockenrasen kommen vor allem auf Rügen und im Randowtal, in floristisch verarmter Form, aber auch an anderen Stellen des jungpleistozänen Tieflandes auf mittelgründigen Lehm- und Kalkverwitterungsböden vor. Kennzeichnende Pflanzenarten sind u. a. Fieder-Zwenke, Gemeiner Wundklee, SaatEsparsette, Golddistel, Wiesen-Primel, Knolliger Hahnenfuß, Zittergras und Tauben-Skabiose.
3.3 Aufgelassene Kreidebrüche
Kreidebrüche entstehen durch den Abbau von Kreidevorkommen. Durch die bergbauliche Nutzung der Kreide entstehen mehr oder weniger große Hohlformen, von denen ein Teil Wasser führen kann, sowie Rohboden-Schutthalden.
Sobald die Nutzung noch bestehender Kreidebrüche eingestellt wird, sind diese geschützte Biotope, weil auch die vegetationsarmen Anfangsstadien als Lebensraum von z.B. Amphibien und Hautflüglern von Bedeutung sind.
Typische Merkmale der Vegetation:
Je nach Sukzessionsstadium findet man ein vielfältiges Mosaik von Rohböden mit nur spärlicher Vegetation, geprägt durch diverse Mager- und Trockenrasenarten, orchideenreichen Kalk-Halbtrockenrasen und kalkreichen Kleingewässern (z.B. mit Schachtelhalm-Verlandungsfluren und Armleuchteralgen-Rasen sowie Seeverlandungsvegetation). In bereits längere Zeit außer Nutzung befindlichen Kreidebrüchen siedeln sich Gebüsche aus Sal-, Lorbeer- und Grau-Weiden, Birken und Berg-Ahorn an (vgl. 1.4, 2.5, 3.2, 4.2, 4.3).
4 Gehölzbiotope
4.1 Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder
Bruch- und Sumpfwälder sind naturnah zusammengesetzte Wälder auf natürlicherweise nassen Moor- oder Mineralböden einschließlich ihrer Vorwaldstadien. Mäßig entwässerte Bruch- und Sumpfwälder auf grundwasserbeherrschten Böden gelten als gesetzlich geschützt, soweit in der Krautschicht noch typische feuchteanzeigende Pflanzenarten dominieren (vgl. 1.1, 1.2).
Auwälder umfassen zum einen Bestände, die auf mineralischen Auenböden im Überflutungsbereich großer Fließgewässer stocken und der Dynamik des zügigen, stark wechselnden Grundwassers (in Mecklenburg-Vorpommern nur im Elbetal und an der Sude vorkommend) unterliegen, sowie zum anderen die entlang von Fließgewässern mit bewegtem Grundwasser in den Flusstalmooren und Bachniederungen vorherrschenden Wälder.
Diese gesetzlich geschützten Biotope wurden in der Vergangenheit überwiegend in verschiedensten Formen forstwirtschaftlich genutzt (z.B. Niederwaldnutzung von Bruchwäldern). Die traditionellen, ordnungsgemäßen forstlichen Bodennutzungen werden durch den gesetzlichen Biotopschutz nicht ausgeschlossen, sofern nicht die Standorteigenschaften, z.B. durch Entwässerungsmaßnahmen, nachhaltig verändert werden.
Bruch-, Sumpf- und Auwälder sind vielfach nur noch in Form von schmalen, fließgewässerbegleitenden Säumen vorhanden, die als dauerbestockte Ufergehölze auch eine besondere Bedeutung für den Gewässerschutz haben (vgl. 2.1).
Mindestgrößen:
Wälder: 5.000 m2 (bei fließgewässerbegleitenden Säumen Mindestlänge: 50 m)
Gebüsche: 100 m2
Typische Merkmale der Vegetation:
Bestandsbildende Baumarten der Bruch- und Sumpfwälder sind Moor-Birke, Schwarz-Erle, Esche, Gewöhnliche Traubenkirsche, Kiefer oder Bruch-Weide. Häufige Sträucher sind Grau-Weide, Lorbeer-Weide, Faulbaum, Gagel und Ohr-Weide.
Diese Arten bilden je nach Wasserstufe und Nährstoffversorgung der Böden verschiedene Gesellschaften von Erlen-Bruchwäldern, Birken-Bruchwäldern, Birken-Kiefern-Moorwäldern, Erlenwäldern und Erlen-Eschenwäldern.
Als Vorwaldstadien kommen auch Gebüsche aus den o. g. Gehölzarten vor.
Für die Krautschicht sind z.B. Bitteres Schaumkraut, Breitblättriger Dornfarn, Gemeiner Gilbweiderich, Grau-Segge, Schnabel-Segge, Sumpf-Segge, Ufer-Segge, Winkel-Segge, Großes Hexenkraut, Kohldistel, Quell-Sternmiere, Sumpf-Reitgras, Sumpf-Vergissmeinnicht, Ufer-Wolfstrapp, WaldEngelwurz, Wald-Simse, Wasser-Schwertlilie und Zungen-Hahnenfuß typisch.
Nicht unter den gesetzlichen Schutz fallen die auf den tiefer entwässerten Moorböden stockenden Eichen-, Buchen- und Kiefern-Moorwälder und die Bestände, in denen die Entwässerungs- und Stickstoffzeiger in der Krautschicht dominieren.
Bei den Auwäldern auf mineralischen Böden werden in Abhängigkeit von der jährlichen Überflutungsdauer Weichholzauen und Hartholzauen unterschieden. Die natürliche Baumartenkombination der Weichholzauen besteht aus verschiedenen Weidenarten (Silberweiden-Auenwälder); Hartholzauen werden durch Stiel-Eiche, Feld-, Berg- und Flatter-Ulme, Esche sowie Ahornarten geprägt (Stieleichen-UlmenAuenwälder).
Hartholzauenwälder, die infolge Ausdeichung keiner Überflutung mehr unterliegen und sich in artenreiche Buchenwälder entwickelt haben, unterliegen nicht dem gesetzlichen Schutz.
Die Auwälder in den Flusstalmooren und den Bachniederungen leiten zu den Erlen-Bruchwäldern über, typisch sind verschiedene Ausbildungen der Erlen-Eschenwälder.
4.2 Naturnahe Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte
Es handelt sich zum Teil um natürliche oder um naturnahe, durch wirtschaftliche Nutzungen wie Waldweide und Niederwaldbewirtschaftung bedingte, meist schwachwüchsige Wälder und Gebüsche aus trockenheitsertragenden und teils wärmebedürftigen Pflanzenarten. Sie stocken meist auf südlich oder westlich exponierten Hängen.
Mindestgröße:
Wälder: 5.000 m2
Gebüsche: 100 m2
Typische Merkmale der Vegetation:
Wälder trockenwarmer Standorte: Auf kalkarmen Böden stocken durch subkontinentales Klima geprägte Haarstrang- und Kuhschellen-Kiefernwälder mit den typischen Arten Berg-Haarstrang, Wiesen-Küchenschelle, Blaugrünes Schillergras, Sand-Thymian und Sand-Nelke. Auf kalkreichen, wärmebegünstigten Steilhängen kommen Orchideen- und Elsbeeren Buchenwälder vor.
Die gut ausgebildete Strauchschicht wird z.B. von Hartriegel, Alpen-Johannisbeere, Roter Heckenkirsche und teilweise von Wacholder geprägt. In der Krautschicht sind Weiße Schwalbenwurz, Wiesen-Primel, Finger-Segge, Blaugrüne Segge sowie Waldvögleinarten und Braunrote Stendelwurz typisch.
Gebüsche trockenwarmer Standorte: Die Strauchbestände auf trockenen, wärmebegünstigten, meist hängigen Standorten werden durch Schlehe, Hartriegel, Rosenarten und Weißdorn bestimmt.
Oft bestehen Komplexe mit wärmeliebenden Krautsaumgesellschaften und Magerrasen, die ebenfalls besonders geschützt sind (vgl. 3.2).
Zu den Gebüschen trockenwarmer Standorte zählen auch Kriechweiden- und Sanddorngebüsche des Küstenbereiches und Wacholdergebüsche (z.B. Kriechweiden-Wacholdergebüsche der Seeabsenkungsterrassen). Es bestehen Übergänge zu den Zwergstrauch- und Wacholderheiden (vgl. 3.1).
4.3 Naturnahe Feldgehölze
Feldgehölze sind kleinflächige, nicht lineare (vgl. Feldhecken) Baum- und Strauchbestände (bis zu einer Fläche von 2 ha) in der freien Landschaft. Sie sind in der Regel an mindestens drei Seiten von Landwirtschaftsflächen umgeben. Feldgehölze können Überreste eines früheren, längst gerodeten Waldkomplexes sein oder auf einer nicht mehr genutzten Fläche durch natürlichen Aufwuchs oder Pflanzung entstanden sein.
Typische Feldgehölze sind im Inneren waldähnlich, sie besitzen einen ausgeprägten, stabilen Außenmantel aus kurzen, tiefbeasteten Randgehölzen. Geschützte Feldgehölze sind aber auch kleine Baum- und/oder Strauchgruppen in der freien Landschaft ohne diese idealtypische Ausprägung, soweit sie überwiegend aus standortheimischen Gehölzarten bestehen.
Gehölzpflanzungen sind nicht geschützte Biotope, wenn sie einen höheren Anteil (> 50 Prozent) nichtheimischer Baumund Straucharten (z.B. Hybridpappeln, Fichten) enthalten.
Mindestgröße: 100 m2
Typische Merkmale der Vegetation:
Kennzeichnende Baumarten sind u. a. Stiel-Eiche, Hainbuche, Sand-Birke, Zitter-Pappel, Eberesche, Ulmen-, Linden-, Ahorn- und Wildobstarten, in feuchteren Lagen auch Schwarz-Erle, Moor-Birke, Esche und Weiden (vgl. 4.1). Prägende Sträucher sind u. a. Weißdorn-, Rosen- und Brombeerarten, Hasel, Wald-Geißblatt, Schwarzer Holunder, Hopfen, Pfaffenhütchen und Kreuzdorn.
4.4 Naturnahe Feldhecken
Feldhecken sind lineare, vorwiegend aus Sträuchern aufgebaute Gehölze in der freien Landschaft. Sie können von Bäumen durchsetzt (sog. Überhälter) oder auch dominiert werden (Baumhecken). Teil der Feldhecke sind auch die krautigen Säume und am Rande der Hecke abgelagerte Lesesteinhaufen.
Die westmecklenburgischen Knicks (Wallhecken) sind eine Sonderform der Feldhecken. Kennzeichnend ist ein ca. 1 m hoher und ca. 2,5 m breiter Wall aus Erde und Steinen, auf dem Gehölze stocken, die ca. alle zehn Jahre "auf den Stock gesetzt" bzw. umgeknickt werden. Bei Reddern (Doppelknicks) verläuft links und rechts eines schmalen Feldweges jeweils ein Knick.
Die traditionelle Pflege bleibt im bisher zulässigen Umfang vom gesetzlichen Biotopschutz unberührt.
Keine geschützten Biotope sind monotone, strukturarme Windschutzpflanzungen. In der Regel sind sie durch einen dominierenden Anteil an nichtheimischen Baum- und Straucharten gekennzeichnet. Typisch ist weiterhin auch die Verwendung schnellwachsender Gehölzarten (z.B. Pappelhybriden), so dass die typischen standortheimischen Straucharten weitgehend fehlen.
Mindestlänge: 50 m
Liegen Feldheckenabschnitte maximal 5 m voneinander entfernt, so werden die Längen der einzelnen Abschnitte für die Beurteilung der Mindestlänge zusammengefasst.
Typische Merkmale der Vegetation:
Typische Feldheckenpflanzen sind z.B. Schlehe, Weißdorn, Hasel, Pfaffenhütchen, Schwarzer Holunder, Gewöhnlicher Schneeball, Hecken-Rose und Brombeerarten. Als Überhälter kommen z.B. Ahornarten, Hainbuche, Stiel-Eiche, Wildobstarten und Kiefer vor. Die vorgelagerten Säume bestehen aus meist nitrophilen Staudenfluren.
____________
1) "Biotope": Ahgrenzbare Lebensräume von Pflanzen- und Tiergemeinschaften
2) "Biotoptypen- sind abstrakte Einheiten gleichartiger Biotope mit weitgehend einheitlichen Bedingungen.
3) Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet
| Definitionen der gesetzlich geschützten Geotope | Anlage 3 (zu § 20 Abs. 2) |
Vorbemerkungen
- Geotope stellen erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur dar, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde oder des früheren Lebens auf der Erde vermitteln. Geotope umfassen Gesteine, Fossilien, Landschaftsformen und Quellbildungen. Geotope gleicher Genese werden zu Geotoptypen zusammengefasst.
- Gesetzlich geschützt sind diejenigen Geotope, die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit oder Eigenart auszeichnen. Für Wissenschaft, Forschung und Lehre sind sie Dokumente von besonderem Wert. Sie lassen sich aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften von der Umgebung klar abgrenzen.
- Zwischen Geotopen und Biotopen bestehen enge Beziehungen, Geotopschutz und Biotopschutz überlagern sich vielfach. Deshalb unterstehen die folgenden Geotope vorrangig dem gesetzlichen Biotopschutz und werden bereits in Anlage 2 zu § 20 Absatz 1 geführt: Sölle, naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, aufgelassene Kreidebrüche, Fels- und Steilküsten, Strandwälle, Dünen, marine Block- und Steingründe, Windwattflächen sowie Boddengewässer mit Verlandungsbereichen. Die unter den folgenden Nummern beschriebenen Geotope unterliegen dagegen ausschließlich (vgl. aber Nummer 3.1) dem gesetzlichen Geotopschutz.
1 Glaziale Bildungen
1.1 Findlinge
Ein Findling stellt einen vom Inlandeis transportierten Gesteinsblock dar. Findlinge aus kristallinem und metamorphem Gestein sind gesetzlich geschützt, wenn sie folgende Mindestgrößen entsprechend der naturbedingten Verteilung erreichen:
- nördlich der Endmoräne des Pommerschen Stadiums der Weichseleiszeit (Linie Krakow-Waren-Neustrelitz-Feldberg) und östlich der Linie Rostock-Güstrow: Mindestvolumen von 10 m3. Dies erfordert zumindest eine Länge von 3,5 m.
- zwischen der Endmoräne des Frankfurter Stadiums (Linie Zarrentin-Schwerin-Parchim-Wredenhagen) und der Endmoräne des Pommerschen Stadiums einerseits sowie nördlich der Pommerschen Endmoräne und westlich der Linie Rostock-Güstrow andererseits: Mindestvolumen von 5 m3. Dies erfordert zumindest eine Länge von 2,5 m.
- im Altmoränengebiet Südwestmecklenburgs (südlich der Linie Zarrentin-Schwerin-Parchim): Mindestvolumen von 1 m3. Dies erfordert zumindest eine Länge von 1,5 m.
Findlinge aus Sedimentgesteinen (Kalke, Sandsteine, Quarzfite) über 1 m Länge sind generell geschützt.
Der Schutz von Findlingen schließt deren Umlagerung im Einzelfall nicht aus.
1.2 Blockpackungen
Blockpackungen stellen natürliche Anreicherungen größerer Geschiebe am Rand des Inlandeises dar. In Mecklenburg-Vorpommern sind noch 13 Vorkommen erhalten und gesetzlich geschützt: drei nahe von Feldberg, je eine bei den Ortschaften Dutzow, Zarrentin, Mankmoos, Marienhof bei Krakow am See, Langhagen, Blücherhof, Lalendorf, Kargow, Freidorf und Saßnitz.
Die Entfernung von Blöcken und Steinen ist untersagt.
1.3 Gesteinsschollen
Gesteinsschollen im glazialgeologischen Sinne stellen Gesteinskörper aus erdgeschichtlich bedeutsamen Schichtenfolgen dar, die durch das Inlandeis vom Untergrund abgelöst und verfrachtet wurden. Lagerstättenabbau ist untersagt. Geringfügiges Abschürfen für wissenschaftliche Zwecke ist gestattet.
1.4 Oser
Oser sind wichtige Zeugen für Spalten des Inlandeises. Das Land Mecklenburg-Vorpommern verfügt aufgrund seiner Lage im jüngsten Gletscherverbreitungsgebiet über einen in Deutschland einmalig vielfältigen Bestand an Osern, die deshalb gesetzlich geschützt sind. Sie treten als bahndammähnliche Hügel und Hügelketten von geringer Breite (30 bis ca. 150 m) und beträchtlicher Länge (in Ausnahmefällen bis 30 km) in Grundmoränengebieten auf. In der Regel heben sie sich von den benachbarten Flächen durch ihre Höhe ab. Flankierende Rinnen (Osgräben) sind Bestandteil des Geotops.
Der Abbau von Kiessand sowie Veränderungen am Relief sind untersagt. Traditionelle landwirtschaftliche Nutzung gilt nicht als nachhaltige Beeinträchtigung.
2 Fluviatile Bildungen
2.1 Trockentäler
Trockentäler sind Oberflächenformen, die am Ende einer Vereisung im Vorfeld des Inlandeises entstanden. Infolge der durch Dauerfrost im Boden gehemmten Versickerung schnitt das oberflächlich abfließende Schmelzwasser Erosionskerben ein, die nach dem Auftauen trocken fielen. Als fossile Oberflächenformen sind die Trockentäler von erdgeschichtlicher Bedeutung und deshalb gesetzlich geschützt.
2.2 Kalktuff-Vorkommen
Kalktuff-Vorkommen entstehen dort, wo Quellen aus kalkreichen Schichten austreten. Der Kalk umkrustet die Vegetation und bildet Bänke von hartem, porösem Kalktuff. Als kleinräumige Geotope von zumeist geringer Standfestigkeit sind sie gesetzlich geschützt.
3 Windablagerungen
3.1 Offene Binnendünen
Offene Binnendünen treten in Heidegebieten als vegetationsarme bis vegetationsfreie, aus Fein- bis Mittelsanden bestehende Höhenzüge auf und sind auch als Biotop gesetzlich geschützt. Die nahezu vegetationsfreien Binnendünen sind im Binnenland der einzige Geotoptyp, an dem gegenwärtig Umlagerungen durch Wind ohne anthropogene Beeinflussung stattfinden.
3.2 Kliffranddünen
Kliffranddünen sind gesetzlich geschützt, wenn sie mindestens eine Höhe von 1 m aufweisen. Sie bilden sich auf höheren Steilufern der Ostseeküste, sofern diese von fein- bis mittelkörnigen Sanden aufgebaut werden. Bei auflandigen Winden werden die Sande aus den Steilufern auf den Kliffrand geweht und mit ständig wechselnder Oberflächenform abgelagert.
4 Marine Bildungen
4.1 Kliffs
Kliffs sind Steilküsten, die zumindest zeitweise dem direkten Einfluss des Meerwassers unterliegen (aktive Kliffs) oder durch natürliche Vorgänge dauerhaft vom Meerwasser getrennt wurden (fossile Kliffs).
Aktive Kliffs sind als Geotope nur dann gesetzlich geschützt, wenn an ihnen
- eine aus mehreren Schichten bestehende stratigraphische Abfolge,
- Vorkommen voreiszeitlicher oder zwischeneiszeitlicher Sedimente oder
- besondere Formen der Lagerungsstörungen
aufgeschlossen sind.
Fossile Kliffs sind durch eine den gesamten Ostseeraum betreffende Meeresausbreitung im Zeitraum 5.000 bis 1.000 Jahre v. Chr. (Litorina-Transgression) entstanden. Sie blieben dadurch erhalten, dass sich durch Prozesse des Küstenausgleichs Strandwälle vorlagerten (auf dem Darß, auf Mönchgut und auf Usedom).
Als Zeugen für den früheren Verlauf der Ostseeküste sind sie gesetzlich geschützt.
4.2 Haken
Marine Haken bilden sich im Strömungslee von Abtragungsküsten durch Sandverlagerung. Durch die ständig in Umbildung begriffenen, vegetationsfreien Haken werden die Auswirkungen der am Meeresgrund ablaufenden Umlagerungsprozesse auch oberhalb des Meeresspiegels sichtbar.
Eingriffe in die Haken, die die Küstenausgleichsprozesse stören, sind untersagt.
Erläuterung
Aus der Summe aller erdgeschichtlichen, vor allem mit der Eiszeit verbundenen Erscheinungsformen an der Landesoberfläche sind neben den Schutzgründen "Landschaftliche Schönheit" oder "Naturschutz" einzelne Zeugen der Eiszeit und Nacheiszeit als Geotope insbesondere deshalb geschützt, weil sie als beispielhafte oder außergewöhnliche unbelebte Naturerscheinungen im Falle der Beeinträchtigung oder Beseitigung nicht reversibel sind. Das Land Mecklenburg-Vorpommern nimmt den größten deutschen Anteil am jüngsten Gletscherverbreitungsgebiet ein und verfügt aufgrund dessen über besonders typisch ausgebildete Hinterlassenschaften der Gletscher. Ihr Schutz ist deshalb eine Verpflichtung über die Landesgrenzen hinaus.
Geotope sind häufig auch als Biotope erfasst oder sie treten gemeinsam in einem Schutzgebiet auf. Die über die bereits vorhandenen Schutzgebiete hinausgehende Flächeninanspruchnahme durch Geotope im Land Mecklenburg-Vorpommern liegt deutlich unter 1 Prozent der Landesfläche und betrifft vor allem die für das Land besonders charakteristischen Geotoptypen Findlinge (Naturdenkmale von punktförmiger Ausdehnung) und Oser (schmale, langgestreckte Schmelzwasserbildungen).
Durch Sand- und Kiesabbau wurden in der Vergangenheit die Oser in ihrer äußeren Form zum Teil beeinträchtigt oder abgebaut und einige große Findlinge wurden zu Bausteinen verarbeitet. Ebenso sind die früher zahlreichen Blockpackungen sowie Gesteinsschollen als Lagerstätten von lokaler Bedeutung (vor allem Tone des Juras und Tertiärs, Kalk der Kreide, warmzeitliche Bildungen) dezimiert worden. Ihr gesetzlicher Schutz soll weitere Verluste verhindern.
Um den Schutz einzelner Findlinge zu gewährleisten, ist im Einzelfall eine Umsetzung vor Ort oder in eine öffentliche Anlage, einen Museumsgarten oder einen Findlingsgarten zugelassen oder ratsam.
Trockentäler sind bisher außerhalb von bestehenden Schutzgebieten nicht bekannt. Ihr Schutz bezieht sich auf die Erhaltung der Form und schließt land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht aus. Dagegen sind die Kalktuffe aufgrund ihrer besonderen Form und wegen ihrer geringen Stabilität vor jeglicher Beeinträchtigung geschützt. Dies gilt auch für Kalktuffe am Kliff von Jasmund, die durch die Brandung umgelagert wurden. Die Kalktuff-Vorkommen haben etwa die Größe eines Naturdenkmals.
Von den offenen Binnendünen als Biotope heben sich die Wanderdünen als Geotope ab, da ihre Entwicklung nicht abgeschlossen ist. Sie beschränken sich auf kleine Areale der Terrassensande im Urstromtal der Elbe sowie in der Ückermünder Heide.
Kliffranddünen sind der ständigen Veränderung unterworfen, da sie vom Wind abhängig sind und durch Küstenrückgang auf natürliche Weise beeinträchtigt werden. Deshalb ist ihr gesetzlicher Schutz auf Standorte beschränkt, wo sie günstige Erhaltungsbedingungen vorfinden. Dies ist nur an Teilen der Kliffs von Fischland, Hiddensee, Wittow, Mönchgut und Usedom gegeben. Kliffranddünen überlagern häufig einen charakteristischen Bodenhorizont (Podsol-Profil).
Da die Fels- und Steilküsten als Biotope weitgehend geschützt sind, bedarf der Geotop Aktives Kliff des gesetzlichen Schutzes nach § 20 Absatz 2 nur dann, wenn die geologischen Verhältnisse von besonderer Bedeutung sind. Sichtbarkeit und gelegentliche Zugänglichkeit für wissenschaftliche Zwecke sind Ziele des Geotopschutzes für erdgeschichtlich wichtige Kliffabschnitte ebenso wie bei vergleichbaren Verhältnissen im Binnenland.
Die fossilen Kliffs sind bewachsen und unterliegen keiner natürlichen Veränderung. In der Regel sind sie Teile von Schutzgebieten. Das gilt auch für die marinen Haken.
 | ENDE |  |
...
X
⍂
↑
↓
