| zurück |  |
Regel II-1/2 Begriffsbestimmungen Erl.
(MSC.170(79); MSC.194(80); MSC.268(85); MSC.290(87); MSC 392(95), MSC.421(98))
Im Sinne dieses Kapitels haben, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
1 "Unterteilungslänge" (Ls) des Schiffes ist die projizierte größte Länge des Schiffes auf Mallkante in Höhe oder unterhalb des oder der Decks, die das Ausmaß einer Flutung des Schiffes der Höhe nach begrenzen, wenn das Schiff bis zum größten Unterteilungstiefgang eingetaucht ist.
2 Der Ausdruck "mittschiffs" bezeichnet die Mitte der Länge (L).
3 "Hinterer Endpunkt" ist die hintere Begrenzung der Unterteilungslänge.
4 "Vorderer Endpunkt" ist die vordere Begrenzung der Unterteilungslänge.
5 "Länge" (L) ist die Länge nach der Begriffsbestimmung in dem jeweils in Kraft befindlichen Internationalen Freibord-Übereinkommen.
6 "Freiborddeck" ist das Deck nach der Begriffsbestimmung in dem jeweils in Kraft befindlichen Internationalen Freibord-Übereinkommen.
7 "Vorderes Lot" ist das vordere Lot nach der Begriffsbestimmung in dem jeweils in Kraft befindlichen Internationalen Freibord-Übereinkommen.
8 "Breite" (B) ist die größte in Höhe oder unterhalb des größten Unterteilungstiefgangs auf Mallkante gemessene Breite des Schiffes.
9 "Tiefgang" (d) ist der senkrechte Abstand von der Kiellinie,
- mittschiffs gemessen bei Schiffen, die unter Regel II-1/1.1.1.1 fallen, und
- von dem Punkt auf der Mitte der Unterteilungslänge (Ls) gemessen bei Schiffen, die nicht unter Regel II-1/1.1.1.1 fallen, sondern am oder nach dem 1. Januar 2009 gebaut sind,
bis zu der betreffenden Wasserlinie.
10 "Größter Unterteilungstiefgang" (ds) ist das Eintauchen des Schiffes bis zur Sommerlademarke.
11 "Tiefgang im leichtesten Zustand des im Dienst befindlichen Schiffes" (dl) ist der Tiefgang des im Dienst befindlichen Schiffes, der dem leichtesten zu erwartenden Ladezustand des Schiffes unter Berücksichtigung der dazugehörigen Tankfüllungen einschließlich der Ballastmenge entspricht, die aus Gründen der Stabilität und/oder wegen des Eintauchens erforderlich ist. Bei Fahrgastschiffen soll die höchstzulässige Anzahl an Fahrgästen sowie die vollständige Besatzung an Bord berücksichtigt werden.
12 "Unterteilungstiefgang in teilweise beladenem Zustand" (dp) ist der Tiefgang im leichtesten Zustand des im Dienst befindlichen Schiffes plus 60 vom Hundert der Differenz zwischen dem Tiefgang im leichtesten Zustand des im Dienst befindlichen Schiffes und dem größten Unterteilungstiefgang.
13 "Trimm" ist die Differenz zwischen dem Tiefgang vorne und dem Tiefgang hinten, wobei der Tiefgang jeweils
- am vorderen und am hinteren Lot nach der Begriffsbestimmung in dem jeweils in Kraft befindlichen Internationalen Freibord-Übereinkommen gemessen wird bei Schiffen, die unter Regel II-1/1.1.1.1 fallen, und
- am vorderen und am hinteren Endpunkt gemessen wird bei Schiffen, die nicht unter Regel II-1/1.1.1.1 fallen, sondern am oder nach dem 1. Januar 2009 gebaut sind,
und zwar unter Vernachlässigung eines etwaigen Kielfalls.
14 Interp.k "Flutbarkeit" (1/4) eines Raumes ist der Anteil des eingetauchten Inhalts dieses Raumes, der durch Wasser eingenommen werden kann.
15 "Maschinenräume" sind die Räume zwischen den wasserdichten Begrenzungen eines Raumes, in denen Haupt- und Hilfsantriebsmaschinen, insbesondere Kessel, Generatoren und elektrische Motoren enthalten sind, die hauptsächlich für den Antrieb vorgesehen sind. Bei ungewöhnlichen Anordnungen kann die Verwaltung die Begrenzungen der Maschinenräume festlegen.
16 "Wetterdicht" bedeutet, dass unter allen vorkommenden Seegangsbedingungen kein Wasser in das Schiff eindringt.
17 "Wasserdicht" bedeutet, dass ein Bauteil Abmessungen und Konstruktionsmerkmale aufweist, die bei jedem Wasserstand, mit dessen Eintreten im unbeschädigten und im beschädigten Zustand des Schiffes zu rechnen ist, den Durchtritt von Wasser in jeder Richtung verhindern können. Für den beschädigten Zustand des Schiffes ist der Wasserdruck der ungünstigsten Gleichgewichtsschwimmlage, einschließlich bei Zwischenzuständen der Flutung, zu Grunde zu legen.
18 "Entwurfsdruck" ist der hydrostatische Druck, den jedes Bauteil und jede Vorrichtung, die bei den Stabilitätsberechnungen für den unbeschädigten und für den beschädigten Zustand des Schiffes als wasserdicht angenommen werden, entwurfsmäßig aushalten müssen.
19 "Schottendeck" ist bei einem Fahrgastschiff
- das oberste Deck, bis zu dem die Hauptschotte und die Außenhaut des Schiffes wasserdicht geführt sind, bei Schiffen, die unter Regel II-1/1.1.1.1 fallen, und
- das oberste Deck entlang der Unterteilungslänge (Ls), bis zu dem die Hauptschotte und die Außenhaut des Schiffes wasserdicht geführt sind, sowie das unterste Deck, von dem aus die Evakuierung von Fahrgästen und Besatzungsmitgliedern in keinem Stadium einer Flutung im Fall von Schäden im Sinne der Regel II/8 und des Teiles B-2 durch Wasser behindert werden kann, bei Schiffen, die nicht unter Regel II-1/1.1.1.1 fallen, sondern am oder nach dem 1. Januar 2009 gebaut sind.
Das Schottendeck kann ein gestuftes Deck sein. Bei einem Frachtschiff, das nicht unter Regel II-1/1.1.1.1 fällt, sondern am oder nach dem 1. Januar 2009 gebaut ist, kann das Freiborddeck als Schottendeck gelten.
20 Interpr. 1573 "Tragfähigkeit" ist die in Tonnen ausgedrückte Differenz zwischen der Verdrängung eines Schiffes in Wasser mit einem spezifischen Gewicht von 1,025 bei einem Tiefgang, der dem erteilten Sommerfreibord entspricht, und dem Eigengewicht des Schiffes.
21 Interpr.1539/1 "Eigengewicht" ist die in Tonnen ausgedrückte Verdrängung eines Schiffes ohne Ladung, Brennstoff, Schmieröl, Ballastwasser, Frischwasser und Speisewasser in Tanks, Verbrauchsstoffe, Fahrgäste und Besatzungsmitglieder sowie deren Habe.
22 "Öltankschiff" ist ein Öltankschiff nach der Begriffsbestimmung in Anlage I Regel 1 des Protokolls von 1978 zu dem Internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe.
23 "Ro-Ro-Fahrgastschiff" ist ein Fahrgastschiff mit Ro-Ro-Räumen oder Sonderräumen nach den Begriffsbestimmungen in Regel II-2/3.
24 "Massengutschiff" ist ein Massengutschiff nach der Begriffsbestimmung in Regel XII/1.1.
25 "Kiellinie" ist eine Linie, die parallel zur Neigung des Kiels verläuft und mittschiffs einen der nachstehend genannten Punkte schneidet:
- Bei Schiffen mit einer Außenhaut aus Metall schneidet sie die Oberkante des Kiels auf Höhe der Mittellinie oder der Schnittlinie der Innenseite der Außenbeplattung mit dem Kiel, falls ein Balkenkiel unterhalb dieser Linie angeordnet ist.
- Bei Holz- und Kompositschiffen wird der Abstand von der Unterkante der Kielsponung ab gemessen. Bei hohlem Verlauf der Schiffsform im unteren Teil des Hauptspants oder bei verstärkten Kielspanten wird der Abstand von dem Punkt aus gemessen, an dem die Verlängerung des geraden Bodenteils mittschiffs die Mittellinie schneidet.
26 "IS Code 2008" bezeichnet den Internationalen Code über Intaktstabilität von 2008, der aus einer Einleitung, einem Teil A (der verbindlichen Charakter hat) und einem Teil B (der empfehlenden Charakter hat) besteht, in der durch Entschließung MSC.267(85) beschlossenen Fassung, sofern
- Änderungen der Einleitung und des Teils A des Codes nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen und in Kraft gesetzt worden und wirksam geworden sind und
- Änderungen des Teils B des Codes vom Schiffssicherheitsausschuss nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung beschlossen worden sind.
27 "Zielgerichtete Schiffbaunormen für Massengutschiffe und Öltankschiffe" sind die vom Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.287(87) angenommenen Internationalen zielgerichteten Schiffbaunormen für Massengutschiffe und Öltankschiffe in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung, sofern diese Änderungen nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen, in Kraft gesetzt und wirksam werden.
28 "IGF-Code" ist der vom Schiffssicherheitsausschuss der Organisation mit Entschließung MSC.391(95) angenommene Internationale Code für die Sicherheit von Schiffen, die Gase oder andere Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt verwenden, in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung, sofern diese Änderungen nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen, in Kraft gesetzt und wirksam werden.
29 "Brennstoff mit niedrigem Flammpunkt" ist ein gasförmiger oder flüssiger Brennstoff mit einem niedrigeren Flammpunkt als nach Regel II-2/4.2.1.1 gestattet.
Regel II-1/3 Begriffsbestimmungen in Bezug auf die Teile C, D und E
(MSC.1518)
Im Sinne der Teile C, D und E haben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
1 "Steuerungssystem der Ruderanlage" ist die Ausrüstung, durch die Befehle von der Kommandobrücke zu den Kraftantriebseinheiten der Ruderanlage übertragen werden. Die Steuerungssysteme der Ruderanlage umfassen Geber, Stellglied, hydraulische Steuerpumpen und die dazugehörigen Motoren, motorbetriebene Regler, Leitungen und die Verkabelung.
2 Die "Hauptruderanlage" besteht aus maschinellen Einrichtungen, den Ruderantrieben, gegebenenfalls den Kraftantrieben für die Ruderanlage sowie der ergänzenden Ausrüstung und den Bauteilen zur Einleitung des Drehmoments am Ruderschaft (zum Beispiel Ruderpinne oder -quadrant), die zum Ruderlegen unter normalen Betriebsbedingungen erforderlich sind.
3 "Kraftantrieb für die Ruderanlage" ist
- im Fall einer elektrischen Ruderanlage ein Elektromotor und die dazugehörige elektrische Ausrüstung;
- im Fall einer elektrohydraulischen Ruderanlage ein Elektromotor und die dazugehörige elektrische Ausrüstung sowie die zugehörige Pumpe;
- im Fall sonstiger hydraulischer Ruderanlagen eine Antriebsmaschine und die zugehörige Pumpe.
4 "Hilfsruderanlage" ist die Einrichtung - mit Ausnahme aller Teile der Hauptruderanlage -, die bei Ausfall der Hauptruderanlage zum Ruderlegen dient, jedoch ausschließlich der Ruderpinne, des Ruderquadranten oder von Bauteilen, die demselben Zweck dienen.
5 "Normale Betriebs- und Lebensbedingungen" sind Bedingungen, unter denen das Schiff als Ganzes, seine Maschinen und Versorgungs- und Hilfseinrichtungen, welche Antrieb, Steuerfähigkeit, sichere Navigation, Brandschutz und den Schutz gegen Wassereinbruch sowie die Verständigung und Signalgebung an Bord und nach draußen gewährleisten, die Fluchtwege und die Rettungsbootwinden sowie die vorgesehenen Einrichtungen für angemessene Wohnlichkeit an Bord betriebsfähig sind und bestimmungsgemäß arbeiten.
6 "Notlage" ist eine Lage, in der Einrichtungen, die für die normalen Betriebs- und Lebensbedingungen erforderlich sind, wegen des Ausfalls der Hauptstromquelle nicht betriebsfähig sind.
7 "Hauptstromquelle" ist eine Stromquelle, die der Speisung der Hauptschalttafel und der anschließenden Verteilung an alle für die Aufrechterhaltung normaler Betriebs- und Lebensbedingungen des Schiffes erforderlichen Einrichtungen dient.
8 "Totalausfall des Schiffes" ist der Zustand, bei dem die Hauptantriebsanlage, die Kessel und die Hilfseinrichtungen aufgrund fehlender elektrischer Energie nicht in Betrieb sind.
9 "Hauptgeneratorenstation" ist der Raum, in dem sich die Hauptstromquelle befindet.
10 "Hauptschalttafel" bezeichnet eine Schalttafel, die unmittelbar von der Hauptstromquelle gespeist wird und elektrische Energie an die Versorgungseinrichtungen des Schiffes verteilen soll.
11 "Notschalttafel" ist eine Schalttafel, die bei Ausfall der Hauptstromversorgung unmittelbar von der Notstromquelle oder der zeitweiligen Notstromquelle gespeist wird und elektrische Energie an die Noteinrichtungen verteilen soll.
12 "Notstromquelle" ist eine Stromquelle, die bei Ausfall der Versorgung durch die Hauptstromquelle die Notschalttafel speisen soll.
13 "Kraftantriebssystem" ist die hydraulische Einrichtung, die dazu bestimmt ist, Energie zur Drehung des Ruderschafts bereitzustellen, einschließlich einer oder mehrerer Kraftantriebseinheiten für die Ruderanlage, zusammen mit den zugehörigen Leitungen und Armaturen, sowie ein Ruderantrieb. Die Kraftantriebssysteme können gemeinsame mechanische Bauteile haben (d. h. Ruderpinne, -quadrant und -schaft) oder Bauteile, die demselben Zweck dienen.
14 "Höchste Dienstgeschwindigkeit voraus" ist die größte Dauergeschwindigkeit, für die das Schiff bei Fahrt auf See mit dem größten seegehenden Tiefgang ausgelegt ist.
15 "Höchste Rückwärtsgeschwindigkeit" ist die Geschwindigkeit, die das Schiff erwartungsgemäß bei der größten Rückwärtsleistung, für die es ausgelegt ist, mit dem größten seegehenden Tiefgang erreichen kann.
16 "Maschinenräume" sind alle Maschinenräume der Gruppe A und alle anderen Räume, die Antriebsanlagen, Kessel, Ölaufbereitungsanlagen, Dampf- und Verbrennungskraftmaschinen, Generatoren und größere elektrische Maschinen oder Anlagen, Ölübernahmestellen sowie Zentraleinheiten der Kühl-, Stabilisierungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen enthalten, und ähnliche Räume sowie die Schächte zu diesen Räumen.
17 "Maschinenräume der Gruppe A" sind Räume - sowie die Schächte zu diesen Räumen -, die Folgendes enthalten:
- Verbrennungskraftmaschinen für den Hauptantrieb,
- Verbrennungskraftmaschinen für andere Zwecke als den Hauptantrieb, wenn diese Maschinen eine Gesamtleistung von mindestens 375 Kilowatt haben, oder
- einen ölbefeuerten Kessel oder eine Ölaufbereitungsanlage.
18 "Kontrollstationen" sind Räume, in denen die Schiffsfunkanlage, die wichtigsten Navigationseinrichtungen, die Notstromquelle oder die zentrale Feueranzeige- oder Feuerüberwachungsanlage untergebracht sind.
19 "Chemikalientankschiff" ist ein Frachtschiff, das zum Zweck der Beförderung flüssiger Stoffe als Massengut gebaut oder umgebaut ist und eingesetzt wird,
- die in Kapitel 17 des vom Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.4(48) angenommenen Internationalen Codes für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut, im Folgenden als "Internationaler Chemikalientankschiff-Code" bezeichnet, in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung aufgeführt sind beziehungsweise
- die in Kapitel VI des von der Versammlung der Organisation mit Entschließung A.212(VII) angenommenen Codes für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut, im Folgenden als "Chemikalientankschiff-Code" bezeichnet, in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung aufgeführt sind.
20 "Gastankschiff" ist ein Frachtschiff, das zum Zweck der Beförderung verflüssigter Gase oder sonstiger Stoffe als Massengut gebaut oder umgebaut ist und eingesetzt wird,
- die in Kapitel 19 des vom Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.5(48) angenommenen Internationalen Codes für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung verflüssigter Gase als Massengut, im Folgenden als "Internationaler Gastankschiff-Code" bezeichnet, in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung aufgeführt sind beziehungsweise
- die in Kapitel XIX des von der Organisation mit Entschließung A.328(IX) angenommenen Codes für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung verflüssigter Gase als Massengut, im Folgenden als "Gastankschiff-Code" bezeichnet, in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung aufgeführt sind.
Teil A-1
Bauweise der Schiffe
(MSC.134(76); (MSC.151(78); (MSC. 194(80), MSC 216(82); MSC.256(84), MSC.338(91))
Regel II-1/3-1 Bauliche, mechanische und elektrische Vorschriften für Schiffe
Zusätzlich zu den an anderer Stelle in diesen Regeln enthaltenen Vorschriften müssen Schiffe in Übereinstimmung mit den baulichen, mechanischen und elektrischen Vorschriften einer von der Verwaltung nach Regel XI-1/1 anerkannten Klassifikationsgesellschaft oder mit geltenden innerstaatlichen Normen der Verwaltung, die ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleisten, entworfen, gebaut und instand gehalten werden.
Regel II-1/3-2 Schutzanstriche von eigens für die Aufnahme von Seewasser vorgesehenen Ballasttanks auf Schiffen aller Art sowie von Doppelhüllenräumen von Massengutschiffen Interpr.1539//1
(MSC. 216(82))
1 Die Absätze 2 und 4 finden auf Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von mindestens 500 Anwendung,
- für die der Bauvertrag am oder nach dem 1. Juli 2008 geschlossen wird,
- falls kein Bauvertrag vorliegt, deren Kiel am oder nach dem 1. Januar 2009 gelegt wird oder die sich zu diesem Zeitpunkt in einem entsprechenden Bauzustand befinden oder
- die am oder nach dem 1. Juli 2012 abgeliefert werden.
2 Interpr.2(10) Alle eigens für die Aufnahme von Seewasser vorgesehenen Ballasttanks auf Schiffen aller Art sowie alle Doppelhüllenräume von Massengutschiffen von 150 m Länge und darüber müssen beim Bau mit einem Schutzanstrich versehen werden, welcher der vom Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.215(82) angenommenen "Leistungsnorm für Schutzanstriche für eigens für die Aufnahme von Seewasser vorgesehene Ballasttanks auf Schiffen aller Art sowie von Doppelhüllenräumen von Massengutschiffen" in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung entspricht, sofern diese Änderungen nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen, in Kraft gesetzt und wirksam werden.
3 Alle eigens für die Aufnahme von Seewasser vorgesehenen Ballasttanks auf am oder nach dem 1. Juli 1998 gebauten Öltankschiffen und Massengutschiffen, auf die Absatz 2 nicht anwendbar ist, müssen der mit Entschließung MSC.47(66) angenommenen Regel II-1/3-2 entsprechen.
4 Interpr.2(10) Die Instandhaltung des Schutzanstrichsystems erfolgt im Rahmen des Instandhaltungsplans für das gesamte Schiff. Die Wirksamkeit des Schutzanstrichsystems wird während der Einsatzzeit eines Schiffes von der Verwaltung oder einer von der Verwaltung anerkannten Stelle auf der Grundlage der von der Organisation erarbeiteten Richtlinien überprüft.
Regel II-1/3-3 Sicherer Zugang zum Bugbereich von Tankschiffen
1 Im Sinne dieser Regel und der Regel 3-4 umfasst der Ausdruck "Tankschiffe" Öltankschiffe nach der Begriffsbestimmung in Regel II-1/2, Chemikalientankschiffe nach der Begriffsbestimmung in Regel VII/8.2 und Gastankschiffe nach der Begriffsbestimmung in Regel VII/11.2.
2 Jedes Tankschiff muss mit Einrichtungen versehen sein, die der Besatzung auch unter Schlechtwetterbedingungen einen sicheren Zugang zum Bugbereich ermöglichen. Diese Zugangsmöglichkeiten müssen von der Verwaltung auf der Grundlage der von der Organisation erarbeiteten Richtlinien zugelassen werden.
Regel II-1/3-4 Notschleppvorrichtungen und Notschleppverfahren *
(MSC.256(84))
1 Notschleppvorrichtungen an Tankschiffen
1.1 Auf jedem Tankschiff mit mindestens 20.000 Tonnen Tragfähigkeit müssen an beiden Enden Notschleppvorrichtungen angebracht sein.
1.2 Bei am oder nach dem 1. Juli 2002 gebauten Tankschiffen
- müssen die Vorrichtungen jederzeit auch bei Ausfall der Haupt-Energieversorgung auf dem zu schleppenden Schiff schnell ausgebracht und leicht mit dem schleppenden Schiff verbunden werden können. Wenigstens eine der Notschleppvorrichtungen muss so hergerichtet sein, dass sie für ein schnelles Ausbringen bereitsteht; und
- müssen die Notschleppvorrichtungen an beiden Enden eine ausreichende Festigkeit aufweisen, wobei die Größe und die Tragfähigkeit des Schiffes sowie die bei schlechten Wetterbedingungen zu erwartenden Kräfte zu berücksichtigen sind. Der Entwurf, die Bauart und die Prüfung der Baumuster der Notschleppvorrichtungen müssen auf der Grundlage der von der Organisation erarbeiteten Richtlinien von der Verwaltung zugelassen sein.
1.3 Bei vor dem 1. Juli 2002 gebauten Tankschiffen müssen Entwurf und Bauart der Notschleppvorrichtungen auf der Grundlage der von der Organisation erarbeiteten Richtlinien von der Verwaltung zugelassen sein.
2 Notschleppverfahren an Bord von Schiffen
2.1 Dieser Absatz findet Anwendung auf
- alle Fahrgastschiffe spätestens ab dem 1. Januar 2010;
- am oder nach dem 1. Januar 2010 gebaute Frachtschiffe;
- vor dem 1. Januar 2010 gebaute Frachtschiffe spätestens ab dem 1. Januar 2012.
2.2 Die Schiffe müssen über ein schiffsspezifisches Notschleppverfahren verfügen. Dieses Verfahren ist für den Einsatz in Notfällen an Bord mitzuführen und muss auf den an Bord vorhandenen Vorrichtungen und zur Verfügung stehenden Ausrüstungsgegenständen beruhen.
2.3 Das Verfahren muss Folgendes beinhalten:
- Zeichnungen des Vorder- und Achterdecks, welche die möglichen Notschleppvorrichtungen darstellen;
- ein Verzeichnis der Ausrüstungsgegenstände an Bord, die zu Notschleppzwecken verwendet werden können;
- Kommunikationsmittel und -verfahren; und
- Musterbeispiele für Abläufe, um die Vorbereitung und Durchführung von Notschleppmaßnahmen zu erleichtern.
________________________
* Hinweis des Bundesministeriums für Verkehr; Bau und Stadtentwicklung:
Es handelt sich um vorbereitende Unterlagen für einen Notfall.
Regel II-1/3-5 Neueinbau asbesthaltiger Werkstoffe Interp. 1379, 1426
(MSC.99(73); MSC. 282(86))
1 Diese Regel findet Anwendung auf Werkstoffe, die für die schiffbaulichen Verbände, Maschinen, elektrischen Anlagen und Ausrüstungen verwendet werden, die von diesem Übereinkommen erfasst sind.
2 Ab dem 1. Januar 2011 ist auf allen Schiffen die Neuinstallation asbesthaltiger Werkstoffe verboten.
Regel II-1/3-6 Zugang zu und innerhalb von Räumen in und vor dem Ladungsbereich von Öltankschiffen und Massengutschiffen Interpr. 1176, 1284, 1464, 1545, 1572, 2(10)
(MSC.134(76); MSC.151(78))
1 Anwendung Interpr. 1176, 1464, 1572
1.1 Mit Ausnahme der in Absatz 1.2 geregelten Fälle findet diese Regel Anwendung auf Öltankschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 und mehr sowie auf Massengutschiffe nach der Begriffsbestimmung in Regel IX/1 mit einer Bruttoraumzahl von 20.000 und mehr, die am oder nach dem 1. Januar 2006 gebaut sind.
1.2 Öltankschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 und mehr, die am oder nach dem 1. Oktober 1994, aber vor dem 1. Januar 2005, gebaut sind, müssen der mit Entschließung MSC.27(61) angenommenen Regel II-1/12-2 entsprechen.
2 Zugang zu Lade- und anderen Räumen
2.1 Interpr. 1464, 1572 Jeder Raum muss mit einer Zugangsmöglichkeit versehen sein, damit während der gesamten Lebensdauer des Schiffes die Verwaltung, das Unternehmen nach der Begriffsbestimmung in Regel IX/1 und die auf dem Schiff tätigen Personen sowie sonstige Personen, soweit erforderlich, allgemeine und Nahbereichs-Überprüfungen der schiffbaulichen Verbände und Dickenmessungen an diesen durchführen können. Diese Zugangsmöglichkeiten müssen den Vorschriften des Absatzes 5 und den vom Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.133(76) angenommenen Technischen Bestimmungen für Zugangsmöglichkeiten zu Überprüfungszwecken in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung entsprechen, sofern diese Änderungen nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen, in Kraft gesetzt und wirksam werden.
2.2 Interpr.1176, 1464, 1572 Könnte eine feste Zugangsmöglichkeit bei normalen Lade- und Löschvorgängen beschädigt werden oder ist es aus praktischen Gründen nicht möglich, eine feste Zugangsmöglichkeit einzubauen, so kann die Verwaltung gestatten, stattdessen bewegliche oder tragbare Zugangsmittel nach Maßgabe der Technischen Vorschriften vorzusehen, sofern die Vorrichtung für das Anbringen, Befestigen, Einhängen oder Abstützen der tragbaren Zugangsmittel einen festen Bestandteil des Schiffskörpers bildet. Alle tragbaren Ausrüstungsgegenstände müssen leicht von den auf dem Schiff tätigen Personen aufgestellt oder eingesetzt werden können.
2.3 Interpr. 1176, 1464, 1572 Bauart und Werkstoffe aller Zugangsmittel und -möglichkeiten sowie ihrer Befestigungen am Schiffskörper müssen den Vorschriften der Verwaltung entsprechen. Die Zugangsmittel und -möglichkeiten unterliegen der Besichtigung vor oder in Verbindung mit ihrem Gebrauch bei der Durchführung der Besichtigungen nach Regel I/10.
3 Sicherer Zugang zu Laderäumen, Ladetanks, Ballasttanks und anderen Räumen
3.1 Interpr. 1176, 1464, 1572 Der sichere Zugang zu Laderäumen, Kofferdämmen, Ballasttanks, Ladetanks und anderen Räumen im Ladungsbereich muss unmittelbar vom offenen Deck aus möglich sein, und zwar derart, dass ihre vollständige Überprüfung sichergestellt ist. Der sichere Zugang zu Doppelbodenräumen oder zu den vorderen Ballasttanks darf von einem Pumpenraum, einem tiefliegenden Kofferdamm, einem Rohrtunnel, einem Laderaum, einem Doppelhüllenraum oder einer ähnlichen Abteilung aus erfolgen, die nicht für die Beförderung von Öl oder Gefahrgut vorgesehen ist.
3.2 Interpr. 1176, 1464, 1572 Tanks und Unterteilungen von Tanks mit einer Länge von 35 m oder mehr müssen mit mindestens zwei Zugangsluken und -leitern versehen sein, die so weit voneinander entfernt sein müssen, wie dies praktisch möglich ist. Tanks mit einer Länge von weniger als 35 m müssen mindestens über eine Zugangsluke und -leiter zugänglich sein. Ist ein Tank durch ein Schlagschott oder mehrere Schlagschotte oder ähnliche Einbauten unterteilt, die keinen leichten Zugang zu den anderen Teilen des Tanks gestatten, so müssen mindestens zwei Zugangsluken und -leitern vorhanden sein.
3.3 Jeder Laderaum muss mit mindestens zwei Zugangsmöglichkeiten versehen sein, die so weit voneinander entfernt sein müssen, wie dies praktisch möglich ist. Im Allgemeinen sollen sie diagonal zueinander angeordnet sein, zum Beispiel ein Zugang nahe dem vorderen Schott backbords, der andere Zugang nahe dem achteren Schott steuerbords.
4 Handbuch über den Zugang zu den schiffbaulichen Verbänden
4.1 Interpr. 1176, 1464, 1572 Die Zugangsmittel und -möglichkeiten zur Durchführung von allgemeinen und Nahbereichs-Überprüfungen sowie von Dickenmessungen sind in einem von der Verwaltung zugelassenen "Handbuch über den Zugang zu den schiffbaulichen Verbänden" zu beschreiben, von dem eine aktuelle Ausgabe an Bord mitzuführen ist. Das Handbuch über den Zugang zu den schiffbaulichen Verbänden muss für jeden Raum Nachstehendes enthalten:
- Pläne, auf denen die Zugangsmöglichkeiten zu dem betreffenden Raum samt den entsprechenden technischen Spezifikationen und Abmessungen dargestellt sind;
- Pläne, auf denen die Zugangsmöglichkeiten innerhalb jedes Raumes für die Durchführung einer allgemeinen Überprüfung samt den entsprechenden technischen Spezifikationen und Abmessungen dargestellt sind. Auf den Plänen muss angegeben sein, von wo aus jeder einzelne Bereich in dem betreffenden Raum überprüft werden kann;
- Pläne, auf denen die Zugangsmöglichkeiten innerhalb des betreffenden Raumes für die Durchführung einer Nahbereichs-Überprüfung samt den entsprechenden technischen Spezifikationen und Abmessungen dargestellt sind. Auf den Plänen muss verzeichnet sein, wo die kritischen Bereiche schiffbaulicher Verbände liegen, ob die Zugangsmittel und -möglichkeiten fest oder tragbar sind und von wo aus jeder einzelne Bereich überprüft werden kann;
- Anweisungen für die Überprüfung und Erhaltung der baulichen Festigkeit aller Zugangsmittel und -möglichkeiten und aller Befestigungsmittel unter Berücksichtigung einer in dem betreffenden Raum herrschenden korrosionsfördernden Atmosphäre;
- Sicherheitsanweisungen für die Fälle, in denen Flöße für Nahbereichs-Überprüfungen und Dickenmessungen verwendet werden;
- Anweisungen für das sichere Befestigen und Benutzen tragbarer Zugangsmittel;
- ein Verzeichnis aller tragbaren Zugangsmittel;
- Aufzeichnungen über die regelmäßigen Überprüfungen und die regelmäßige Instandhaltung der Zugangsmittel und -möglichkeiten des Schiffes.
4.2 Interpr. 1176, 1464, 1572 Im Sinne dieser Regel bezeichnet der Ausdruck "kritische Bereiche der schiffbaulichen Verbände" Stellen, von denen aus Berechnungen bekannt ist, dass sie der Überwachung bedürfen, oder von denen aus der Wartungshistorie ähnlicher Schiffe oder von Schwesterschiffen bekannt ist, dass sie für ein Auftreten von Rissen, Beulen, Verformung oder Korrosion anfällig sind, das die Festigkeit der schiffbaulichen Verbände beeinträchtigen würde.
5 Allgemeine technische Spezifikationen
5.1 Interpr. 1176, 1464, 1572 Für den Zugang durch waagerechte Öffnungen, Luken oder Mannlöcher müssen die Abmessungen dafür ausreichen, dass eine Person, die ein unabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung trägt, jede Leiter ohne Behinderung hinauf- oder hinabsteigen kann, und außerdem eine lichte Öffnung aufweisen, die so bemessen ist, dass das Aufheißen einer verletzten Person vom Boden des betreffenden Raumes erleichtert wird. Die lichte Mindestöffnung darf nicht weniger als 600 mm mal 600 mm betragen. Erfolgt der Zugang zu einem Laderaum durch die Ladeluke, so muss das obere Ende der Leiter so nahe wie möglich am Lukensüll angeordnet sein. Als Zugang dienende Luken mit einer Süll-Höhe von mehr als 900 mm müssen außerdem an der Außenseite Stufen haben, die in Verbindung mit der Leiter stehen.
5.2 Interpr. 1176, 1464, 1572 Für den Zugang durch senkrechte Öffnungen oder Mannlöcher in Schlagschotten, Böden, Trägern und Spanten, die einen Durchgang durch die gesamte Länge und Breite des Raumes ermöglichen, darf die Mindestöffnung nicht weniger als 600 mm mal 800 mm betragen und nicht mehr als 600 Millimeter über den Flurplatten liegen, es sei denn, dass Gitterroste oder sonstige Standmöglichkeiten vorhanden sind.
5.3 Bei Öltankschiffen mit einer Tragfähigkeit von weniger als 5.000 Tonnen kann die Verwaltung unter besonderen Umständen geringere Abmessungen für die Öffnungen nach den Absätzen 5.1 und 5.2 zulassen, sofern entsprechend den Anforderungen der Verwaltung nachgewiesen werden kann, dass sich diese Öffnungen durchqueren lassen und dass eine verletzte Person durch sie hindurch geborgen werden kann.
Regel II-1/3-7 An Bord und an Land aufzubewahrende Konstruktionszeichnungen
1 An Bord von am oder nach dem 1. Januar 2007 gebauten Schiffen ist ein Satz von Konstruktionszeichnungen, die den ursprünglichen Bauzustand des Schiffes darstellen, sowie von sonstigen Plänen, in denen sämtliche späteren baulichen Änderungen dargestellt sind, aufzubewahren.
2 Ein zusätzlicher Satz dieser Zeichnungen ist an Land vom Unternehmen nach der Begriffsbestimmung in Regel IX/1.2 aufzubewahren.
Regel II-1/3-8 Schlepp- und Festmachausrüstung Interpr.2(10)
(MSC.474(102))
1 Die Absätze 4 bis 6 finden Anwendung auf am oder nach dem 1. Januar 2007 gebaute Schiffe.
2 Die Absätze 7 und 8 finden nur auf Schiffe Anwendung,
- für die der Bauvertrag am oder nach dem 1. Januar 2024 geschlossen wird,
- falls kein Bauvertrag vorliegt, deren Kiel am oder nach dem 1. Juli 2024 gelegt wird oder die sich zu diesem Zeitpunkt in einem entsprechenden Bauzustand befinden oder
- die am oder nach dem 1. Januar 2027 abgeliefert werden.
3 Diese Regel gilt nicht für Notschleppvorrichtungen nach Regel 3-4.
4 Alle Schiffe müssen mit Vorrichtungen, Ausrüstung und Zubehörteilen von ausreichender Zugfestigkeit ausgestattet sein, um die sichere Durchführung sämtlicher dem normalen Schiffsbetrieb zuzuordnender Schlepp- und Festmacharbeiten zu ermöglichen.
5 Die Vorrichtungen, die Ausrüstung und die Zubehörteile nach Absatz 4 müssen den einschlägigen Vorschriften der Verwaltung oder einer von der Verwaltung nach Regel I/6 anerkannten Stelle entsprechen.
6 Jedes Zubehörteil und jeder Ausrüstungsgegenstand nach dieser Regel muss gegebenenfalls deutlich mit einem Hinweis auf Beschränkungen im Zusammenhang mit seinem sicheren Betrieb beschriftet sein, wobei die Festigkeit der tragenden schiffbaulichen Verbände und seiner Befestigung an diesen zu berücksichtigen sind.
7 Bei Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 3.000 und mehr muss die Festmachvorrichtung so ausgelegt und die Festmachausrüstung einschließlich der Leinen so ausgewählt sein, dass Arbeitsschutz und ein sicheres Festmachen des Schiffes auf der Grundlage der von der Organisation ausgearbeiteten Richtlinien gewährleistet sind. Es müssen schiffsspezifische Angaben zur Verfügung gestellt und an Bord mitgeführt werden.
8 Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 3.000 sollen die Vorschriften des Absatzes 7 erfüllen, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, oder die geltenden innerstaatlichen Normen der Verwaltung.
9 Bei allen Schiffen muss die Festmachausrüstung einschließlich der Leinen überprüft und in einem ihrem Bestimmungszweck entsprechenden Zustand gehalten werden."
Regel II-1/3-9 Mittel zum An- und Vonbordgehen
(MSC.256(84))
1 Am oder nach dem 1. Januar 2010 gebaute Schiffe müssen mit Mitteln zum An- und Vonbordgehen nach Absatz 2 zur Verwendung in Häfen und bei Betriebsabläufen in Häfen, wie zum Beispiel Landgänge und Fallreepstreppen, ausgestattet sein, es sei denn, die Verwaltung ist der Ansicht, dass die Einhaltung einer bestimmten Vorschrift unzweckmäßig oder undurchführbar ist.
2 Die in Absatz 1 vorgeschriebenen Mittel zum An- und Vonbordgehen müssen auf der Grundlage der von der Organisation ausgearbeiteten Richtlinien gebaut und montiert sein.
3 Bei allen Schiffen müssen die Mittel zum An- und Vonbordgehen überprüft und in einem ihrem Bestimmungszweck entsprechenden Zustand gehalten werden, wobei etwaige Einschränkungen hinsichtlich der zulässigen Belastung zu berücksichtigen sind. Alle Drahtseile, die Mittel zum An- und Vonbordgehen tragen, müssen in der in Regel III/20.4 vorgeschriebenen Weise instand gehalten werden.
Regel II-1/3-10 Zielgerichtete Schiffbaunormen für Massengutschiffe und Öltankschiffe
(MSC.290(87))
1 Diese Regel findet Anwendung auf Öltankschiffe von 150 m Länge und darüber sowie auf als Eindecker mit oberen Seitentanks und Hopper-Seitentanks in Laderäumen gebaute Massengutschiffe von 150 m Länge und darüber (mit Ausnahme von Erzfrachtschiffen und Tank-Massengutschiffen),
- für die der Bauvertrag am oder nach dem 1. Juli 2016 geschlossen wird;
- falls kein Bauvertrag vorliegt, deren Kiel am oder nach dem 1. Juli 2017 gelegt wird oder die sich zu diesem Zeitpunkt in einem entsprechenden Bauzustand befinden oder
- die am oder nach dem 1. Juli 2020 abgeliefert werden.
2 Die Schiffe müssen für eine vorausbestimmte Lebensdauer von ihrem Entwurf und ihrer Bauart her so beschaffen sein, dass sie bei ordnungsgemäßem Betrieb und ordnungsgemäßer Instandhaltung unter den vorgegebenen Betriebs- und Umweltbedingungen, unter Intakt- und bestimmten Leckbedingungen während ihrer gesamten Lebensdauer sicher und umweltverträglich sind.
2.1 "Sicher und umweltverträglich" bedeutet, dass das Schiff über eine ausreichende Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Stabilität verfügen muss, um die Gefahr eines Verlusts des Schiffes oder der Verschmutzung der Meeresumwelt aufgrund eines Versagens der Schiffsstruktur, einschließlich ihres Zusammenbruchs, welches zu einem Wassereinbruch oder dem Verlust der Wasserdichtigkeit führt, so gering wie möglich zu halten.
2.2 "Umweltverträglich" umfasst auch, dass das Schiff aus Werkstoffen gebaut ist, die für ein umweltgerechtes Recycling geeignet sind.
2.3 "Sicherheit" umfasst auch die schiffbaulichen Verbände, Zubehörteile und Vorrichtungen, die den sicheren Zugang, die sichere Flucht und Überprüfung und die ordnungsgemäße Instandhaltung gewährleisten sowie den sicheren Betrieb erleichtern.
2.4 Die "vorgegebenen Betriebs- und Umweltbedingungen" sind durch das vorgesehene Einsatzgebiet des Schiffes während seiner Lebensdauer bestimmt und umfassen die Bedingungen, einschließlich Zwischenbedingungen, die sich aus den Ladungs- und Ballastwasseroperationen im Hafen, auf Wasserstraßen und auf See ergeben.
2.5 Die "vorausbestimmte Lebensdauer" ist der angenommene nominale Zeitraum, in dem das Schiff den Betriebs- und/oder Umweltbedingungen und/oder einer korrosionsfördernden Umgebung ausgesetzt ist und der als Grundlage für die Auswahl der geeigneten Schiffsentwurfparameter dient. Jedoch kann die tatsächliche Betriebsdauer des Schiffes in Abhängigkeit von den tatsächlichen Betriebsbedingungen und der Instandhaltung des Schiffes im Laufe seines Lebenszyklus länger oder kürzer sein.
3 Den Vorschriften der Absätze 2 bis 2.5 wird durch Einhaltung der geltenden baulichen Vorschriften einer von der Verwaltung nach mit Regel XI-1/1 anerkannten Stelle entsprochen oder durch Einhaltung innerstaatlicher Normen der Verwaltung, die den Funktionsanforderungen der zielgerichteten Schiffsbauvorschriften für Massengutschiffe und Öltankschiffe entsprechen.
4 Bei Ablieferung eines neuen Schiffes wird eine Dokumentations-Datei über die schiffbauliche Struktur mit spezifischen Informationen darüber, wie die Funktionsanforderungen der zielgerichteten Schiffbaunormen für Massengutschiffe und Öltankschiffe im Entwurf und beim Bau des Schiffes umgesetzt wurden, ausgehändigt, die während der gesamten Betriebsdauer des Schiffes an Bord des Schiffes und/oder an Land aufbewahrt und gegebenenfalls aktualisiert wird. Die in der Dokumentations-Datei über die schiffbauliche Struktur enthaltenen Angaben müssen mindestens den von der Organisation erarbeiteten Richtlinien entsprechen.
Regel II-1/3-11 Korrosionsschutz für Ladeöltanks von Rohöltankschiffen
(MSC.291(87))
1 Absatz 3 findet Anwendung auf Rohöltankschiffe im Sinne der Begriffsbestimmung in Regel 1 der Anlage I des Internationalen Übereinkommens von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978 zu dem genannten Übereinkommen von 5.000 und mehr Tonnen Tragfähigkeit,
- für die der Bauvertrag am oder nach dem 1. Januar 2013 geschlossen wird;
- falls kein Bauvertrag vorliegt, deren Kiel am oder nach dem 1. Juli 2013 gelegt wird oder die sich zu diesem Zeitpunkt in einem entsprechenden Bauzustand befinden oder
- die am oder nach dem 1. Januar 2016 abgeliefert werden.
2 Absatz 3 findet keine Anwendung auf Tank-Massengutschiffe oder Chemikalientankschiffe im Sinne der Begriffsbestimmungen in den jeweiligen Regeln 1 der Anlagen I und II des Internationalen Übereinkommens von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978 zu dem genannten Übereinkommen. Im Sinne dieser Regel umfasst der Ausdruck Chemikalientankschiffe auch Chemikalientankschiffe, die für die Beförderung von Öl zugelassen sind.
3 Alle Ladeöltanks von Rohöltankschiffen müssen
- beim Bau des Schiffes mit einem Schutzanstrich versehen werden, welcher der vom Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.288(87) angenommenen "Leistungsnorm für Schutzanstriche für Ladeöltanks von Rohöltankschiffen" in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung entspricht, sofern diese Änderungen nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen, in Kraft gesetzt und wirksam werden, oder
- geschützt werden durch alternative Korrosionsschutzmittel oder durch die Verwendung korrosionsbeständiger Werkstoffe zur Erhaltung der erforderlichen baulichen Widerstandsfähigkeit über einen Zeitraum von 25 Jahren gemäß der vom Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.289(87) angenommenen "Leistungsnorm für alternative Korrosionsschutzmittel für Ladeöltanks von Rohöltankschiffen" in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung, sofern diese Änderungen nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen, in Kraft gesetzt und wirksam werden.
4 Die Verwaltung kann ein Rohöltankschiff von der Befolgung der Vorschriften des Absatzes 3 befreien und zu Prüfzwecken die Verwendung neuartiger Prototypvarianten des in Absatz 3.1 beschriebenen Schutzanstrichsystems zulassen, sofern für diese geeignete Kontrollen, eine regelmäßige Bewertung und die Feststellung der Notwendigkeit vorgesehen ist, ob sofortige Abhilfemaßnahmen erforderlich sind, wenn das System ausfällt oder ausfallen könnte. Eine solche Befreiung muss in ein Ausnahmezeugnis eingetragen werden.
5 Die Verwaltung kann ein Rohöltankschiff von der Befolgung der Vorschriften des Absatzes 3 befreien, wenn das Schiff ausschließlich für die Beförderung von Ladung und den Ladebetrieb gebaut ist, die nicht zu Korrosion führen. Eine solche Befreiung und die Bedingungen, unter denen sie gewährt wird, müssen in ein Ausnahmezeugnis eingetragen werden.
Regel II-1/3-12 Lärmschutz Anleit.1547
(MSC.338(91), MSC.409(97))
1 Diese Regel findet Anwendung auf Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 1600 und mehr,
- für die der Bauvertrag am oder nach dem 1. Juli 2014 geschlossen wird oder,
- falls kein Bauvertrag vorliegt, deren Kiel am oder nach dem 1. Januar 2015 gelegt wird oder die sich zu dieser Zeit in einem entsprechenden Bauzustand befinden oder
- die am oder nach dem 1. Juli 2018 abgeliefert werden, es sei denn, die Verwaltung ist der Ansicht, dass die Einhaltung einer bestimmten Vorschrift unzweckmäßig oder undurchführbar ist.
2 Auf Schiffen, die vor dem 1. Juli 2018 abgeliefert werden und
- für die der Bauvertrag vor dem 1. Juli 2014 geschlossen wird und deren Kiel am oder nach dem 1. Januar 2009 gelegt wird oder die sich zu dieser Zeit in einem entsprechenden Bauzustand befinden oder,
- falls kein Bauvertrag vorliegt, deren Kiel am oder nach dem 1. Januar 2009, aber vor dem 1. Januar 2015 gelegt wird oder die sich zu dieser Zeit in einem entsprechenden Bauzustand befinden,
sind Maßnahmen zu treffen, um den von Maschinen ausgehenden Lärm in Maschinenräumen auf von der Verwaltung festgesetzte annehmbare Pegel herabzusetzen. Kann dieser Lärm nicht genügend verringert werden, so muss die Quelle des übermäßigen Lärms auf geeignete Weise schallisoliert werden, oder es ist ein Lärmschutzbereich zu schaffen, falls der Raum besetzt sein muss. Erforderlichenfalls sind für das Personal, das diese Räume betreten muss, Gehörschutzkapseln vorzusehen.
3 Die Schiffe müssen so gebaut sein, dass der Lärm an Bord reduziert wird und das Personal vor dem Lärm geschützt wird, und zwar entsprechend dem durch den Schiffssicherheitsausschuss mit Entschließung MSC.337(91) angenommenen Code über Lärmpegel auf Schiffen in der jeweils von der Organisation geänderten Fassung, sofern die Änderungen nach Maßgabe des Artikels VIII dieses Übereinkommens betreffend die Verfahren zur Änderung der Anlage mit Ausnahme ihres Kapitels I beschlossen, in Kraft gesetzt und wirksam werden. Für die Zwecke dieser Regel sind die in Kapitel I des Codes über Lärmpegel auf Schiffen genannten Teile mit Empfehlungscharakter, obgleich der Code verbindlichen Charakter hat, als nicht verbindlich anzusehen, sofern die Änderungen dieser Teile mit Empfehlungscharakter vom Schiffsicherheitsausschuss nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung beschlossen werden.
4 Ungeachtet des Absatzes 1 gilt diese Regel nicht für die in Absatz 1.3.4 des Codes über Lärmpegel auf Schiffen aufgeführten Schiffstypen.
Teil B
Unterteilung und Stabilität 2) Interpr.1176, Interpr.1464, Interpr.2(10)
(MSC. 65(68); MSC.134(76); MSC. 194(80), MSC. 216(82))
(Teil B findet auf Fahrgastschiffe und Frachtschiffe Anwendung, wie dies jeweils in den Regeln angegeben ist).
Regel II-1/4 Allgemeines Erl.
(MSC.421(98))
1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, finden die Teile B-1 bis B-4 auf Fahrgastschiffe Anwendung.
2 Auf Frachtschiffe finden die Teile B-1 bis B-4 wie folgt Anwendung:
2.1 Teil B-1:
2.1.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, findet Regel II-1/5 Anwendung auf Frachtschiffe und Regel II-1/5-1 findet Anwendung auf andere Frachtschiffe als Tankschiffe im Sinne der Regel I/2 Buchstabe h;
2.1.2 die Regeln 6 bis 7-3 finden Anwendung auf Frachtschiffe mit einer Länge (L) von 80 m und darüber; von ihnen ausgenommen sein können Schiffe, die den folgenden Rechtsinstrumenten unterliegen und für die der Nachweis erbracht wurde, dass sie den Vorschriften über Unterteilung und Leckstabilität des jeweiligen Rechtsinstruments entsprechen:
- der Anlage I zu MARPOL, wobei Tank-Massengutschiffe (im Sinne der SOLAS-Regel II-2/3.14) mit Freiborden vom Typ B den Regeln II-1/6 bis 7-3+ entsprechen müssen, oder
- dem Internationalen Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut (IBC-Code) * oder
- dem Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung verflüssigter Gase als Massengut (IGC-Code) * oder
- den Leckstabilitätsvorschriften der Regel 27 des Freibord-Übereinkommens von 1966 entsprechend den Entschließungen A.320(IX) und A.514(13), vorausgesetzt, dass für Frachtschiffe, für die Regel 27 Absatz 9 gilt, die wasserdichten Hauptquerschotten, um als wirksam zu gelten, in dem Abstand angeordnet sind, der in Absatz 12 Buchstabe f der Entschließung A.320(IX) angegeben ist, wobei Schiffe, die für die Beförderung von Ladung an Deck bestimmt sind, den Regeln II-1/6 bis 7-3 entsprechen müssen, oder
- den Leckstabilitätsvorschriften der Regel 27 des Freibord-Protokolls von 1988, wobei Schiffe, die für die Beförderung von Ladung an Deck bestimmt sind, den Regeln II-1/6 bis 7-3 entsprechen müssen, oder
- den Normen für Unterteilung und Leckstabilität in anderen von der Organisation ausgearbeiteten Rechtsinstrumenten **.
2.2 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, finden die Teile B-2 und B-4 auf Frachtschiffe Anwendung.
3 Die Verwaltung kann für einzelne Schiffe oder Gruppen von Schiffen alternative Verfahren akzeptieren, sofern sie davon überzeugt ist, dass mindestens derselbe Sicherheitsgrad wie durch diese Regeln erreicht wird. Jede Verwaltung, die solche alternativen Verfahren genehmigt, teilt der Organisation die Einzelheiten mit.
4 Schiffe müssen so wirksam wie möglich unterteilt sein, wobei dem vorgesehenen Verwendungszweck Rechnung zu tragen ist. Das Ausmaß der Unterteilung ändert sich entsprechend der Unterteilungslänge des Schiffes (Ls) und dem Verwendungszweck in der Weise, dass die Schiffe mit der größten Unterteilungslänge (Ls), die vornehmlich Fahrgäste befördern, das höchste Ausmaß an Unterteilung erhalten.
5 Ist der Einbau von Decks, inneren Trennwänden oder Längsschotten von solcher Dichtigkeit vorgesehen, dass sie den Durchfluss von Wasser weitgehend behindern, so ist der Verwaltung nachzuweisen, dass die vor- oder nachteiligen Auswirkungen dieser Bauteile bei den Berechnungen gebührend berücksichtigt worden sind.
___________________
* Hinweis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur:
Es wird auf die Richtlinien für die Überprüfung der Leckstabilitätsvorschriften für Tankschiffe verwiesen (MSC.1/Rundschreiben 1461).
** Hinweis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur:
- Für Offshore-Versorger von nicht mehr als 100 m Länge (L) siehe die Richtlinien von 2006 für den Entwurf und den Bau von Offshore-Versorgern (Entschließung MSC.235(82) in der durch die Entschließung MSC.335(90) geänderten Fassung);
- für Spezialschiffe siehe den Code über die Sicherheit von Spezialschiffen von 2008 (Entschließung MSC.266(84) in ihrer geänderten Fassung).
Teil B-1
Stabilität Interpr.1176, Interpr.1464
(MSC. 216(82), MSC. 325(90))
Regel II-1/5 Intaktstabilität Erl.
(MSC. 268(85), MSC.421(98))
1 Mit jedem Fahrgastschiff, unabhängig von seiner Größe, und mit jedem Frachtschiff von 24 m Länge (L) und darüber ist nach seiner Fertigstellung ein Krängungsversuch vorzunehmen. Die Wasserverdrängung des leeren Schiffes und seiner Längs-, Quer- und Höhenschwerpunkte sind zu ermitteln. Zusätzlich zu allen weiteren anwendbaren Vorschriften dieser Regeln müssen Schiffe von 24 m Länge und darüber mindestens die Vorschriften des Teils A des IS-Codes 2008 erfüllen.
2 Die Verwaltung kann bei einem einzelnen Frachtschiff auf die Durchführung des Krängungsversuchs verzichten, sofern die grundlegenden Stabilitätsdaten aus dem Krängungsversuch eines Schwesterschiffs vorliegen und der Verwaltung der Nachweis erbracht worden ist, dass aus diesen grundlegenden Daten verlässliche Stabilitätsunterlagen für das zu befreiende Schiff gewonnen werden können, wie sie in Regel II-1/5-1 vorgeschrieben sind. Nach Fertigstellung ist eine Besichtigung des leeren Schiffes durchzuführen; wird dabei im Vergleich zu den aus dem Krängungsversuch mit dem Schwesterschiff hergeleiteten Daten eine Abweichung beim Wert der Wasserverdrängung des leeren Schiffes von mehr als 1 vom Hundert bei einem Schiff mit einer Länge von 160 m oder mehr, eine Abweichung von mehr als 2 vom Hundert bei einem Schiff mit einer Länge von 50 m oder weniger und bei dazwischen liegenden Längenwerten eine mittels linearer Interpolation zu bestimmende Abweichung gleicher Größenordnung oder aber eine Abweichung vom Längsschwerpunkt des leeren Schiffes von mehr als 0,5 vom Hundert des Wertes von L festgestellt, so ist mit dem Schiff ein Krängungsversuch durchzuführen.
3 Die Verwaltung kann auch bei einzelnen Schiffen oder Schiffsklassen, die speziell für die Beförderung von Flüssigladungen oder Erzen als Massengut gebaut sind, auf die Durchführung des Krängungsversuchs verzichten, wenn aus einem Vergleich mit vorhandenen Daten ähnlicher Schiffe klar hervorgeht, dass aufgrund der Abmessungen des Schiffes und seiner Anordnung in sämtlichen zu erwartenden Beladungszuständen eine mehr als ausreichende metazentrische Höhe erreicht wird.
4 Werden an einem Schiff Änderungen vorgenommen, die sich wesentlich auf die dem Kapitän zur Verfügung gestellten Stabilitätsunterlagen auswirken, so sind geänderte Stabilitätsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls ist ein erneuter Krängungsversuch durchzuführen. Ein erneuter Krängungsversuch ist durchzuführen, wenn damit zu rechnen ist, dass Abweichungen einen der in Absatz 5 genannten Werte überschreiten.
5 In regelmäßigen Abständen von höchstens fünf Jahren ist bei allen Fahrgastschiffen eine Besichtigung des leeren Schiffes durchzuführen, damit mögliche Veränderungen hinsichtlich der Wasserverdrängung des leeren Schiffes und des Längsschwerpunktes festgestellt werden können. Ein erneuter Krängungsversuch ist immer dann durchzuführen, wenn festgestellt oder vorausgesehen wird, dass im Vergleich zu den zugelassenen Stabilitätsunterlagen eine Abweichung hinsichtlich der Wasserverdrängung des leeren Schiffes von mehr als 2 vom Hundert oder eine Abweichung hinsichtlich des Längsschwerpunktes von mehr als 1 vom Hundert des Wertes von L vorliegt.
6 Jedes Schiff muss am Bug und am Heck deutlich angemarkte Tiefgangsmarken haben. Sind die Tiefgangsmarken nicht an Stellen angebracht, wo sie leicht ablesbar sind, oder erschweren betriebliche Einschränkungen in einem besonderen Dienst das Ablesen der Tiefgangsmarken, so muss das Schiff auch mit einem zuverlässigen Tiefgangsanzeigesystem ausgerüstet sein, mit dessen Hilfe der Tiefgang am Bug und am Heck festgestellt werden kann.
Regel II-1/5-1 Stabilitätsunterlagen für den Kapitän * Erl.
(MSC.421(98))
1 Dem Kapitän sind die erforderlichen, von der Verwaltung für ausreichend erachteten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit er sich auf schnelle und einfache Weise ein genaues Bild von der Stabilität des Schiffes unter den verschiedenen Betriebsbedingungen machen kann. Eine Zweitausfertigung der Stabilitätsunterlagen ist der Verwaltung zuzuleiten.
2 Diese Unterlagen sollen unter anderem Folgendes umfassen:
- Kurven oder Tabellen der Mindestwerte der metazentrischen Höhe des Schiffes im Betrieb (GM) und der höchstzulässigen Trimmlage, bezogen auf den Tiefgang, die die Übereinstimmung mit etwaigen Intakt- und Leckstabilitätsvorschriften sicherstellen, oder aber entsprechende Kurven oder Tabellen der größten zulässigen Schwerpunktabstände (KG) und der höchstzulässigen Trimmlage, bezogen auf den Tiefgang, oder einen gleichwertigen Ersatz einer dieser Kurven oder Tabellen,
- Anweisungen zur Bedienung von Gegenflutungseinrichtungen und
- alle sonstigen Daten und Hilfsmittel, die etwa erforderlich sind, um die vorgeschriebene Intakt- und Leckstabilität aufrechtzuerhalten.
3 Die in Regel II-1/5-1.2 vorgeschriebenen Intakt- und Leckstabilitätsunterlagen sind als konsolidierte Daten vorzulegen und müssen die gesamte betriebsbedingte Bandbreite von Tiefgang und Trimmlage umfassen. Die verwendeten Trimmwerte müssen in allen Stabilitätsunterlagen, die zur Benutzung an Bord vorgesehen sind, übereinstimmen. Angaben, die nicht zur Bestimmung der Stabilitäts- und Trimmgrenzen benötigt werden, sollen nicht in die Unterlagen aufgenommen werden.
4 Wird die Leckstabilität nach den Regeln II-1/6 bis II-1/7-3 und gegebenenfalls den Regeln II-1/8 und II-1/9.8 berechnet, so ist durch lineare Interpolation zwischen den für die drei Tiefgänge ds, dp und dl angenommenen GM-Mindestwerten eine Grenzkurve für die Leckstabilität zu bestimmen. Werden zusätzliche Unterteilungsgrade für unterschiedliche Trimmlagen berechnet, so ist eine einzelne Hüllkurve auf der Grundlage der Mindestwerte, die diese Berechnungen ergeben haben, vorzulegen. Ist beabsichtigt, Kurven der zulässigen KG-Höchstwerte zu erstellen, so ist sicherzustellen, dass die sich ergebenden Kurven der KG-Höchstwerte einer linearen Variation von GM entsprechen.
5 Anstelle einer einzelnen Hüllkurve können bei allen Trimmlagen, die für die einzelnen Unterteilungstiefgänge angenommen werden, die Berechnungen für zusätzliche Trimmlagen mit einem gemeinsamen GM-Wert durchgeführt werden. Die niedrigsten Werte jedes Teil-Unterteilungsgrads As, Ap und Al für diese Trimmlagen sind dann bei der Addition des erreichten Unterteilungsgrads A nach Regel II-1/7.1 zu verwenden. Das Ergebnis ist eine GM-Grenzkurve auf der Grundlage des für die einzelnen Tiefgänge verwendeten GM-Wertes. Es ist ein Trimmgrenzwertdiagramm zu erstellen, das die angenommenen Trimmlagen zeigt.
6 Werden keine Kurven oder Tabellen mit der Darstellung der Mindestwerte der metazentrischen Höhe des Schiffes im Betrieb (GM) oder mit dem zulässigen KG-Höchstwert, bezogen auf den Tiefgang, bereitgestellt, so muss der Kapitän sicherstellen, dass der Betriebszustand des Schiffes nicht von den genehmigten Beladungsfällen abweicht oder durch Berechnungen überprüfen, ob die Stabilitätsvorschriften beim vorliegenden Beladungsfall erfüllt sind.
_____________________
* Es wird auch auf die Richtlinien für die Erstellung von Intaktstabilitätsunterlagen (MSC/Rundschreiben 456) und die Überarbeiteten Hinweise für den Schiffsführer zur Vermeidung von gefährlichen Situationen bei ungünstigen Wetterverhältnissen und Wetterbedingungen auf See (MSC.1/Rundschreiben 1228) verwiesen.
Regel II-1/6 Vorgeschriebener Unterteilungsgrad R Erl.
(MSC.421(98))
1 Die Unterteilung eines Schiffes ist als ausreichend anzusehen, wenn der nach Regel II-1/7 ermittelte erreichte Unterteilungsgrad A nicht geringer ist als der nach der vorliegenden Regel errechnete vorgeschriebene Unterteilungsgrad R und wenn zusätzlich die Teil-Unterteilungsgrade As, Ap und Al bei Fahrgastschiffen mindestens 0,9 R und bei Frachtschiffen mindestens 0,5 R betragen.
2 Bei Schiffen, für welche die Leckstabilitätsvorschriften dieses Teils gelten, wird das herzustellende Ausmaß der Unterteilung wie folgt durch den vorgeschriebenen Unterteilungsgrad R bestimmt:
- bei Frachtschiffen mit einer Länge (Ls) von mehr als 100 m durch die Formel:
R = 1 - [128 / (Ls + 152)]
- bei Frachtschiffen mit einer Länge (L) von nicht weniger als 80 m und einer Unterteilungslänge (Ls) von nicht mehr als 100 m durch die Formel:
R = 1- [1/(1+(Ls/100) x (Ro/(1-Ro))]
wobei Ro der nach der Formel in Unterabsatz 1. errechnete Wert R ist
- bei Fahrgastschiffen durch die Formel:
Personen an Bord R N < 400 R = 0,722 400 ≤ N ≤ 1.350 R = N / 7.580 + 0,66923 1.350 < N ≤ 6.000 R = 0,0369 × Ln (N + 89,048) + 0,579 N > 6.000 R = 1 - (852,5 + 0,03875 × N) / (N + 5.000) wobei gilt: N = Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen.
Regel II-1/7 Erreichter Unterteilungsgrad A Erl.
(MSC.421(98))
1 Ein erreichter Unterteilungsgrad A ergibt sich aus der Addition der Teil-Unterteilungsgrade As, Ap und Al, die wie angegeben gewichtet und für die in Regel II-1/2 bestimmten Tiefgänge ds, dp und dl errechnet werden, gemäß der nachstehenden Formel:
A = 0,4 As + 0,4 Ap + 0,2 Al
Jeder Teil-Unterteilungsgrad ist eine Summation der Beiträge aus allen berücksichtigten Schadensfällen, bei der nachstehende Formel benutzt wird:
A= Σ pi si
| in der | |
| i | für jede berücksichtigte Abteilung oder Gruppe von Abteilungen steht, |
| pi | im Sinne der Regel II-1/7-1 für die Wahrscheinlichkeit steht, dass nur die berücksichtigte Abteilung oder Gruppe von Abteilungen geflutet wird, wobei etwaige waagerechte Unterteilungen außer Betracht bleiben, |
| si | im Sinne der Regel II-1/7-2 für die Wahrscheinlichkeit steht, dass das Schiff nach Flutung der berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen schwimmfähig bleibt, wobei die Auswirkungen etwaiger waagerechter Unterteilungen einbezogen werden. |
2 Die Berechnung von A ist beim größten Unterteilungstiefgang ds und beim Unterteilungstiefgang in teilweise beladenem Zustand dp zumindest bei ebener Trimmlage durchzuführen. Beim Tiefgang im leichtesten Zustand des im Dienst befindlichen Schiffes dl kann von der geschätzten Trimmlage des im Dienst befindlichen Schiffes ausgegangen werden. Liegt bei irgendeinem erwarteten Betriebszustand im Tiefgangsbereich von ds bis dl die Abweichung der tatsächlichen von den berechneten Trimmlagen bei mehr als 0,5 vom Hundert des Wertes L, so sind eine oder mehrere zusätzliche Berechnungen des Wertes A unter der Annahme derselben Tiefgänge, jedoch mit einer ausreichenden Anzahl von Trimmlagen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass für alle vorgesehenen Betriebszustände die Abweichung der tatsächlichen von der für eine Berechnung verwendeten Referenz-Trimmlage nicht größer als 0,5 vom Hundert des Wertes L ist. Jede zusätzliche Berechnung von A muss Regel II-1/6.1 entsprechen.
3 Zur Bestimmung der aufrichtenden Hebelarme (GZ) der Reststabilitätskurve in den Zwischenstadien der Flutung und dem Flutungsstadium bei Erreichen der End-Gleichgewichtsschwimmlage soll für die Wasserverdrängung der Wert für das Schiff im unbeschädigten Beladungszustand benutzt werden. Alle Berechnungen sollen bei einem Schiff in freier Trimmlage durchgeführt werden.
4 Die durch die obige Formel dargestellte Summe bezieht sich auf die gesamte Unterteilungslänge des Schiffes (Ls) und gilt für alle Flutungsfälle, bei denen eine einzelne Abteilung oder mehrere benachbarte Abteilungen betroffen sind. Bei unsymmetrischer Anordnung der Abteilungen soll der Mittelwert aus den Berechnungen für beide Schiffsseiten den berechneten Wert von A darstellen. Wahlweise kann stattdessen der Wert benutzt werden, der für diejenige Schiffsseite ermittelt wurde, die klar ersichtlich das ungünstigere Ergebnis ergeben hat.
5 Sind Seitenabteilungen vorhanden, so ist deren Beitrag zu der durch die Formel dargestellten Summe für alle Flutungsfälle zu berechnen, in denen Seitenabteilungen betroffen sind. Zusätzlich können Fälle von gleichzeitiger Flutung einer Seitenabteilung oder einer Gruppe von Seitenabteilungen und der angrenzenden Innenabteilung oder Gruppe von Innenabteilungen berücksichtigt werden, wobei jedoch Schäden ausgeschlossen bleiben, die sich querschiffs über mehr als die Hälfte der Breite B des Schiffes erstrecken. Für die Zwecke dieser Regel wird die Querausdehnung in Höhe des größten Unterteilungstiefgangs von der Seite des Schiffes aus im rechten Winkel zur Mittellinie nach innen gemessen.
6 Bei den nach diesen Regeln durchgeführten Berechnungen bezüglich der Flutung braucht jeweils nur eine einzige Wassereinbruchstelle in der Außenhaut und eine einzige freie Oberfläche angenommen zu werden. Die angenommene senkrechte Ausdehnung des Schadens erstreckt sich von der Grundlinie aufwärts bis zu einer wasserdichten waagerechten Unterteilung oberhalb der Wasserlinie oder höher. Führt jedoch eine geringere Schadensausdehnung zu einem ungünstigeren Ergebnis, so ist diese Schadensausdehnung anzunehmen.
7 Befinden sich Rohrleitungen, Schächte oder Tunnels innerhalb der angenommenen Ausdehnung der Beschädigung, so sind Vorkehrungen zu treffen, die sicherstellen, dass eine weitergehende Flutung sich dadurch nicht auf andere Abteilungen als diejenigen erstrecken kann, die als geflutet angenommen sind. Die Verwaltung kann jedoch eine geringfügige weitergehende Flutung zulassen, sofern nachgewiesen wird, dass deren Auswirkungen leicht beherrschbar sind und die Sicherheit des Schiffes nicht beeinträchtigt wird.
Regel II-1/7-1 Berechnung des Faktors pi Erl.
(MSC.421(98))
1 Der Faktor pi für eine Abteilung oder eine Gruppe von Abteilungen wird nach den Absätzen 1.1 und 1.2 unter Benutzung der nachstehenden Zeichen berechnet:
| j | = | die Nummer des hintersten vom Schaden betroffenen Schadensbereichs, wobei Nummer 1 sich am Heck befindet; |
| n | = | die Anzahl der vom Schaden betroffenen benachbarten Schadensbereiche; |
| k | = | die Nummer desjenigen Längsschotts, das als Barriere gegen das Eindringen in Querrichtung dient, wobei von der Außenhaut in Richtung Mittellinie gezählt wird. Für die Außenhaut ist k gleich 0; |
| x1 | = | der Abstand zwischen dem hinteren Endpunkt der Länge Ls und dem hinteren Ende des betreffenden Schadensbereichs; |
| x2 | = | der Abstand zwischen dem hinteren Endpunkt der Länge Ls und dem vorderen Ende des betreffenden Schadensbereichs; |
| b | = | der in Höhe des größten Unterteilungstiefgangs im rechten Winkel zur Mittellinie gemessene und in Metern ausgedrückte mittlere Querabstand zwischen der Außenhaut und einer angenommenen senkrechten Fläche zwischen den für die Berechnung des Faktors pi benutzten Längenbegrenzungen; diese Fläche verläuft tangential zu oder fällt zusammen mit dem am weitesten außen gelegenen Teil des betreffenden Längsschotts insgesamt oder einem Stück dieses Teils. Diese senkrechte Fläche muss so ausgerichtet sein, dass der mittlere Querabstand zur Außenhaut möglichst groß ist, jedoch nicht mehr als doppelt so groß wie der geringste Abstand zwischen der Fläche und der Außenhaut. Liegt der obere Teil eines Längsschotts unterhalb des größten Unterteilungstiefgangs, so ist von der Annahme auszugehen, dass sich die für die Berechnung des Parameters b benutzte senkrechte Fläche nach oben bis zur Höhe der obersten Unterteilungswasserlinie erstreckt. In keinem Fall darf der Wert des Parameters b größer sein als der Wert von B/2. |
Betrifft der Schaden nur einen einzelnen Bereich, so gilt:
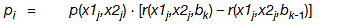
Betrifft der Schaden zwei benachbarte Bereiche, so gilt:
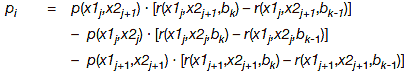
Betrifft der Schaden drei oder mehr benachbarte Bereiche, so gilt:
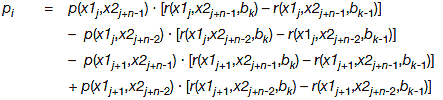
Hierbei ist r(x1 , x2, bo) = 0.
1.1 Der Faktor p(x1, x2) ist nach den folgenden Formeln zu berechnen:
| Maximale standardisierte Gesamt-Längsausdehnung der Beschädigung: | Jmax = 10/33 |
| Knickpunkt bei der Verteilung: | Jkn = 5/33 |
| Kumulative Schadenswahrscheinlichkeit am Knickpunkt Jkn: | Pk = 11/12 |
| Maximale absolute Längsausdehnung der Beschädigung: | lmax = 60 m |
| Länge, bei der die Normalverteilung endet: | L* = 260 m |
Wahrscheinlichkeitsdichte am Punkt J = 0:
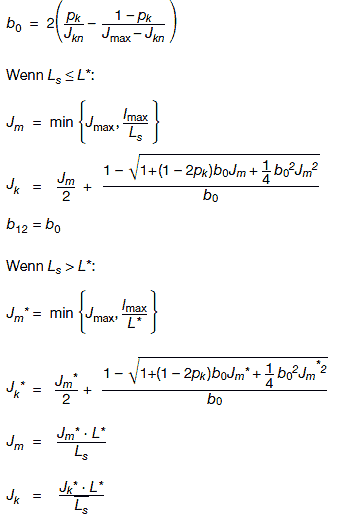
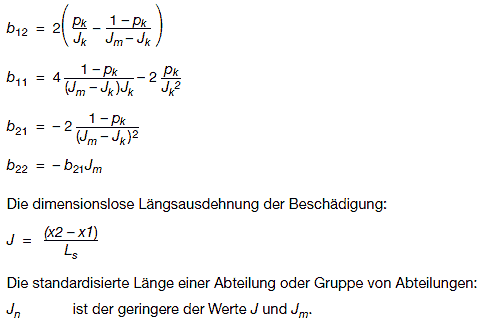
1.1.1 Fällt keine der Begrenzungen der berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen mit dem hinteren oder dem vorderen Endpunkt zusammen, so gilt:
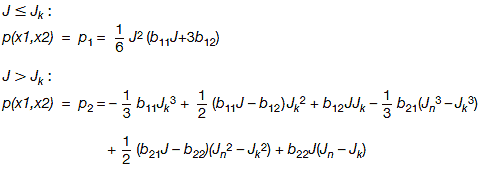
1.1.2 Fällt die hintere Begrenzung der berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen mit dem hinteren Endpunkt zusammen oder fällt die vordere Begrenzung der berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen mit dem vorderen Endpunkt zusammen, so gilt:
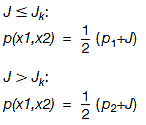
1.1.3 Erstreckt sich die berücksichtigte Abteilung oder Gruppe von Abteilungen über die gesamte Unterteilungslänge (LS), so gilt:
P(xl, x2) = 1
1.2 Der Faktor r(xl, x2, b) wird nach folgenden Formeln bestimmt:
r(x1,x2,b) = 1 - (1 - C) × [1 - g / (p(x1, x2))]
Hierbei ist
C = 12 Jb (- 45 Jb + 4), wobei
Jb = b / (15 × B) ist.
1.2.1 Erstreckt sich die berücksichtigte Abteilung oder Gruppe von Abteilungen über die gesamte Unterteilungslänge (LS), so gilt:
G = G1 = 1/2 b11 Jb2 + b12 Jb
1.2.2 Fällt keine der Begrenzungen der berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen mit dem hinteren oder dem vorderen Endpunkt zusammen, so gilt:
G = G2 =-1/3 b11 Jo3 + ½ (b11 J - b12) Jo2 + b12 JJo, wobei
Jo = min(J,Jb) ist.
1.2.3 Fällt die hintere Begrenzung der berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen mit dem hinteren Endpunkt zusammen oder fällt die vordere Begrenzung der berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen mit dem vorderen Endpunkt zusammen, so gilt:
G = 1/2 (G2 + G1 J)
Regel II-1/7-2 Berechnung des Faktors si Erl.
Interpr.1539//1
(MSC.421(98)), (MSC.474(102))
1 Der Faktor si wird für jeden Fall der angenommenen Flutung einer Abteilung oder Gruppe von Abteilungen unter Berücksichtigung der nachstehenden Zeichen und Benennungen nach dieser Regel ermittelt:
| θe | ist der Krängungswinkel der Gleichgewichtsschwimmlage in Grad in einem beliebigen Stadium der Flutung; |
| θv | ist der Neigungswinkel in einem beliebigen Stadium der Flutung, bei dem der aufrichtende Hebelarm negativ wird, oder der Winkel, bei dem eine Öffnung ins Wasser eintaucht, die nicht wetterdicht verschlossen werden kann; |
| GZmax | ist der maximale positive aufrichtende Hebelarm in Meter bis zum Winkel θv; |
Umfang ist der Umfang positiver aufrichtender Hebelarme in Grad, vom Winkel Be aus gemessen. Der positive Umfang reicht bis zum Winkel θv;
Flutungsstadium ist eine beliebige eindeutig identifizierbare Stufe während des Flutungsvorgangs, einschließlich des Stadiums unmittelbar vor dem Ausgleich des Wasserstands (sofern es überhaupt dazu kommt), bis die End-Gleichgewichtsschwimmlage erreicht ist.
1.1 Der Faktor si für einen beliebigen Schadensfall bei einem beliebigen anfänglichen Beladungszustand di wird aus folgender Formel ermittelt:
si = der geringere von den zwei Werten { sintermediate,i oder sfinal,i × smom,i }
wobei gilt:
sintermediate,i ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schiff in jedem Zwischen-Flutungsstadium bis zur End-Gleichgewichtsschwimmlage schwimmfähig bleibt; dieser Wert wird nach Absatz 2 berechnet;
sfinal,i ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schiff im Flutungsstadium bei Erreichen der End-Gleichgewichtsschwimmlage schwimmfähig bleibt; dieser Wert wird nach Absatz 3 berechnet;
smom,i ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schiff auch bei Krängungsmomenten schwimmfähig bleibt; dieser Wert wird nach Absatz 4 berechnet.
2 Bei Fahrgastschiffen und Frachtschiffen, die mit Gegenflutungseinrichtungen ausgerüstet sind, wird der Faktor sintermediate,i als der geringste aller s-Faktoren angesetzt, die für die verschiedenen Flutungsstadien ermittelt worden sind, einschließlich des Stadiums unmittelbar vor dem Ausgleich des Wasserstands (sofern es überhaupt dazu kommt); berechnet wird dieser Faktor wie folgt:
sintermediate,i = [(GZmax/0,05 * Umfang/7)0,25
wobei der Wert für GZmax nicht mit mehr als 0,05 m und der Wert für Umfang nicht mit mehr als 7 Grad angesetzt werden darf. Der Faktor sintermediate,i ist gleich 0, wenn der Zwischen-Krängungswinkel im Verlauf der Flutung 15 Grad bei Fahrgastschiffen und 30 Grad bei Frachtschiffen überschreitet.
Bei Frachtschiffen, die nicht mit Gegenflutungseinrichtungen ausgerüstet sind, wird der Faktor sintermediate,i mit dem Wert 1 angesetzt, es sei denn, die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die Stabilität während der Zwischenstadien der Flutung möglicherweise unzureichend ist; in diesem Fall soll sie diesbezüglich weitere Untersuchungen verlangen.
Bei Fahrgast- und Frachtschiffen, die mit Gegenflutungseinrichtungen ausgerüstet sind, darf der Zeitbedarf für den Wasserstandsausgleich 10 Minuten nicht überschreiten.
3 Der Faktor sfinal,i wird aus folgender Formel ermittelt:
sfinal,i = sintermediate,i = [(GZmax/ TGZmax * Umfang/ T Umfang)0,25
wobei gilt:
| der Wert für GZmax darf nicht mit mehr als dem Wert für TGZmax angesetzt werden; | ||
| der Wert für Umfang darf nicht mit mehr als dem Wert für T Umfang angesetzt werden; | ||
| TGZmax | = | 0,20 m im Fall von Ro-Ro-Fahrgastschiffen bei jedem Schadensfall, der einen Ro-Ro-Raum betrifft; |
| TGZmax | = | 0,12 m in allen sonstigen Fällen; |
| T Umfang | = | 20º im Fall von Ro-Ro-Fahrgastschiffen bei jedem Schadensfall, der einen Ro-Ro-Raum betrifft; |
| T Umfang | = | 16º in allen sonstigen Fällen; |
| K | = | 1, falls θe ≤ θmin |
| K | = | 0, falls θe ≥ θmax |
K = [(θmax - θe) / (θmax - θmin)]0,5
dabei ist
der Wert für θmin bei Fahrgastschiffen 7 Grad und bei Frachtschiffen 25 Grad und
der Wert für θmax bei Fahrgastschiffen 15 Grad und bei Frachtschiffen 30 Grad.
4 Der Faktor smom,i ist nur auf Fahrgastschiffe anwendbar (für Frachtschiffe ist smom,i mit dem Wert 1 anzusetzen) und wird unter der Annahme der End-Gleichgewichtsschwimmlage nach folgender Formel berechnet:
smom,i = [(GZmax - 0,04) · Wasserverdrängung / MKrängung]
wobei
der Ausdruck "Wasserverdrängung" die Wasserverdrängung des Schiffes im unbeschädigten Zustand bezeichnet, wenn es bis zum jeweiligen Tiefgang (ds, dp oder dl) eingetaucht ist;
der Ausdruck MKrängung das nach Absatz 4.1 berechnete maximale angenommene Krängungsmoment bezeichnet und Folgendes gilt:
smom,i ≤ 1.
4.1 Das Krängungsmoment MKrängung ist wie folgt zu berechnen:
MKrängung = der größte aus den drei Werten MFahrgäste oder MWind oder MRettungsfahrzeuge
4.1.1 MFahrgäste ist das größte angenommene Krängungsmoment, das sich aus der Bewegung von Fahrgästen ergibt, und ist wie folgt zu ermitteln:
MFahrgäste = (0,075 × Np) × (0,45 × B) (tm)
wobei
| Np | die größte Anzahl an Fahrgästen ist, die in dem Betriebszustand des Schiffes an Bord zugelassen sind, der dem hier berücksichtigten größten Unterteilungstiefgang entspricht, sowie |
| B | die Breite des Schiffes nach Regel 2.8 ist. |
Das Krängungsmoment kann wahlweise auch unter der Annahme berechnet werden, dass die Fahrgäste mit einer Dichte von 4 Personen je Quadratmeter auf den verfügbaren Decksflächen auf einer Schiffsseite, auf denen sich auch die Sammelplätze befinden, so verteilt sind, dass sie das ungünstigste Krängungsmoment erzeugen. Dabei ist ein Körpergewicht von 75 kg je Fahrgast anzusetzen.
4.1.2 MWind ist das höchste für eine Schadenssituation angenommene Windmoment:
MWind = (P × A × Z) / 9806 (tm)
dabei ist
P = 120 N/m2;
A = die projizierte Seitenfläche über der Wasserlinie;
Z = der Abstand vom Mittelpunkt der projizierten Seitenfläche über der Wasserlinie bis zu einer Linie in Höhe von T/2;
T = der jeweilige Tiefgang (ds, dp oder dl).
4.1.3 MÜberlebensfahrzeuge ist das größte angenommene Krängungsmoment, das entsteht, wenn alle mit Davits auszusetzenden Überlebensfahrzeuge voll besetzt auf einer Seite des Schiffes ausgesetzt werden. Bei der Berechnung ist von folgenden Annahmen auszugehen:
- Alle Rettungs- und Bereitschaftsboote, die auf der Seite angebracht sind, zu der das Schiff nach der Beschädigung krängt, sind voll besetzt ausgeschwungen und zum Zuwasserlassen bereit;
- bei Rettungsbooten, die so angeordnet sind, dass sie voll besetzt aus der Staustellung ausgesetzt werden müssen, wird das größte Krängungsmoment während des Aussetzens zugrunde gelegt;
- an jedem Davit auf der Seite, nach der das Schiff nach der Beschädigung krängt, ist ein voll besetztes mit Davits auszusetzendes Rettungsfloß befestigt und ausgeschwungen zum Zuwasserlassen bereit;
- Personen, die sich nicht in ausgeschwungenen Rettungsmitteln befinden, stellen weder ein zusätzliches Krängungsmoment noch ein zusätzliches aufrichtendes Moment dar;
- die Rettungsmittel auf der Seite des Schiffes, die der Seite, nach der das Schiff krängt, gegenüberliegt, befinden sich in ihrer Stauposition.
5 Eine unsymmetrische Flutung ist durch geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Ist es notwendig, große Krängungswinkel auszugleichen, so müssen die Vorkehrungen, soweit durchführbar, selbsttätig wirken; etwaige Steuerungen für Vorrichtungen zum Ausgleich des Wasserstands müssen jedoch stets von oberhalb des Schottendecks aus bei Fahrgastschiffen und von oberhalb des Freiborddecks aus bei Frachtschiffen bedient werden können. Diese Vorrichtungen zusammen mit ihren Steuerungen müssen für die Verwaltung annehmbar sein .* Dem Kapitän des Schiffes sind geeignete Unterlagen über den Gebrauch solcher Vorrichtungen zur Verfügung zu stellen.
___________________
* Hinweis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur:
Es wird auf die Überarbeitete Empfehlung für ein Standardverfahren zur Bewertung von Querflutungseinrichtungen in der jeweils geltenden Fassung verwiesen, die von der Organisation mit Entschließung MSC.362(92) angenommen wurde.
5.1 Tanks und Abteilungen, die an diesem Ausgleich des Wasserstands beteiligt sind, müssen mit Luftrohren oder gleichwertigen Vorrichtungen mit ausreichendem Querschnitt versehen sein, damit sichergestellt ist, dass die Wasserausgleichsströmung zwischen den betroffenen Abteilungen nicht verzögert wird.
5.2 Der Faktor si ist in jenen Fällen mit Null anzusetzen, in denen die Endschwimmlage unter Berücksichtigung von Tauchung, Krängung und Trimm
- bei Frachtschiffen die Unterkante von Öffnungen eintauchen lässt, durch die eine weitergehende Flutung eintreten kann, und diese Flutung bei der Berechnung des Faktors s; unberücksichtigt bleibt. Dazu zählen Luftrohre, Lüfter und Öffnungen, die durch wetterdichte Türen oder Lukendeckel verschließbar sind;
- einen Teil des Schottendecks auf einem Fahrgastschiff eintauchen lässt, wenn dieser Teil als waagerecht verlaufender Fluchtweg gilt, der im Sinne der Einhaltung des Kapitels II-2 vorgesehen ist;
- bei Fahrgastschiffen, die unter Regel 1.1.1.1 fallen und vor dem 1. Januar 2024 gebaut sind, die Unterkante von Öffnungen eintauchen lässt, durch die eine weitergehende Flutung eintreten kann, und diese Flutung bei der Berechnung des Faktors si unberücksichtigt bleibt. Dazu zählen Luftrohre, Lüfter und Öffnungen, die durch wetterdichte Türen oder Lukendeckel verschließbar sind.
5.3 Der Faktor si ist mit Null anzusetzen, wenn unter Berücksichtigung von Tauchung, Krängung und Trimm in einem Zwischenstadium der Flutung oder im Endstadium der Flutung eine der nachstehend beschriebenen Bedingungen eintritt:
- die Eintauchung einer senkrecht angeordneten Notausstiegsluke auf dem Schottendeck bei Fahrgastschiffen und dem Freiborddeck bei Frachtschiffen, die im Sinne der Einhaltung des Kapitels II-2 eingebaut ist;
- die Unerreichbarkeit oder Unbedienbarkeit von oberhalb des Schottendecks bei Fahrgastschiffen und oberhalb des Freiborddecks bei Frachtschiffen angeordneten Bedienungsvorrichtungen für wasserdichte Türen, für Vorrichtungen zum Ausgleich des Wasserstands und für Ventile von Rohrleitungen oder Lüftungsschächten, die dafür vorgesehen sind, die Dichtheit wasserdichter Schotte aufrechtzuerhalten;
- die Eintauchung eines Teiles von Rohrleitungen oder Lüftungsschächten innerhalb der angenommenen Schadensausdehnung, die durch eine wasserdichte Begrenzung geführt sind, falls dies zu einer fortschreitenden Flutung von Abteilungen führen kann, bei denen unterstellt wird, dass sie nicht geflutet sind;
- bei am oder nach dem 1. Januar 2024 gebauten Fahrgastschiffen die Eintauchung der Unterkante von Öffnungen, durch die eine weitergehende Flutung eintreten kann, und diese Flutung bei der Berechnung des Faktors si unberücksichtigt bleibt. Dazu zählen Luftrohre, Lüfter und Öffnungen, die durch wetterdichte Türen oder Lukendeckel verschließbar sind.
5.4 Werden jedoch bei der Leckstabilitätsberechnung Abteilungen berücksichtigt, bei denen unterstellt wird, dass sie aufgrund fortschreitender Flutung geflutet sind, so können unter der Annahme des Wasserstandsausgleichs in zusätzlichen Flutungsphasen mehrfache Werte für die Größe sintermediate,i ermittelt werden.
5.5 Außer in dem in Absatz 5.3.1 geregelten Fall brauchen Öffnungen nicht berücksichtigt zu werden, die durch wasserdichte Mannlochdeckel und Sturmblenden, fernbediente wasserdichte Schiebetüren, Schiffsfenster vom nicht zu öffnenden Typ sowie wasserdichte Zugangstüren und wasserdichte Lukendeckel verschlossen sind und für die vorgeschrieben ist, dass sie während der Fahrt nach den Regeln 22 bis 24 geschlossen bleiben.
6 Sind waagerechte wasserdichte Begrenzungen oberhalb der berücksichtigten Wasserlinie angebracht, so errechnet sich der Faktor s für die darunterliegende Abteilung oder Gruppe von Abteilungen durch Multiplikation des nach Absatz 1.1 ermittelten Wertes mit dem Reduktionsfaktor vm nach Absatz 6.1, durch den die Wahrscheinlichkeit ausgedrückt wird, dass die Räume oberhalb der waagerechten Unterteilung nicht geflutet werden.
6.1 Der Faktor vm wird aus folgender Formel ermittelt:
vm = v(Hj, n, m, d) - v(Hj, n, m-1, d),
| wobei gilt: | |
| Hj,n, m | ist die in Meter ausgedrückte geringste Höhe über der Grundlinie innerhalb des Längenbereichs x1(j)...x2(j+n-1) der (m-1)ten waagerechten Begrenzung, die als Begrenzung der senkrechten Ausdehnung der Flutung der berücksichtigten beschädigten Abteilungen gilt; |
| Hj,n,m-1 | ist die in Meter ausgedrückte geringste Höhe über der Grundlinie innerhalb des Längenbereichs x1(j) ...x2(j+n-1) der (m-1)ten waagerechten Begrenzung, die als Begrenzung der senkrechten Ausdehnung der Flutung der berücksichtigten beschädigten Abteilungen gilt; |
| j | steht für den hinteren Endpunkt der berücksichtigten beschädigten Abteilungen; |
| m | ist die Anzahl der von der berücksichtigten Wasserlinie aufwärts gezählten waagerechten Begrenzungen; |
| d | ist der maßgebliche Tiefgang nach der Begriffsbestimmung in Regel 2; |
| x1 und x2 | sind die Endpunkte der in Regel II-1/7-1 berücksichtigten Abteilung oder Gruppe von Abteilungen. |
6.1.1 Die Faktoren v(Hj, n, m, d) und v(Hj, n, m-1, d) werden aus folgenden Formeln ermittelt:
v(H,d) = 0,8 [(H-d) / 7,8] , falls (Hm - d) weniger als oder gleich 7,80 m ist;
v(H,d) = 0,8 + 0,2 [((H - d) - 7,8) / 4,7] in allen anderen Fällen,
wobei
v (Hj, n, m, d) mit 1 anzusetzen ist, falls Hm mit der obersten wasserdichten Begrenzung des Schiffes innerhalb des Bereichs (x1 (j) ... x2(j+n-1)) zusammenfällt und
v (Hj, n, o, d) mit 0 anzusetzen ist.
In keinem Fall darf vm mit weniger als Null oder mit mehr als 1 angesetzt werden.
6.2 Im Allgemeinen wird jeder zum Unterteilungsgrad A beitragende Tiefgang dA bei waagerechten Unterteilungen aus folgender Formel ermittelt:
dA = pi ·[v1 * smin1 +(v2 - v1)· smin2 +····+(1- vm-1)·* smin m],
wobei gilt:
vm = der nach Absatz 6.1 berechnete v-Wert;
smin = der geringste s-Faktor für alle Kombinationen von Schäden, den man erhält, wenn sich der angenommene Schaden von der angenommenen Schadenshöhe Hm nach unten erstreckt.
Regel II-1/7-3 Flutbarkeit Erl.
1 Für die Berechnung der Unterteilung und der Leckstabilität im Rahmen der Regeln ist die Flutbarkeit einzelner allgemeiner Abteilungen oder eines Teils einer Abteilung wie folgt:
| Räume | Flutbarkeit |
| für Vorräte bestimmt | 0,60 |
| durch Unterkunftsräume belegt | 0,95 |
| durch Maschinenanlagen belegt | 0,85 |
| Leerräume | 0,95 |
| für Flüssigkeiten vorgesehen | 0 oder 0,95 1) |
| 1) je nachdem, welcher Wert zur strengeren Forderung führt. | |
2 Laderäume oder eines Teils eines Laderaums wie folgt:
| Räume | Flutbarkeit bei Tiefgang ds | Flutbarkeit bei Tiefgang dp | Flutbarkeit bei Tiefgang dl |
| Räume für Stückgut | 0,70 | 0,80 | 0,95 |
| Räume für Container | 0,70 | 0,80 | 0,95 |
| Ro-Ro-Räume | 0,90 | 0,90 | 0,95 |
| Räume für Flüssigladungen | 0,70 | 0,80 | 0,95 |
3 Es dürfen auch andere Flutbarkeiten benutzt werden, sofern diese durch Berechnungen gestützt sind.
Regel II-1/8 Besondere Vorschriften zur Stabilität von Fahrgastschiffen Erl.
(MSC.421(98))
1 Fahrgastschiffe, die für die Beförderung von 400 oder mehr Personen vorgesehen sind, müssen hinter dem Kollisionsschott wasserdichte Unterteilungen in der Weise haben, dass für einen Schaden, der sich auf alle Abteilungen innerhalb eines Abstands von 0,08 L (gemessen vom vorderen Lot) erstreckt, für die drei Beladungszustände, die für die Berechnung des erreichten Unterteilungsgrads A herangezogen werden, der Faktor si = 1 ist. Wird der erreichte Unterteilungsgrad A für unterschiedliche Trimmlagen berechnet, so muss diese Vorschrift auch für die betreffenden Beladungszustände erfüllt werden.
2 Fahrgastschiffe, die für die Beförderung von 36 oder mehr Personen vorgesehen sind, müssen bei einem Schaden entlang der seitlichen Außenhaut bis zu der in Absatz 3 genannten Größe schwimmfähig bleiben. Um diese Regel einzuhalten, muss nachgewiesen werden, dass der Faktor si im Sinne der Regel II-1/7-2 für die drei Beladungszustände, die für die Berechnung des erreichten Unterteilungsgrads A herangezogen werden, mindestens 0,9 beträgt. Wird der erreichte Unterteilungsgrad A für unterschiedliche Trimmlagen berechnet, so muss diese Vorschrift auch für die betreffenden Beladungszustände erfüllt werden.
3 Die Schadensausdehnung, die beim Nachweis der Erfüllung des Absatzes 2 anzunehmen ist, hängt sowohl von der Gesamtzahl der beförderten Personen als auch von der Größe L ab; demgemäß gilt Folgendes:
- Es ist von der Annahme auszugehen, dass sich die senkrechte Schadensausdehnung von der Grundlinie des Schiffes bis zu einer Höhe von 12,50 m oberhalb des größten Unterteilungstiefgangs nach der Begriffsbestimmung in Regel II-1/2 erstreckt, sofern nicht eine geringere senkrechte Schadensausdehnung einen geringeren Wert für die Größe si ergibt, in welchem Fall diese verringerte Ausdehnung zugrunde zu legen ist;
- ist die Beförderung von 400 oder mehr Personen vorgesehen, so ist eine Längsausdehnung des Schadens von 0,03 L, mindestens jedoch von 3 m, an einer beliebigen Stelle entlang der seitlichen Außenhaut anzunehmen, und zwar bei einer Eindringtiefe von 0,1 B, mindestens jedoch von 0,75 m, gemessen in Höhe des größten Unterteilungstiefgangs von der Seite des Schiffes aus im rechten Winkel zur Mittellinie nach innen;
- bei Beförderung von weniger als 400 Personen ist anzunehmen, dass sich die Längsausdehnung des Schadens an einer beliebigen Stelle entlang der seitlichen Außenhaut zwischen wasserdichten Querschotten erstreckt, sofern der Abstand zwischen zwei benachbarten wasserdichten Querschotten nicht geringer ist als die angenommene Längsausdehnung des Schadens. Ist der Abstand zwischen benachbarten wasserdichten Querschotten geringer als die angenommene Längsausdehnung des Schadens, so darf für den Nachweis der Einhaltung des Absatzes 2 nur eines dieser Schotte als wirksam betrachtet werden;
- bei Beförderung von 36 Personen ist eine Längsausdehnung des Schadens von 0,015 L, mindestens jedoch von 3 m, anzunehmen, und zwar bei einer Eindringtiefe von 0,05 B, mindestens jedoch von 0,75 m;
- bei Beförderung von mehr als 36, jedoch weniger als 400 Personen sind die für die Festlegung der angenommenen Schadensausdehnung verwendeten Werte für die Längsausdehnung des Schadens und für die Eindringtiefe durch lineare Interpolation zwischen den in den Unterabsätzen .4 und .2 detailliert angegebenen Werten für die Längsausdehnung des Schadens und für die Eindringtiefe zu ermitteln, die für Schiffe gelten, die 36 beziehungsweise die 400 Personen befördern.
Regel II-1/8-1 Systemanforderungen und Betriebsinformationen nach einem Wassereinbruch auf einem Fahrgastschiff * Erl.,
MSC. 325(90), MSC.421(98), MSC.436(99))
1 Anwendung
Dieser Regel müssen Fahrgastschiffe entsprechen, die eine Länge nach der Begriffsbestimmung in Regel II-1/2.5 von 120 m oder mehr oder aber drei oder mehr senkrechte Hauptbrandabschnitte haben.
2 Verfügbarkeit wichtiger Systeme bei einem Schaden durch Wassereinbruch *
Ein Fahrgastschiff muss so entworfen sein, dass die in Regel II-2/21.4 aufgeführten Systeme betriebsfähig bleiben, wenn eine beliebige einzelne wasserdichte Abteilung des Schiffes geflutet ist.
3 Betriebsinformationen nach einem Wassereinbruch
3.1 Zur Bereitstellung von Betriebsinformationen für den Kapitän zum Zweck der sicheren Weiterfahrt in einen Hafen nach einem Wassereinbruch müssen die Fahrgastschiffe über
- einen bordeigenen Stabilitätsrechner oder
- landseitige Unterstützung
nach Maßgabe der von der Organisation erarbeiteten Richtlinien verfügen.**
3.2 Vor dem 1. Januar 2014 gebaute Fahrgastschiffe müssen spätestens bei der ersten Erneuerungsbesichtigung nach dem 1. Januar 2025 den Vorschriften des Absatzes 3.1 entsprechen.
_______________________
*) Hinweis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur:
Es wird auf die Vorläufigen Erläuterungen zur Beurteilung der Systemanforderungen für Fahrgastschiffe nach einem Brand oder einem Wassereinbruch (MSC.1/Rundschreiben 1369) verwiesen.
**) Hinweis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur: Es wird auf die Richtlinien über die betrieblichen Informationen für Kapitäne von Passagierschiffen zur sicheren Rückkehr in den Hafen mit eigenem Antrieb oder im Schlepp (MSC.1/Rundschreiben 1400) für am oder nach dem 1. Januar 2014, aber vor dem 13. Mai 2016 gebaute Schiffe beziehungsweise die Überarbeiteten Richtlinien über Betriebsinformationen für Kapitäne von Fahrgastschiffen zur sicheren Rückkehr in den Hafen (MSC.1/Rundschreiben 1532/Rev.1) für am oder nach dem 13. Mai 2016 gebaute Schiffe beziehungsweise die Richtlinien über Betriebsinformationen für Kapitäne bei einem Wassereinbruch auf vor dem 1. Januar 2014 gebauten Fahrgastschiffen (MSC.1/Rundschreiben 1589) verwiesen.
 | weiter . |  |
...
X
⍂
↑
↓
